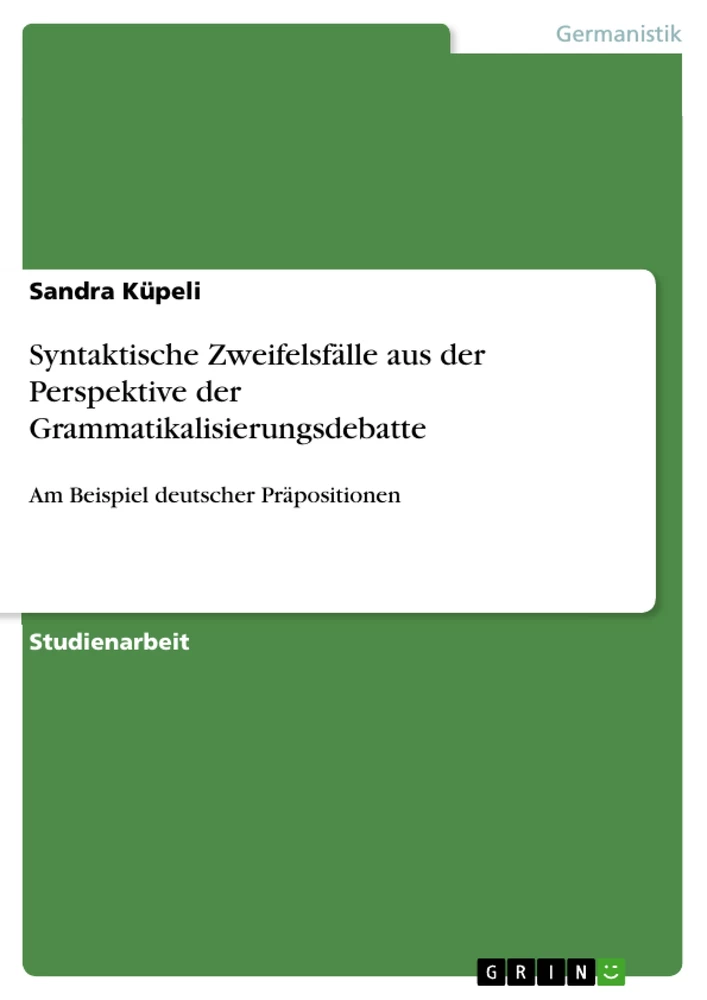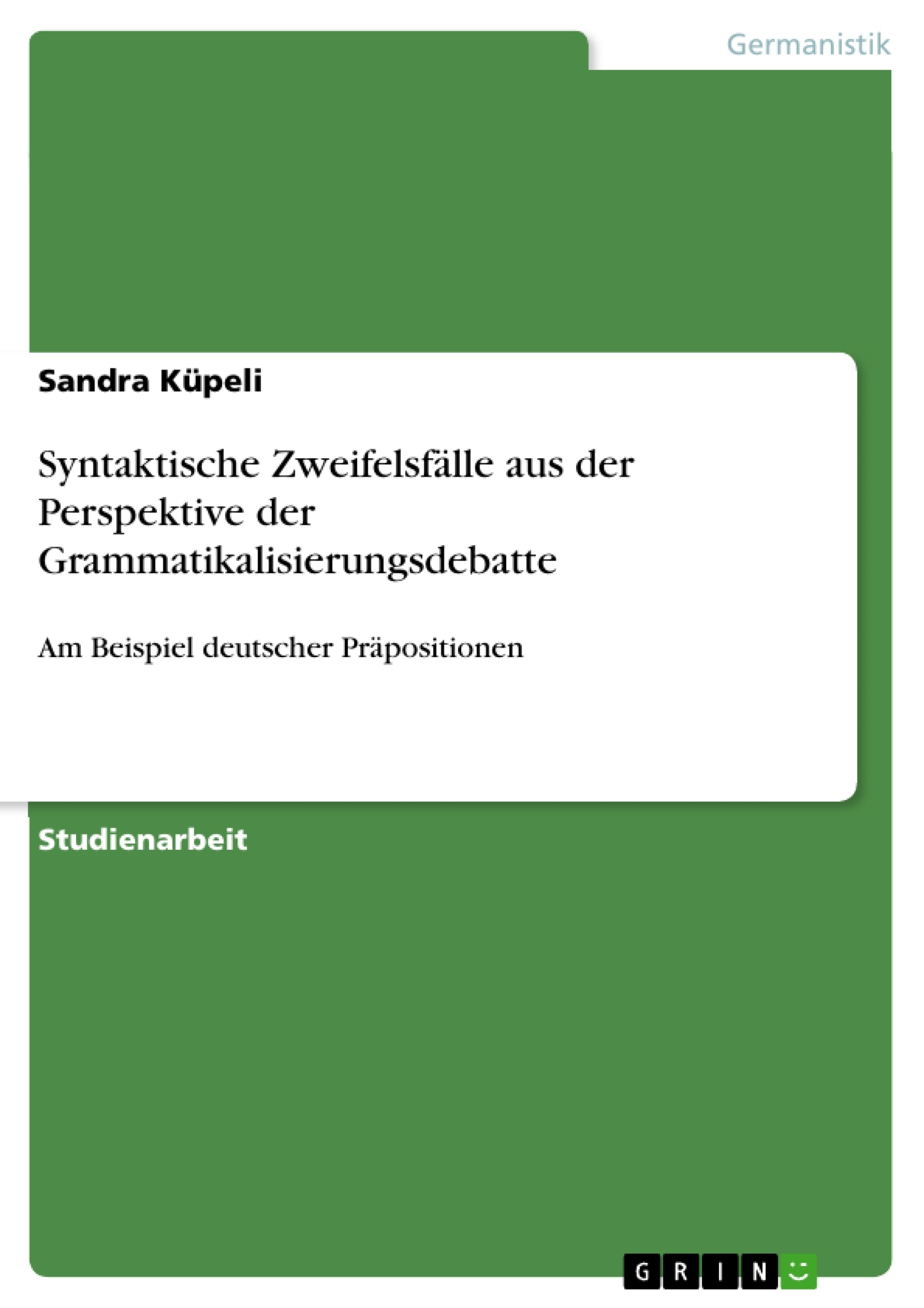Das Konzept der Grammatikalisierung eignet sich neben sprachvergleichenden Untersuchungen und der Beschreibung historischer Entwicklungen auch zur Einordnung synchroner Erscheinungen. Somit sollen im synchronen Sprachgebrauch vorkommende Zweifelsfälle anhand dieser Theorie beleuchtet werden.
Nachdem in einem ersten Schritt geklärt wird, was hier mit „Zweifelsfall“ gemeint ist, sollen die Grundzüge des Grammatikalisierungskonzeptes in Kapitel 3 vorgestellt werden, um dann näher auf die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen einzugehen. Ausschlaggebend ist dabei nicht zuletzt das im Jahr 2000 erschienene Werk von Claudio Di Meola, der dieses Phänomen erstmalig ganzheitlich betrachtet. Es wird versucht, grammatikalisch zweifelhafte oder mehrdeutige Fälle im präpositionalen Gebrauch zu erklären. Dies kann zwar nicht ganz ohne den Rückgriff auf die diachrone Entwicklung geschehen, doch wird der Schwerpunkt der hier vorliegenden Arbeit deutlich durch die synchrone Betrachtung der präpositionalen Zweifelsfälle bestimmt. Beispielhaft für Varianten im Sprachgebrauch werden besonders der Wechsel zwischen Prä- und Poststellung sowie die Alternation zwischen Dativ- und Genitivrektion betrachtet.
Schließlich soll die Darstellung syntaktischer Zweifelsfälle in einem der wichtigsten deutschsprachigen Nachschlage, dem Duden, untersucht werden hinsichtlich der vorangestellten Beobachtungen zur Grammatikalisierung deutscher Präpositionen.
Unterschiedliche Herangehensweisen an das Phänomen Zweifelsfall sollen kontrastiert, aber auch Gemeinsamkeiten bei der Betrachtung dieser Fälle herausgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Zweifelsfall?
- Grammatikalisierung – Theorie und grundsätzliche Begrifflichkeiten
- Grammatikalisierung deutscher Präpositionen
- Vorbemerkung zum Präpositionsbegriff
- Prototypisierung und Grammatikalisierung
- präpositionale Zweifelsfälle als Folge von Grammatikalisierungsprozessen
- Der Umgang mit syntaktischen Zweifelsfällen im Duden
- Die Frage der Prä- oder Poststellung am Beispiel gemäß
- Die Frage nach der Kasusrektion ursprünglicher Dativpräpositionen
- Das Beispiel gemäß
- Statistische Häufigkeit und sprachliche Norm
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht syntaktische Zweifelsfälle im Deutschen, insbesondere im Bereich der Präpositionen, unter dem Blickwinkel der Grammatikalisierungstheorie. Ziel ist es, mehrdeutige oder zweifelhafte präpositionale Konstruktionen anhand von Grammatikalisierungsprozessen zu erklären und den Umgang mit solchen Fällen im Duden zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung syntaktischer Zweifelsfälle
- Theorie der Grammatikalisierung und deren Relevanz für die Analyse
- Grammatikalisierungsprozesse deutscher Präpositionen
- Prä- und Poststellung von Präpositionen
- Kasusrektion und ihre Variationen bei Präpositionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht synchrone sprachliche Zweifelsfälle im Deutschen mithilfe des Konzepts der Grammatikalisierung. Sie konzentriert sich auf präpositionale Konstruktionen und analysiert deren mehrdeutige Verwendung im aktuellen Sprachgebrauch, unter Bezugnahme auf das Werk von Claudio Di Meola. Der Fokus liegt auf der synchronen Betrachtung, wobei diachrone Aspekte unterstützend herangezogen werden. Die Arbeit vergleicht verschiedene Perspektiven auf den Umgang mit Zweifelsfällen und untersucht die Darstellung dieser im Duden.
Was ist ein Zweifelsfall?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Zweifelsfall“ als Situation, in der muttersprachliche Sprecher Unsicherheit über die grammatisch korrekte Formulierung zeigen. Es unterscheidet den Zweifelsfall vom einfachen Fehler und betont die Rolle des „Sprachgefühls“. Die Definition eines Zweifelsfalls als sprachliche Einheit, bei der mehrere kompetente Sprecher Unsicherheit über die Standardsprachlichkeit verschiedener Varianten zeigen, wird etabliert. Die Schwierigkeiten, dieses intuitive Wissen zu erforschen, werden hervorgehoben und die Notwendigkeit der Betrachtung von Grammatikalisierungsprozessen zur Erklärung solcher Fälle wird begründet.
Grammatikalisierung – Theorie und grundsätzliche Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Grammatikalisierungstheorie. Es unterteilt Sprachzeichen in Inhaltswörter (lexikalische Zeichen) und Funktionswörter (grammatische Zeichen), wobei die Eigenschaften prototypisch sind. Die Unterscheidung zwischen freien und gebundenen Morphemen innerhalb beider Gruppen wird dargelegt. Es wird die Tendenz beschrieben, dass grammatische Zeichen eher gebunden als frei auftreten, und die besondere Stellung von Präpositionen als typischerweise freie, historisch aus lexikalischen Zeichen entstandene grammatische Elemente herausgestellt.
Grammatikalisierung deutscher Präpositionen: Dieses Kapitel behandelt die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen, beginnend mit einer Vorbemerkung zum Präpositionsbegriff selbst. Es wird die Prototypisierung und der Grammatikalisierungsprozess von Präpositionen näher beleuchtet und schließlich analysiert, wie präpositionale Zweifelsfälle als Ergebnis solcher Prozesse verstanden werden können. Der Fokus liegt auf der Erklärung von mehrdeutigen Fällen im präpositionalen Gebrauch, wobei der diachrone Aspekt unterstützend genutzt wird.
Der Umgang mit syntaktischen Zweifelsfällen im Duden: Das Kapitel analysiert die Darstellung von syntaktischen Zweifelsfällen im Duden. Es untersucht insbesondere die Behandlung von Prä- und Poststellung sowie der Kasusrektion, beispielhaft am Fall der Präposition „gemäß“. Der Vergleich unterschiedlicher Herangehensweisen im Duden und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Betrachtung von Zweifelsfällen bilden den Kern dieses Kapitels. Die Rolle statistischer Häufigkeit bei der Bestimmung der sprachlichen Norm wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Grammatikalisierung, syntaktische Zweifelsfälle, deutsche Präpositionen, Prä- und Poststellung, Kasusrektion, Duden, Sprachgefühl, Standardsprache, Synchrone Linguistik, Diachrone Linguistik, Prototypisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Syntaktische Zweifelsfälle im Deutschen - Eine grammatikalisierungstheoretische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht syntaktische Zweifelsfälle im Deutschen, insbesondere bei Präpositionen, aus grammatikalisierungstheoretischer Perspektive. Sie analysiert mehrdeutige präpositionale Konstruktionen und deren Behandlung im Duden.
Was wird unter einem „Zweifelsfall“ verstanden?
Ein Zweifelsfall liegt vor, wenn muttersprachliche Sprecher Unsicherheit über die grammatisch korrekte Formulierung zeigen. Es ist ein Unterschied zum einfachen Fehler und basiert auf dem „Sprachgefühl“. Die Arbeit definiert ihn als sprachliche Einheit, bei der mehrere kompetente Sprecher Unsicherheit über die Standardsprachlichkeit verschiedener Varianten zeigen.
Welche Rolle spielt die Grammatikalisierungstheorie?
Die Grammatikalisierungstheorie ist zentral. Sie erklärt die Entstehung von grammatischen Elementen aus lexikalischen und analysiert, wie Grammatikalisierungsprozesse zu mehrdeutigen präpositionalen Konstruktionen führen können. Die Arbeit differenziert zwischen Inhalts- und Funktionswörtern und freien und gebundenen Morphemen.
Wie werden deutsche Präpositionen im Kontext der Grammatikalisierung behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Prototypisierung und den Grammatikalisierungsprozess deutscher Präpositionen. Sie analysiert, wie präpositionale Zweifelsfälle als Ergebnis dieser Prozesse entstehen. Dabei wird der diachrone Aspekt unterstützend genutzt.
Wie werden syntaktische Zweifelsfälle im Duden dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Zweifelsfällen im Duden, insbesondere die Behandlung von Prä- und Poststellung sowie der Kasusrektion, anhand von Beispielen wie der Präposition „gemäß“. Sie vergleicht unterschiedliche Herangehensweisen im Duden und diskutiert die Rolle statistischer Häufigkeit bei der Bestimmung der sprachlichen Norm.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Definition von Zweifelsfällen, Grammatikalisierungstheorie, Grammatikalisierung deutscher Präpositionen, dem Umgang mit Zweifelsfällen im Duden und einem Resümee. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grammatikalisierung, syntaktische Zweifelsfälle, deutsche Präpositionen, Prä- und Poststellung, Kasusrektion, Duden, Sprachgefühl, Standardsprache, Synchrone Linguistik, Diachrone Linguistik, Prototypisierung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, mehrdeutige oder zweifelhafte präpositionale Konstruktionen anhand von Grammatikalisierungsprozessen zu erklären und den Umgang mit solchen Fällen im Duden zu analysieren.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt eine synchrone Perspektive, wobei diachrone Aspekte unterstützend herangezogen werden. Sie analysiert den Sprachgebrauch und vergleicht verschiedene Perspektiven auf den Umgang mit Zweifelsfällen.
- Quote paper
- Sandra Küpeli (Author), 2005, Syntaktische Zweifelsfälle aus der Perspektive der Grammatikalisierungsdebatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113904