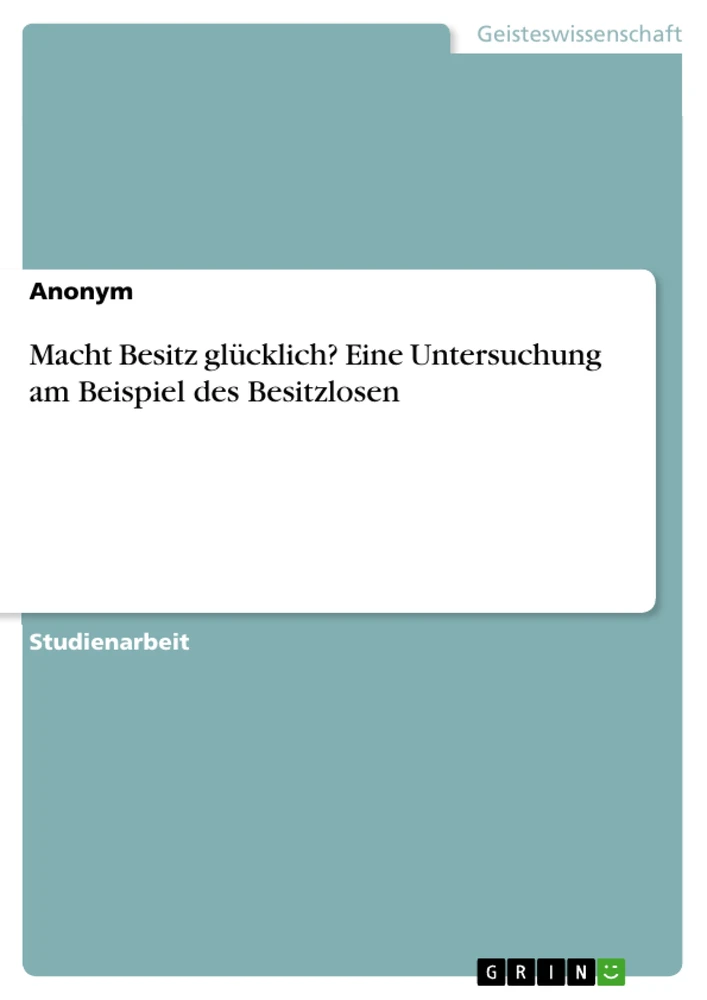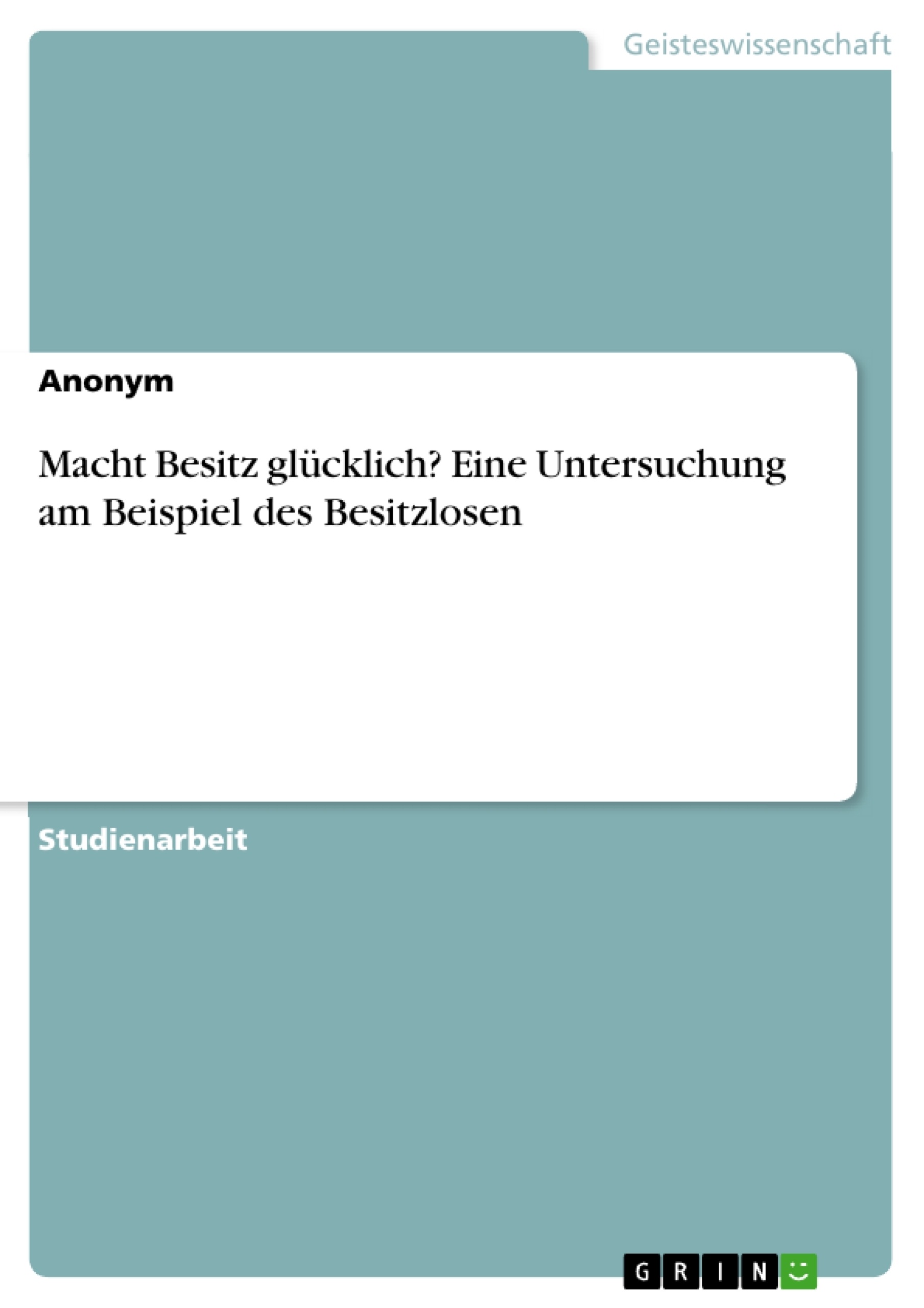Der Mensch konsumiert, obwohl seine Grundbedürfnisse längst befriedigt sind, denn die Konsumgüter versprechen ihm ein erfüllteres, glücklicheres, längeres Leben. Er kann sich mit ihnen identifizieren oder darstellen.
Die Frage, die sich damit stellen, sind: Wird sich die eigene Wohnung und der eigene Besitz in Zukunft auflösen? Wie würde eine Stadt ohne Besitz aussehen und welche Auswirkungen hätte das auf die Gemeinschaft? Dazu werden die Themen Besitz, Glück und Sharing näher betrachtet. Zudem werden Umfragen und Experimente durchgeführt, die das Gestalten im Ausnahmezustand, ohne Ernstfall-Konsequenzen spielerisch darstellen. Dazu wird die uns alltäglich umgebende Realität gewandelt, von den Spielregeln befreit und durch möglicherweise nur momentan nutzbare Muster ersetzt. Ziel ist es stets eine bekannte Sehgewohnheiten zu sprengen, um den Blick für Neues zu schärfen. Idealerweise rufen derartige Aktivitäten Reaktionen hervor, fordern zum Meinungstausch auf und eigenen sich daher, Tendenzen allgemeiner Sprachlosigkeit zu überwinden. Sie geben Impulse und schärfen unser Bewusstsein für Probleme. Dabei entstehen Orte kalkulierbarer Ausnahmezustände, resultierender Aufmerksamkeit, gemeinsamer Aktivität, Umwidmung und Revitalisierung, Partizipation und die Möglichkeit zur Simulation neuer Wirklichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Untersuchung
- Recherche
- Haben vs. Sein
- Glücksformel
- Nutzen statt Besitzen
- Forschung
- Interviews
- Ausstellungen
- Selbstversuch
- Umfragen
- Modellbau
- Schlussbetrachtung
- Reflexion
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Frage, ob Besitz glücklich macht. Die Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen Besitz und Glück, indem sie die Existenzweisen des „Habens“ und des „Seins“ sowie verschiedene Konzepte des Konsums und der Glücksfindung beleuchtet. Ziel ist es, einen kritischen Blick auf die Konsumgesellschaft zu werfen und alternative Lebensmodelle aufzuzeigen, die sich weniger am Besitz orientieren.
- Die Auswirkungen des Konsums auf das menschliche Glück
- Die Bedeutung von Besitz in der modernen Gesellschaft
- Alternative Lebensmodelle, die sich vom Besitz lösen
- Der Zusammenhang zwischen Besitz und persönlicher Identität
- Die Rolle der Werbung und des Marketings im Konsumprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einführung stellt die Problemstellung der Seminararbeit vor, die die Frage nach dem Glück durch Besitz untersucht. Sie beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Konsumgütern in der westlichen Welt und die damit verbundenen Auswirkungen auf den menschlichen Lebensstil. Die Arbeit widmet sich der Analyse des Verhältnisses zwischen Besitz und Glück.
Recherche
In diesem Kapitel werden verschiedene Konzepte und Theorien zum Thema „Haben vs. Sein“ beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Existenzweise des Habens und ihre Auswirkungen auf den Gesellschaftscharakter. Sie hinterfragt die Vorstellung von Privateigentum und untersucht alternative Lebensmodelle, die auf Gemeinschaft und Teilen basieren.
Forschung
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Forschungsmethoden, die in der Seminararbeit eingesetzt werden. Die Arbeit beschreibt Interviews, Ausstellungen, Selbstversuche, Umfragen und Modellbau als Instrumente, um die Beziehung zwischen Besitz und Glück zu erforschen. Ziel ist es, durch verschiedene Ansätze neue Erkenntnisse zu gewinnen und die komplexen Zusammenhänge zwischen dem individuellen Besitz und dem gesellschaftlichen Kontext zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Besitz, Glück, Konsum, Haben vs. Sein, Sharing, Lebensmodelle, Identität, Sozialisation, Psychologie, Soziologie, Philosophie, Kunst und Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Macht Besitz glücklich?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Konsumgüter tatsächlich ein erfüllteres Leben versprechen oder ob alternative Lebensmodelle ohne Besitz glücksfördernder sind.
Was bedeutet "Haben vs. Sein"?
Dies sind zwei Existenzweisen: Während "Haben" auf Privateigentum und Konsum basiert, fokussiert "Sein" auf Erleben, Gemeinschaft und persönliche Identität.
Welche Rolle spielt "Sharing" in der Untersuchung?
Es wird beleuchtet, wie "Nutzen statt Besitzen" als Konzept das soziale Miteinander und das individuelle Glücksempfinden in einer Stadt verändern könnte.
Welche Forschungsmethoden wurden verwendet?
Die Untersuchung umfasst Interviews, Selbstversuche, Umfragen, Modellbau und Experimente, um die Realität spielerisch zu wandeln und das Bewusstsein zu schärfen.
Was ist das Ziel des "Gestaltens im Ausnahmezustand"?
Ziel ist es, bekannte Sehgewohnheiten zu sprengen, den Blick für Neues zu schärfen und Tendenzen allgemeiner Sprachlosigkeit über Konsumprobleme zu überwinden.
Was sind die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit?
Besitz, Glück, Konsumgesellschaft, Sharing Economy und Identität.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Macht Besitz glücklich? Eine Untersuchung am Beispiel des Besitzlosen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1133509