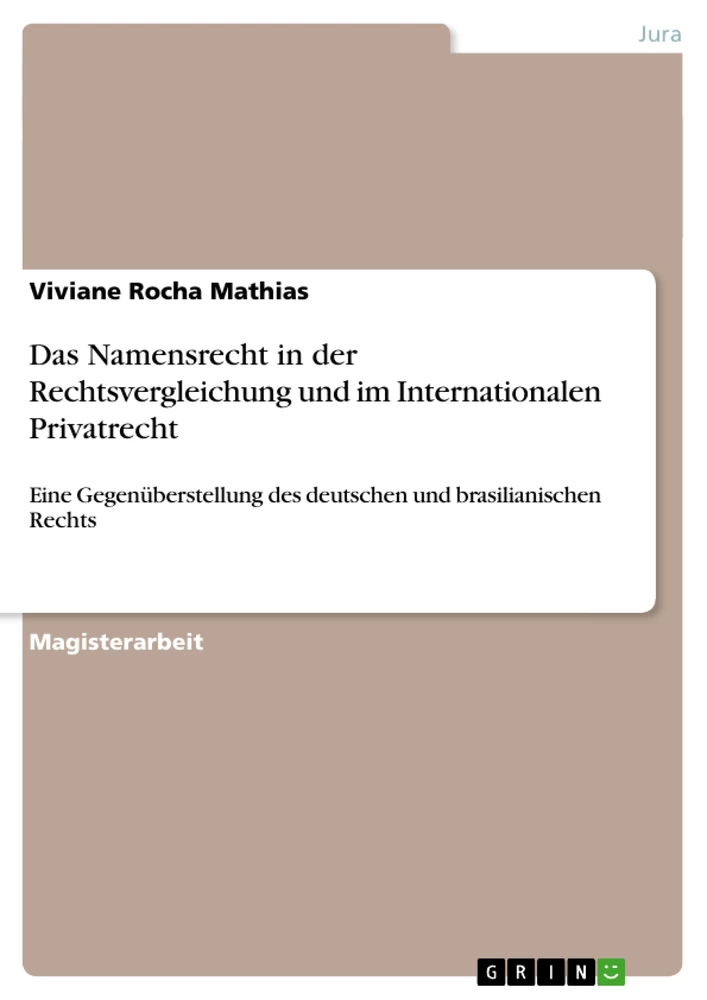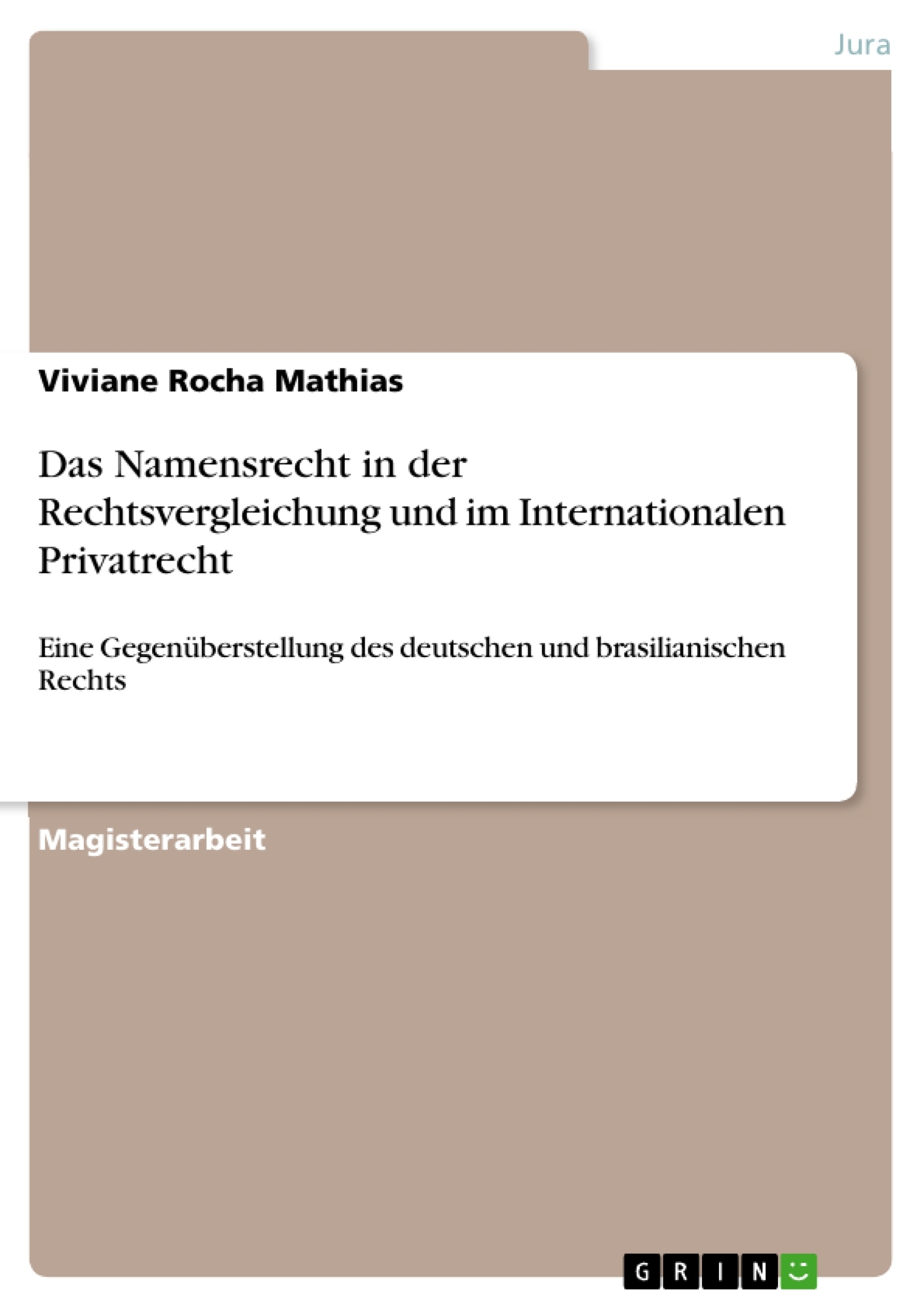Der Name ist ein sprachliches Mittel der Kennzeichnung von natürlichen
und juristischen Personen, um sie im allgemeinen Verkehr und im Rechtsverkehr
von einander zu unterscheiden. Er hat hauptsächlich drei Funktionen: (1) dient
der ständigen Identifizierung (Passwesen) von Personen und Unternehmen, (2)
gehört dem Persönlichkeitsrecht als sein Hauptbestandteil und (3) kennzeichnet
die Familienzugehörigkeit, wobei der Familienname eine wesentliche Rolle spielt.
Darüber hinaus hat jede Person das in der Regel zivilrechtlich verankerte Recht
auf einen eigenen Namen.
Das Namensrecht ist mit der Persönlichkeit des menschlichen Lebens
eng verknüpft, ebenso wie das Recht auf das Leben, die körperliche
Unversehrtheit, die Freiheit, die Achtung der Persönlichkeit oder der Ehre. Die
Bestimmung des Familiennamens über die Generationen hinweg machte also
Vorschriften über den Erwerb des Namens erforderlich. So tauchen in den großen
Kodifikationen, wie z.B. der Aufklärung und dem französischen Code Civil,
erstmals Regelungen auf, die fixierten, welche familienrechtliche Vorgänge zum
Erwerb eines Namens führen sollten. Die Aufnahme der namensrechtlichen
Normen in die Zivilgesetzbücher war eine rechtsgeschichtliche Entwicklung des
Rechts. Zwar bezeichnet der Name immer noch im geltenden Recht ein wahres
und gegen jeden Dritten wirkendes absolutes Privatrecht, jedoch ist er in Ländern wie Brasilien nicht nur zivilrechtlich, sondern auch verfassungsrechtlich verankert.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Das Namensrecht
- Überblick
- Der Ehename
- Der Ehename im deutschen Recht
- Der Ehename im brasilianischen Recht
- Código Civil von 1916
- Código Civil von 2002
- Die Ehescheidung
- Die Ehescheidung nach deutschem Recht
- Die Ehescheidung nach brasilianischem Recht
- Der Kindesname
- Der Kindesname in Deutschland
- Geburtsname bei Eltern mit Ehename
- Geburtsname bei Eltern ohne Ehename
- Kindesname bei Adoption
- Die Familiennamen des Kindes nach der Scheidung der Eltern
- Der Kindesname in Brasilien
- Kindesname bei Adoption
- Der Kindesname in Deutschland
- Die Namensänderung
- Die Namensänderung im deutschen Recht
- Einbenennung
- Die Namensänderung im brasilianischen Recht
- Namensänderung wegen offenkundigen Schreibirrtum
- Ersatz des Vornamens für weithin bekannte Spitznamen
- Homonymheit
- Übersetzung
- Opfer und Zeuge
- Geschlechtsänderung
- Die Namensänderung im deutschen Recht
- Kapitel 2: Internationales Privatrecht in Bezug auf Namensrecht
- Namensrecht nach brasilianischem und deutschem Internationalen Privatrecht
- Einführung
- Namensstatuts: Anwendungsbereich
- Personalstatut
- Staatsangehörigkeit und Wohnsitz
- Rück- und Weiterverweisung
- Allgemeine Definition von Verweisung
- Renvoi au premier degré et au second degré
- Die Verweisung im Internationalen Privatrecht Brasiliens
- Qualifikation des Namensrechts
- Angleichung
- Praktische Fälle
- Ehename
- Kindesname
- Namensrecht nach brasilianischem und deutschem Internationalen Privatrecht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit verfolgt das Ziel, das Namensrecht im deutschen und brasilianischen Recht zu vergleichen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Gegenüberstellung der jeweiligen Rechtsordnungen im nationalen Recht und im Internationalen Privatrecht. Die Arbeit analysiert die Regelungen zum Ehenamen, Kindesnamen und zur Namensänderung in beiden Ländern.
- Vergleich des deutschen und brasilianischen Namensrechts
- Analyse des Ehenamensrechts in beiden Ländern
- Untersuchung der Regelungen zum Kindesnamen
- Bewertung der Möglichkeiten der Namensänderung
- Anwendung des Internationalen Privatrechts auf Namensrechtsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Das Namensrecht: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Namensrecht in Deutschland und Brasilien. Es analysiert detailliert die Rechtslage bezüglich des Ehenamens, wobei die Entwicklungen im brasilianischen Recht, insbesondere durch die neuen Código Civil von 2002, im Vergleich zum deutschen Recht herausgearbeitet werden. Die Regelungen zur Namensführung nach der Ehescheidung werden ebenfalls eingehend beleuchtet und verglichen. Des Weiteren befasst sich das Kapitel mit dem Kindesnamen und den jeweiligen Bestimmungen in beiden Ländern, unter Berücksichtigung von Adoptionen und Scheidungen. Abschließend wird die Problematik der Namensänderung in beiden Rechtssystemen analysiert, einschließlich der verschiedenen Gründe und Möglichkeiten einer solchen Änderung. Die verschiedenen Regelungen werden prägnant gegenübergestellt und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen diskutiert.
Kapitel 2: Internationales Privatrecht in Bezug auf Namensrecht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Anwendung des Internationalen Privatrechts auf Namensrechtsfragen im Kontext des deutschen und brasilianischen Rechts. Es erklärt die zentralen Konzepte des Namensstatuts und des Personalstatuts, inklusive der Rolle von Staatsangehörigkeit und Wohnsitz. Der komplexe Aspekt der Rück- und Weiterverweisung (Renvoi) wird ausführlich erläutert, wobei die jeweiligen Ansätze in Brasilien und Deutschland verglichen werden. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Methoden der Qualifikation des Namensrechts und diskutiert die Herausforderungen der Rechtsangleichung in diesem Bereich. Schließlich werden praktische Fälle zur Namensführung im internationalen Kontext analysiert, die die komplexen Interaktionen zwischen nationalem und internationalem Recht verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Namensrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht, Deutschland, Brasilien, Ehename, Kindesname, Namensänderung, Código Civil, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Rückverweisung, Renvoi, Qualifikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Namensrecht im deutschen und brasilianischen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit befasst sich mit einem detaillierten Vergleich des Namensrechts in Deutschland und Brasilien. Sie untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Rechtsordnungen auf nationaler und internationalprivatrechtlicher Ebene. Der Fokus liegt auf den Regelungen zum Ehenamen, Kindesnamen und der Namensänderung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Vergleich des deutschen und brasilianischen Namensrechts, Analyse des Ehenamensrechts in beiden Ländern, Untersuchung der Regelungen zum Kindesnamen (inkl. Adoption und Scheidung), Bewertung der Möglichkeiten der Namensänderung, Anwendung des Internationalen Privatrechts auf Namensrechtsfragen (inkl. Namensstatut, Personalstatut, Rück- und Weiterverweisung (Renvoi), Qualifikation und Rechtsangleichung).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus zwei Kapiteln. Kapitel 1 befasst sich umfassend mit dem nationalen Namensrecht in Deutschland und Brasilien, analysiert detailliert Ehenamen (inkl. Entwicklung im brasilianischen Recht durch den neuen Código Civil von 2002), Kindesnamen (inkl. Adoption und Scheidung) und Namensänderung. Kapitel 2 konzentriert sich auf das Internationale Privatrecht im Kontext des Namensrechts, beleuchtet Konzepte wie Namensstatut, Personalstatut, Rück- und Weiterverweisung (Renvoi), Qualifikation und Rechtsangleichung und analysiert praktische Fälle.
Wie werden die Unterschiede im Namensrecht zwischen Deutschland und Brasilien dargestellt?
Die Arbeit stellt die Unterschiede im Namensrecht zwischen Deutschland und Brasilien durch einen detaillierten Vergleich der jeweiligen Rechtsvorschriften dar. Sie analysiert die spezifischen Regelungen für Ehenamen, Kindesnamen und Namensänderungen in beiden Ländern und hebt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor. Besondere Berücksichtigung findet dabei die Entwicklung des brasilianischen Rechts, insbesondere durch den neuen Código Civil von 2002.
Welche Rolle spielt das Internationale Privatrecht?
Das Internationale Privatrecht spielt eine entscheidende Rolle bei der Klärung von Namensrechtsfragen mit internationalem Bezug. Die Arbeit analysiert die Anwendung des Internationalen Privatrechts in Deutschland und Brasilien, insbesondere die Konzepte des Namensstatuts und Personalstatuts, sowie die komplexen Aspekte der Rück- und Weiterverweisung (Renvoi). Es werden die Herausforderungen der Rechtsangleichung im Bereich des Namensrechts diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Namensrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht, Deutschland, Brasilien, Ehename, Kindesname, Namensänderung, Código Civil, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Rückverweisung, Renvoi, Qualifikation.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die wichtigsten Erkenntnisse und Argumentationslinien jedes Kapitels prägnant zusammenfasst.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für einen Vergleich des deutschen und brasilianischen Namensrechts interessieren, insbesondere im Kontext des Internationalen Privatrechts. Sie ist relevant für Juristen, Wissenschaftler und alle, die sich mit dem Thema Namensrecht auseinandersetzen.
- Quote paper
- Viviane Rocha Mathias (Author), 2008, Das Namensrecht in der Rechtsvergleichung und im Internationalen Privatrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113336