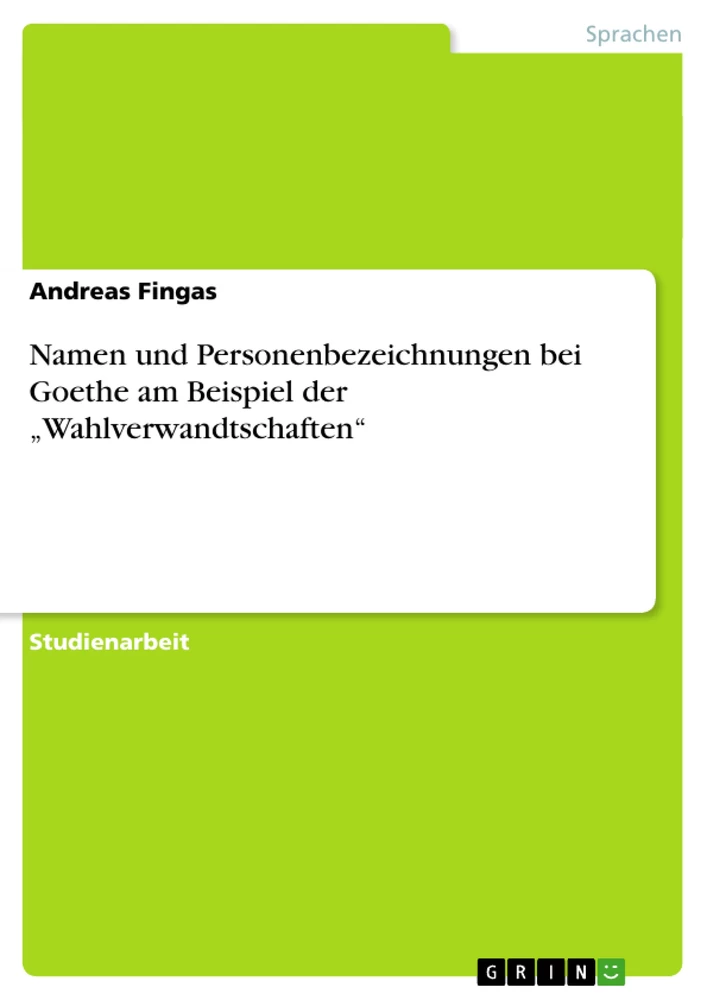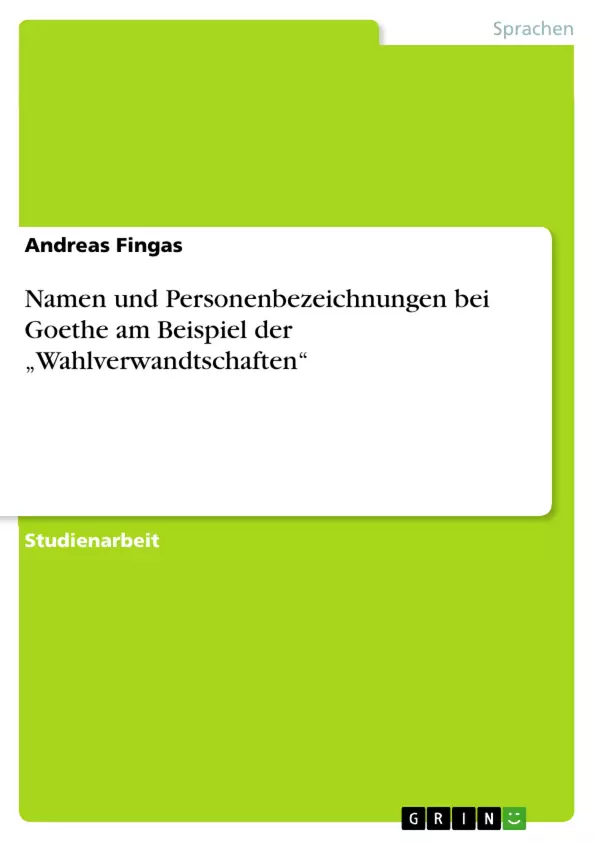„The name of a man is like his shadow. It is not of his substance and not of his soul, but it
lives with him and by him“. Mit diesem Satz umreißt Ernst Pulgram das Wesen des Namens.
Was mit dem Begriff “Name” alles verbunden ist, welche Worte als “Name” gelten und wie
weit sein Bedeutungsfeld ist, soll im folgenden noch weiter ausgeführt werden. Neben einer
unverkennbaren Bedeutung der Eigennamen für real existierende Personen, ist der Name für
die Literatur auch ein entscheidendes Gestaltungselement. Durch die Analyse und
Kategorisierung von Figurennamen hat sich eine eigene Forschungsrichtung, die literarische
Onomastik entwickelt, welche einen weiteren Zugang zur interpretatorischen Arbeit mit
literarischen Werken eröffnet. Welcher Werkzeuge sich die literarische Onomastik bedient
und wie sich diese auf das Werk Johann Wolfgang von Goethes – insbesondere auf die
Wahlverwandtschaften – anwenden lassen, damit befasst sich die vorliegende Arbeit. Friedhelm Debus beschreibt die Bedeutung des Eigennamens besonders deutlich: “Mit dem
Namen hat es eine besondere Bewandtnis. Die Klasse der Personennamen zeigt es am
auffälligsten. Sie ist es zudem, die jeden ganz unmittelbar betrifft; denn jede Person trägt
einen Namen – Ihren Namen, ihren eigenen Namen. Namen sind in sofern Eigennamen, auch
dann, wenn derselbe Name verschiedene Individuen benennt.“ Zusätzlich zu der Tragweite
von Eigennamen und Personenamen werden den Namen literarischer Figuren, Orte und
Objekte allerdings noch weitere Bedeutungs-Ebenen zugeschrieben. Debus zitiert in seiner
Veröffentlichung Namen in literarischen Werken: (Er-)Findung – Form – Funktion Pavel
Trost, welcher die „poetische, oder ästhetische“ Funktion literarischer Namen als Zusatz
anführt. Anders formuliert bedeutet das, dass Autoren ihren Figuren Namen geben, ebenso
wie Eltern ihren Kindern, nur weiß ein Autor bereits um die einzelnen Wesenszüge seiner
Schöpfung und passt den Namen entsprechend an. Obwohl Schriftsteller bereits seit der
Antike auf eine solche Weise vorgingen, nahm die Forschungsrichtung der literarischen Onomasitk erst in 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Platz neben der traditionell
betriebenen Stilistik ein. Sie versucht die Systematik zu erkunden, mit der Autoren die
Namen ihrer Figuren, Handlungsorte und Objekte wählen. Dazu bedient sie sich einer eigenen
Nomenklatur.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aspekte der literarischen Onomastik
- 2.1 Der Name - Eine Begriffsklärung
- 2.2 Die 12 Grundgesetze zum Wesen des Namens nach St. Sondegger
- 2.3 Der literarische Name
- 2.3.1 Klassifizierung literarischer Namen nach H. Birus
- 2.3.2 Funktionstypologie literarischer Namen nach Dieter Lamping
- 3. Namenbedeutung in Goethes „Wahlverwandtschaften“
- 3.1 Funktionelle Eigenheiten der Namen
- 3.2 Die Namen der Hauptfiguren und ihre Systematik
- 4. Zusammenfassung
- 5. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Namen und Personenbezeichnungen im Werk Johann Wolfgang von Goethes, insbesondere in den „Wahlverwandtschaften“. Die Zielsetzung besteht darin, die Methoden der literarischen Onomastik zu erläutern und deren Anwendung auf Goethes Werk zu demonstrieren. Die Analyse fokussiert auf die funktionellen Eigenheiten von Namen und deren Systematik innerhalb des Romans.
- Begriffsklärung des Namens und dessen Bedeutung in der Literatur
- Die 12 Grundgesetze des Namens nach Sondegger und ihre Relevanz für literarische Namen
- Klassifizierung und Funktionstypologie literarischer Namen
- Analyse der Namen in Goethes „Wahlverwandtschaften“ und deren Funktion
- Systematik der Namen der Hauptfiguren in den „Wahlverwandtschaften“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Namen und Personenbezeichnungen in der Literatur ein und beschreibt die Bedeutung des Namens als literarisches Gestaltungselement. Sie führt den Begriff der literarischen Onomastik ein und skizziert den Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit, der sich mit der Anwendung onomastischer Methoden auf Goethes „Wahlverwandtschaften“ befasst. Der zentrale Punkt ist die Verbindung zwischen Namen und der interpretatorischen Arbeit an literarischen Werken.
2. Aspekte der literarischen Onomastik: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Eigennamens in der Literatur und erklärt die Entwicklung der literarischen Onomastik als Forschungsrichtung. Es differenziert den Begriff „Name“ und beschreibt die 12 Grundgesetze des Namens nach Sondegger. Diese Gesetze bilden ein wichtiges Fundament für die Analyse der Namensgebung in literarischen Werken. Weiterhin werden verschiedene Klassifizierungen und Funktionstypologien literarischer Namen vorgestellt, die für die spätere Analyse der „Wahlverwandtschaften“ relevant sind. Die Unterscheidung zwischen gefundenen und erfundenen Namen wird diskutiert und ihr Einfluss auf die Interpretation beleuchtet.
3. Namenbedeutung in Goethes „Wahlverwandtschaften“: Dieses Kapitel analysiert die Namen in Goethes „Wahlverwandtschaften“. Es untersucht die funktionellen Eigenheiten der Namen und deren Systematik, um ihren Beitrag zur Gesamtkomposition und Interpretation des Romans aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf die Hauptfiguren und ihre Namen, wobei die Beziehungen zwischen den Namen und den Charakteren der Figuren erörtert werden. Die Kapitel beleuchtet wie die Namen zur Charakterisierung, zum Aufbau von Beziehungen zwischen den Figuren und zur Entwicklung der Handlung beitragen.
Schlüsselwörter
Literarische Onomastik, Namenbedeutung, Personenbezeichnungen, Goethe, Wahlverwandtschaften, Eigenname, Appellativum, Namensgebung, Figurennamen, Interpretation, Systematik.
Häufig gestellte Fragen zu „Namenbedeutung in Goethes Wahlverwandtschaften“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Bedeutung von Namen und Personenbezeichnungen in Goethes „Wahlverwandtschaften“. Sie untersucht die Methoden der literarischen Onomastik und deren Anwendung auf das Werk Goethes. Der Fokus liegt auf der funktionalen Eigenheit der Namen und deren Systematik innerhalb des Romans.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffsklärung des Namens und dessen Bedeutung in der Literatur; die 12 Grundgesetze des Namens nach Sondegger und ihre Relevanz für literarische Namen; Klassifizierung und Funktionstypologie literarischer Namen; Analyse der Namen in Goethes „Wahlverwandtschaften“ und deren Funktion; und die Systematik der Namen der Hauptfiguren in den „Wahlverwandtschaften“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Aspekte der literarischen Onomastik, 3. Namenbedeutung in Goethes „Wahlverwandtschaften“, 4. Zusammenfassung und 5. Quellenverzeichnis. Kapitel 2 erläutert die literarische Onomastik, inklusive der 12 Grundgesetze von Sondegger und verschiedener Klassifizierungssysteme. Kapitel 3 analysiert die Namen in Goethes „Wahlverwandtschaften“, fokussiert auf Hauptfiguren und deren Beziehungen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit wendet Methoden der literarischen Onomastik an, um die Namen in Goethes „Wahlverwandtschaften“ zu analysieren. Dies beinhaltet die Untersuchung der funktionalen Eigenheiten der Namen, ihre Systematik und ihren Beitrag zur Gesamtkomposition und Interpretation des Romans.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Literarische Onomastik, Namenbedeutung, Personenbezeichnungen, Goethe, Wahlverwandtschaften, Eigenname, Appellativum, Namensgebung, Figurennamen, Interpretation, Systematik.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die Methoden der literarischen Onomastik zu erläutern und deren Anwendung auf Goethes Werk zu demonstrieren. Die Arbeit analysiert die funktionellen Eigenheiten von Namen und deren Systematik innerhalb des Romans „Wahlverwandtschaften“.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für literarische Analyse, die Bedeutung von Namen in der Literatur und die Anwendung onomastischer Methoden interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Germanistik und Literaturwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Andreas Fingas (Autor:in), 2006, Namen und Personenbezeichnungen bei Goethe am Beispiel der „Wahlverwandtschaften“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113112