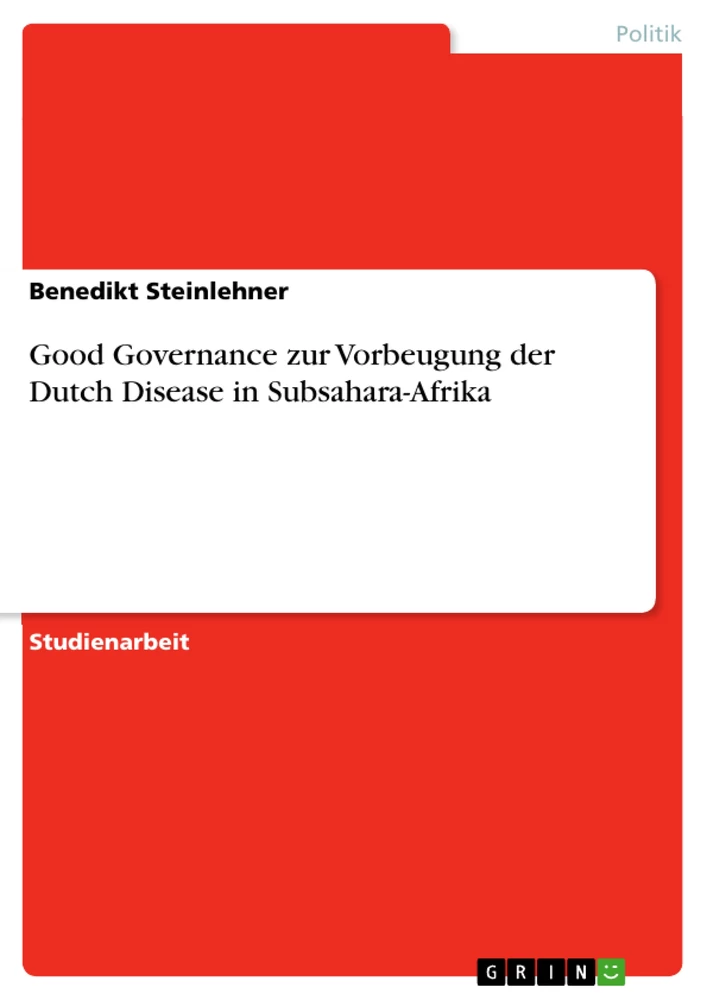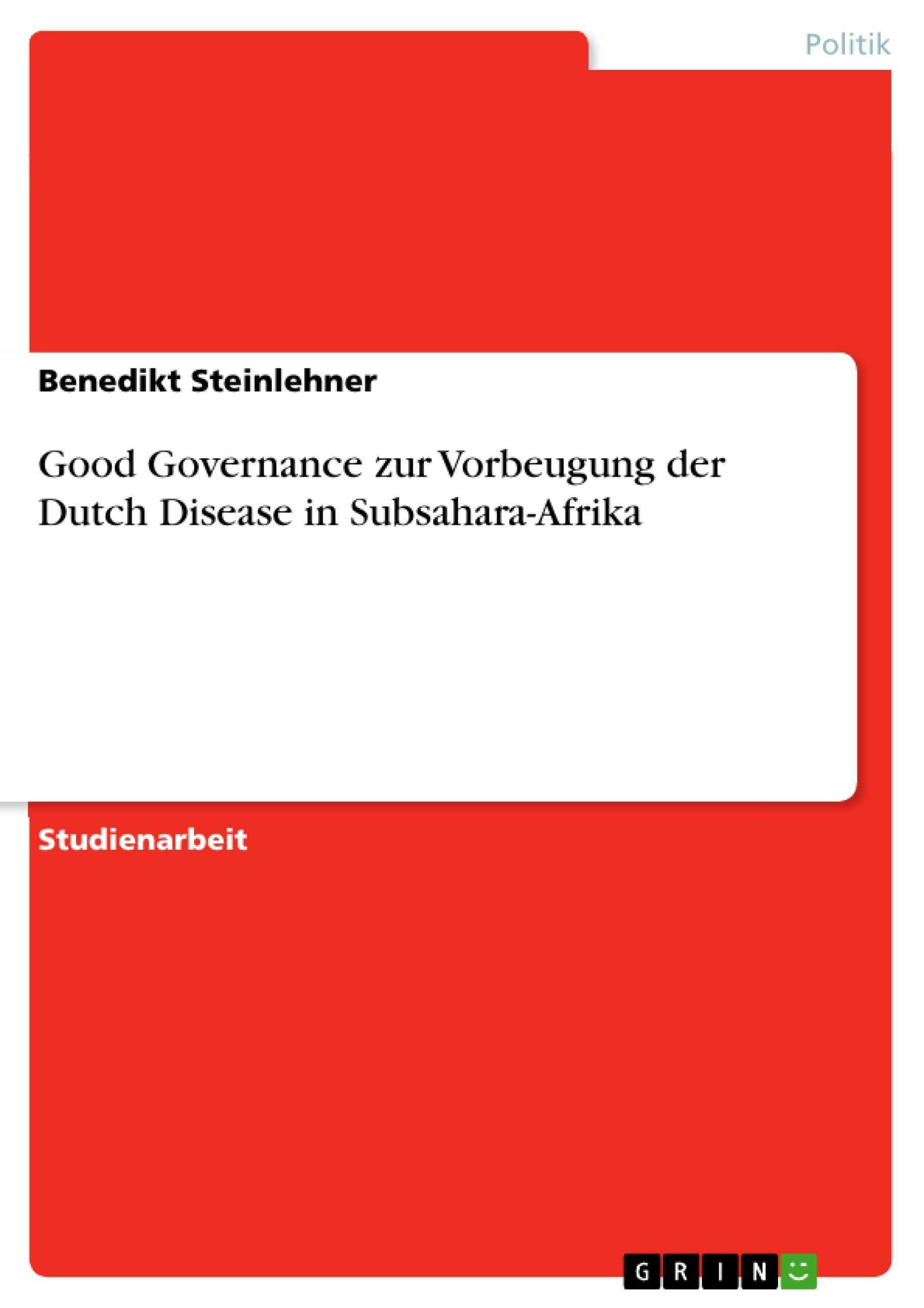Ein reichhaltiges Vorkommen an natürlichen Ressourcen stellt sowohl für die gesamtgesellschaftliche Ökonomie eines Landes als auch für den einzelnen dort lebenden Bürger einen Segen dar – sollte man meinen. In Wahrheit handelt es sich bei nationalem Ressourcenreichtum um Fluch und Segen zugleich. "Ausgerechnet in jenen Staaten, die gewaltige Vorkommen an Öl, Gas oder Edelmetallen besitzen, herrschen Armut, Korruption und Misswirtschaft. Ginge es den Menschen in Nigeria, im Kongo oder in Russland ohne Rohstoffe besser?". In der Tat handelt es sich hierbei nach wie vor um ein nicht gänzlich gelöstes, politikwissenschaftliches Rätsel. Warum gelingt es etwa einem Land wie Norwegen in hohem Maße von seinem nationalen Rohstoffreichtum zu profitieren, während in anderen rohstoffreichen Ländern – insbesondere in vielen afrikanischen Ländern südlich der Sahara – bittere Armut in weiten Teilen der Bevölkerung vorherrscht?
Im Kern mit dieser Problematik - den wirtschaftlichen und damit einhergehenden oftmals auch sozialen und politischen Problemen, wie sie gehäuft gerade in den rohstoffreichen afrikanischen Ländern südlich der Sahara auftreten – soll sich diese Arbeit beschäftigen und darstellen, warum diese Probleme keine zwingende Folge des Rohstoffreichtums sein müssen, sondern warum diese durch eine entwicklungskonforme Regierungsführung ("Good Governance") vermieden werden können. Im Detail wird dabei insbesondere eine Ausprägung des Ressourcenfluches betrachtet werden, und zwar die "Dutch Disease". Die herrschende Meinung in den Sozialwissenschaften geht aktuell davon aus, dass sich insbesondere politische Ansätze zur Erklärung des "Fluchs" der Ressourcen eignen und erst nachfolgend wirtschaftliche, da "politics matter". Betrachtet werden hier somit insbesondere die Auswirkungen unterschiedlicher Ausprägungen der Regierungsführung „Governance“ auf das Auftreten einer "Dutch Disease".
Inhaltsverzeichnis
- Einführung, Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit.
- Hauptteil
- Theoretische Grundlagen, Begriffe und Hypothesen
- Theoretischer Rahmen und Konzeptspezifikation
- Hypothesen.......
- Analyseverfahren, Datengrundlage und Operationalisierung der Variablen .....
- Analyseverfahren.
- Datengrundlage
- Abhängige Variable ......
- Unabhängige Variablen
- Operationalisierung.........
- Empirische Analysen und Hypothesenprüfung.....
- Univariate Analyse.
- Bivariate Zusammenhangsanalysen.........
- Multivariate Analyse, Ergebnisse und Prüfung der Hypothesen.
- Zusammenfassung der Ergebnisse, Fazit und Ausblick....
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen „Good Governance“ und der „Dutch Disease“ in rohstoffreichen Ländern Subsahara-Afrikas. Sie zielt darauf ab, zu klären, warum eine effiziente Regierungsführung eine wirksame Abwehr gegen die „Dutch Disease“ darstellt. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den Auswirkungen unterschiedlicher Regierungsformen auf das Auftreten der „Dutch Disease“ und analysiert, wie politische Ansätze zur Erklärung des Ressourcenfluchs beitragen können.
- Die Bedeutung von „Good Governance“ als Schutzfaktor gegen die „Dutch Disease“
- Die Analyse der Auswirkungen unterschiedlicher Regierungsformen auf die „Dutch Disease“
- Die Rolle des Rohstoffreichtums und die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft
- Die Herausforderungen der Ressourcenwirtschaft und die Suche nach nachhaltigen Entwicklungspfaden
- Die politische Relevanz der Forschungsergebnisse für Entwicklungspolitik und -strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Forschungsfrage eingeführt und der Aufbau der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen des Ressourcenreichtums und der „Dutch Disease“ sowie deren Auswirkungen auf die Entwicklung rohstoffreicher Länder Subsahara-Afrikas. Kapitel zwei beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit und stellt die zentralen Begriffe wie „Good Governance“, „Dutch Disease“ und „Ressourcenfluch“ vor. Darüber hinaus werden Hypothesen zur Beziehung zwischen „Good Governance“ und der „Dutch Disease“ aufgestellt. Im dritten Kapitel werden die empirischen Analysen der Arbeit präsentiert, wobei die einzelnen Variablen zunächst univariate und anschließend bivariate und multivariate analysiert werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie „Good Governance“, „Dutch Disease“, „Ressourcenfluch“ und „Rohstoffreichtum“. Im Fokus stehen die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen sowie deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung rohstoffreicher Länder Subsahara-Afrikas. Dabei wird besonders die Relevanz von „Good Governance“ als Schutzfaktor gegen die „Dutch Disease“ herausgestellt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "Dutch Disease" (Holländische Krankheit)?
Die Dutch Disease beschreibt ein wirtschaftliches Phänomen, bei dem der Rohstoffreichtum eines Landes (z. B. Öl) zu einer Aufwertung der Währung führt, was andere Wirtschaftssektoren (wie die Industrie) schwächt und langfristig Wachstum schadet.
Warum wird Rohstoffreichtum oft als "Fluch" bezeichnet?
In vielen Ländern führt großer Ressourcenreichtum nicht zu Wohlstand, sondern zu Korruption, Armut und Misswirtschaft, da der Staat von Rohstoffeinnahmen statt von Steuern lebt und die Bevölkerung vernachlässigt.
Wie kann "Good Governance" die Dutch Disease verhindern?
Durch eine transparente, effiziente und entwicklungskonforme Regierungsführung können Einnahmen nachhaltig investiert und wirtschaftliche Verzerrungen durch kluge politische Steuerung abgemildert werden.
Warum profitieren Länder wie Norwegen vom Öl, viele afrikanische Staaten aber nicht?
Der Unterschied liegt in der Regierungsführung ("Governance"). Norwegen verfügt über starke Institutionen und Transparenz, während in vielen rohstoffreichen Ländern Subsahara-Afrikas schwache Strukturen den Ressourcenfluch begünstigen.
Welchen Fokus hat die empirische Analyse dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht mittels univariater, bivariater und multivariater Analysen, wie verschiedene Ausprägungen der Regierungsführung das Auftreten der Dutch Disease in Subsahara-Afrika beeinflussen.
Was bedeutet der Satz "politics matter" in diesem Zusammenhang?
Er drückt aus, dass der Ressourcenfluch kein rein wirtschaftliches Schicksal ist, sondern primär durch politische Entscheidungen und die Qualität der Institutionen bestimmt wird.
- Citar trabajo
- Benedikt Steinlehner (Autor), 2021, Good Governance zur Vorbeugung der Dutch Disease in Subsahara-Afrika, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1130626