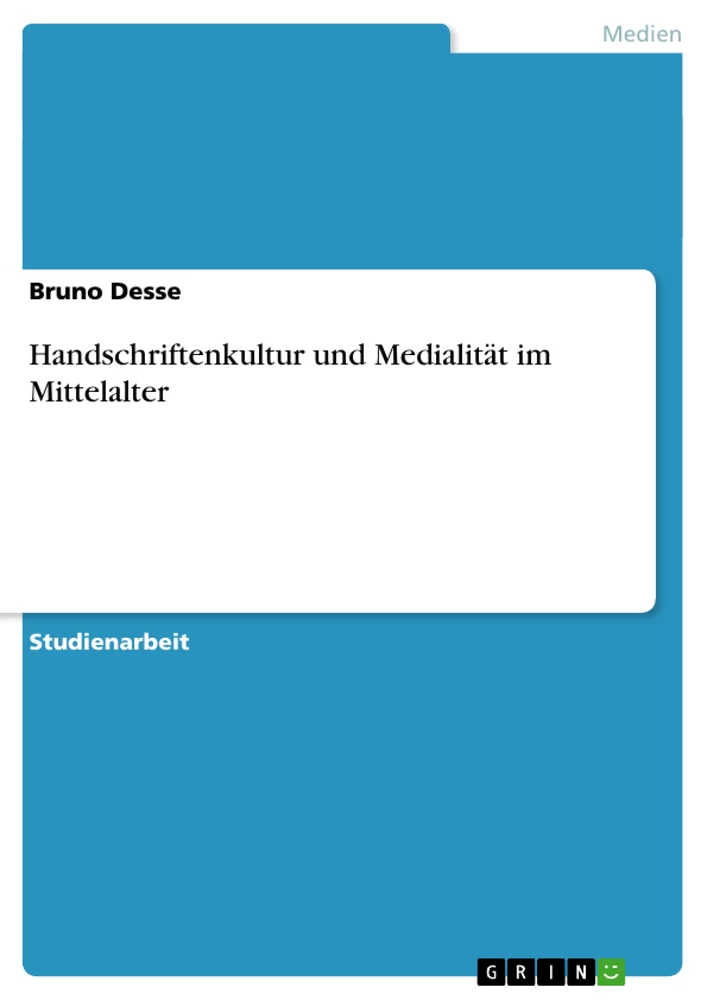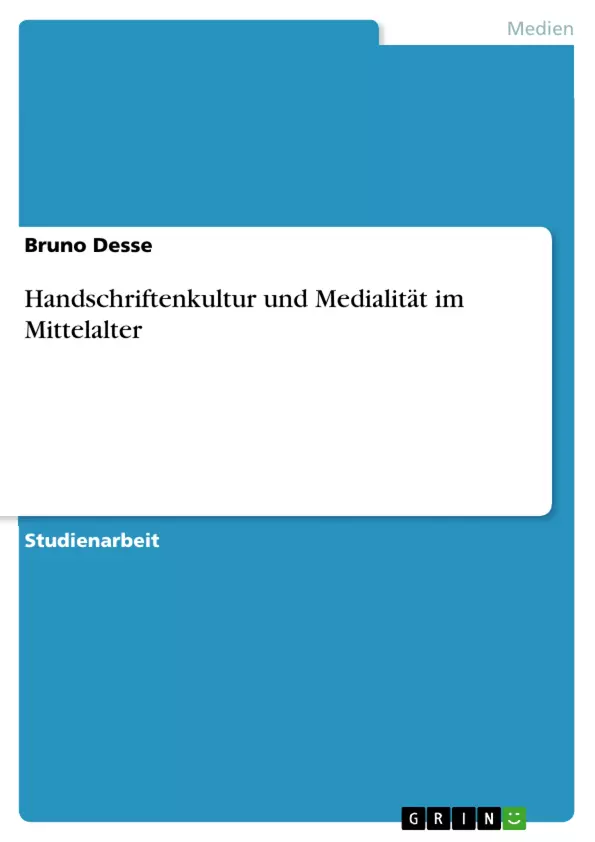Der Handschrift als mediengeschichtlich einzigartigem Phänomen soll hier der Fokus gewidmet werden. Dabei werden Überschneidungen und Querverweise zu anderen Medien des Mittelalters natürlich nicht zu vermeiden sein. Auch die gesellschaftliche Konstellation, die mit ihren meist sehr sauber voneinander getrennten Binnenöffentlichkeiten völlig anders aussieht als heute, wird Beachtung finden müssen. Doch soll die Entstehungsgeschichte, die technische wie kulturelle Verfügbarkeit, sowie die Rolle der Handschrift als gleichsam riesiges, höchst flexibles Scharnier am Scheideweg zwischen Keilschrift und Mnemotechnik auf der einen, sowie Buchdruck und Telekommunikation auf der anderen Seite im Mittelpunkt stehen. Man sollte dabei nicht vergessen, dass die Handschrift im Mittelalter fast ausschließlich das Buch bedeutete. Handschriften waren Bücher. Wie mit diesem Medium umgegangen wurde, ist schon allein deshalb zentral; die Bedeutung des Buches als solches ist unbestreitbar, historisch ohnehin, aber auch noch in unserem heutigen Zeitalter. Ein kurzer Ausblick, wie die Handschrift noch heute genutzt wird, soll die Ergebnisse abrunden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Medien im Mittelalter
- Binnenöffentlichkeiten
- Menschmedien, Schriftmedien und mediale Funktionen
- Die mittelalterliche Handschrift
- Technische Implikationen
- Kulturelle Implikationen
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Medienwandel im Mittelalter, insbesondere die Rolle der Handschrift als Scharnier zwischen mündlicher und schriftlicher Kultur. Sie beleuchtet die spezifischen Kommunikationsformen des Mittelalters, die Bedeutung von „Menschmedien“, und den Übergang zu einer stärker schriftbasierten Gesellschaft.
- Medienbegriff im Mittelalter und seine Besonderheiten
- Die Bedeutung von Binnenöffentlichkeiten und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation
- Die Funktion von „Menschmedien“ im Vergleich zu Schriftmedien
- Die mittelalterliche Handschrift als technologisches und kulturelles Phänomen
- Der Wandel von der Oralität zur Schriftkultur
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Schwierigkeiten bei der Betrachtung mittelalterlicher Medien aus heutiger Perspektive. Es betont die Notwendigkeit, von den gewohnten Prämissen abzuweichen und den Fokus auf den Medienwandel zu legen, der durch die mittelalterliche Handschrift repräsentiert wird. Der Text kündigt die zentrale Rolle der Handschrift als „riesiges, höchst flexibles Scharnier“ an und hebt deren Bedeutung für die Entwicklung der Kommunikationsmedien hervor.
Medien im Mittelalter: Dieses Kapitel analysiert die mittelalterliche Kommunikation, die primär personal stattfindet, aber dennoch mediale Aspekte aufweist. Es betont die Notwendigkeit, den Medienbegriff im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft mit ihren drei Ständen (oratores, bellatores, laboratores) und ihren klar abgegrenzten Binnenöffentlichkeiten zu betrachten. Das Kapitel differenziert zwischen höfischen Rollen mit medialer Vermittlungsfunktion und genuinen Medien mit strukturell-konstitutiver Wirkung. Es wird auf die Rolle der Oralität eingegangen und der Unterschied zwischen höfischer und bäuerlicher Kommunikation herausgearbeitet.
Binnenöffentlichkeiten: Dieser Abschnitt untersucht die stark segmentierte Struktur der mittelalterlichen Gesellschaft. Die klar voneinander getrennten Teilöffentlichkeiten (Hof, Kloster, Amtskirche, Land) werden analysiert und ihre spezifischen Kommunikationsmuster beleuchtet. Das Spannungsverhältnis zwischen weltlicher und kirchlicher Herrschaft, sowie der Einfluss der Klöster und ihrer Skriptorien, wird dargelegt. Der Text argumentiert, dass sich die medialen Entwicklungen primär in Hof und Kirche vollzogen haben und im Buchdruck kulminierten.
Menschmedien, Schriftmedien und mediale Funktionen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Funktion von „Menschmedien“ in der mittelalterlichen Gesellschaft. Es analysiert höfische Rollen als komplexe Gefüge aus Repräsentation, Performanz und Partizipation und deren Bedeutung für die Kommunikation und Wissensvermittlung. Der Text beschreibt die mittelalterliche Rezeption als synästhetische Wahrnehmung, im Gegensatz zur intellektuellen Durchdringung heutiger Medienrezeption. Es wird der Übergang zu Schriftmedien und deren zunehmende Dominanz erläutert.
Schlüsselwörter
Mittelalter, Medien, Kommunikation, Oralität, Schriftlichkeit, Handschrift, Binnenöffentlichkeiten, Menschmedien, Schriftmedien, Medienwandel, höfische Kultur, Kirche, Kloster, Buchdruck.
Häufig gestellte Fragen zu: Medienwandel im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Medienwandel im Mittelalter, insbesondere die Rolle der Handschrift als Übergang zwischen mündlicher und schriftlicher Kultur. Sie beleuchtet die Kommunikationsformen des Mittelalters, die Bedeutung von „Menschmedien“, und den Übergang zu einer stärker schriftbasierten Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den mittelalterlichen Medienbegriff und seine Besonderheiten, die Bedeutung von Binnenöffentlichkeiten und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation, die Funktion von „Menschmedien“ im Vergleich zu Schriftmedien, die mittelalterliche Handschrift als technologisches und kulturelles Phänomen und den Wandel von der Oralität zur Schriftkultur.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort, ein Kapitel über Medien im Mittelalter (mit Unterkapiteln zu Binnenöffentlichkeiten und Menschmedien/Schriftmedien), ein Kapitel über die mittelalterliche Handschrift (mit Unterkapiteln zu technischen und kulturellen Implikationen) und ein Nachwort. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Was ist das zentrale Argument des Vorworts?
Das Vorwort betont die Schwierigkeiten, mittelalterliche Medien aus heutiger Sicht zu betrachten und die Notwendigkeit, von gewohnten Prämissen abzuweichen. Es hebt die zentrale Rolle der Handschrift als "riesiges, höchst flexibles Scharnier" für die Entwicklung der Kommunikationsmedien hervor.
Wie wird der Medienbegriff im Mittelalter definiert?
Der Medienbegriff wird im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft mit ihren drei Ständen (oratores, bellatores, laboratores) und ihren klar abgegrenzten Binnenöffentlichkeiten betrachtet. Die Arbeit differenziert zwischen höfischen Rollen mit medialer Vermittlungsfunktion und genuinen Medien mit strukturell-konstitutiver Wirkung.
Welche Rolle spielen Binnenöffentlichkeiten?
Die stark segmentierte Struktur der mittelalterlichen Gesellschaft mit klar voneinander getrennten Teilöffentlichkeiten (Hof, Kloster, Amtskirche, Land) und ihren spezifischen Kommunikationsmustern wird analysiert. Das Spannungsverhältnis zwischen weltlicher und kirchlicher Herrschaft und der Einfluss der Klöster und ihrer Skriptorien werden beleuchtet.
Was sind "Menschmedien"?
„Menschmedien“ beschreibt höfische Rollen als komplexe Gefüge aus Repräsentation, Performanz und Partizipation und deren Bedeutung für die Kommunikation und Wissensvermittlung. Der Text vergleicht die mittelalterliche synästhetische Rezeption mit der intellektuellen Durchdringung heutiger Medienrezeption.
Welche Bedeutung hat die Handschrift?
Die mittelalterliche Handschrift wird als technologisches und kulturelles Phänomen betrachtet, das den Übergang von der Oralität zur Schriftkultur repräsentiert. Die Arbeit untersucht sowohl die technischen als auch die kulturellen Implikationen der Handschrift.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Mittelalter, Medien, Kommunikation, Oralität, Schriftlichkeit, Handschrift, Binnenöffentlichkeiten, Menschmedien, Schriftmedien, Medienwandel, höfische Kultur, Kirche, Kloster und Buchdruck.
- Quote paper
- Bruno Desse (Author), 2008, Handschriftenkultur und Medialität im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112874