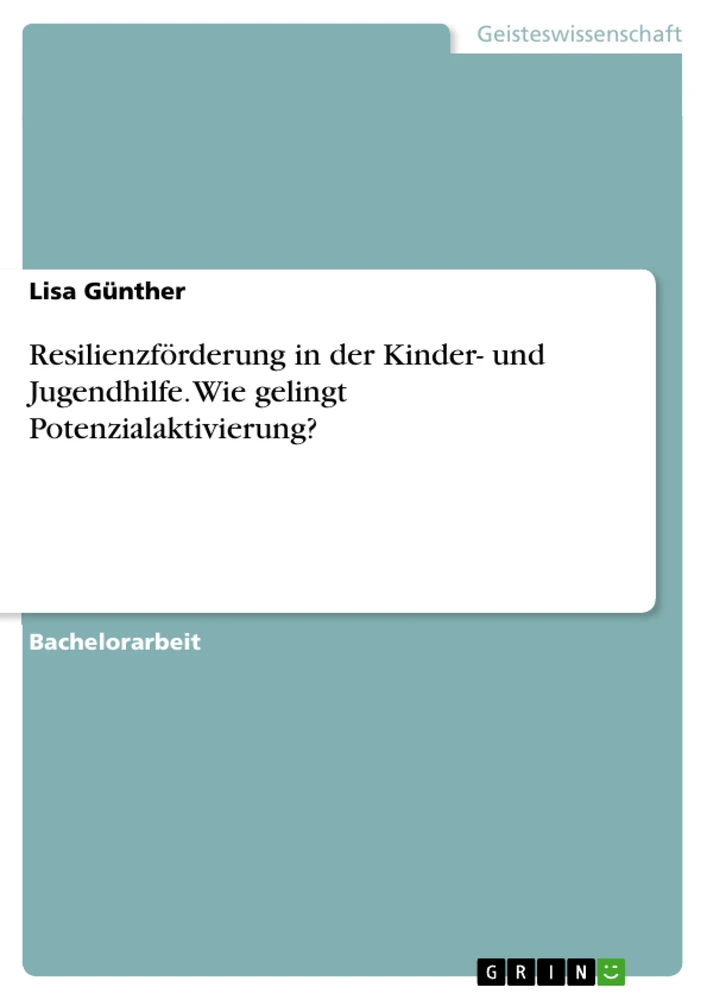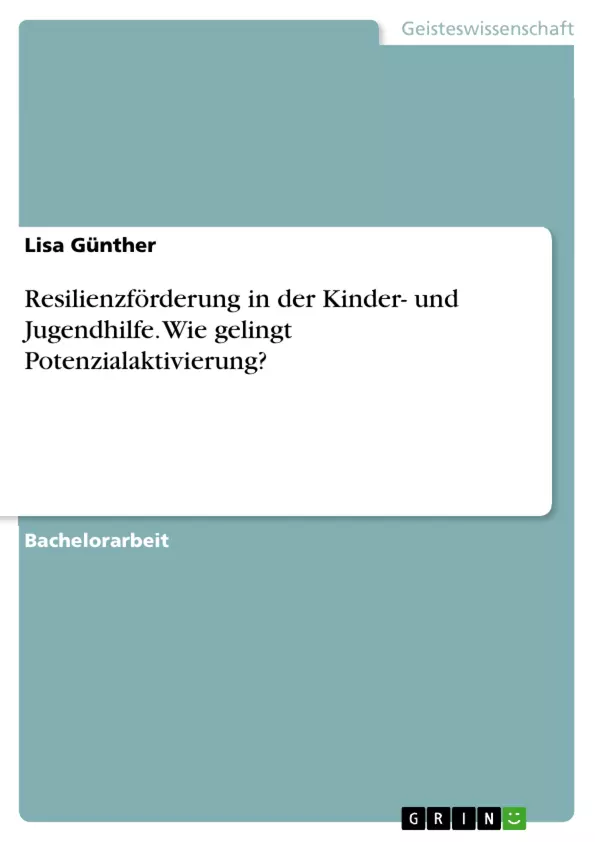Die vorliegende Bachelorarbeit fokussiert das Thema Resilienz als Bestandteil der Sozialen Arbeit im Bereich der Förderung in der Kinder und Jugendhilfe. Die vorliegende Arbeit wird im ersten Kapitel den theoretischen Hintergrund beleuchten und eine Begriffsdefinition vornehmen sowie den geschichtlichen Hintergrund erläutern. Der Fokus steht heute nicht mehr nur in der Minimierung von Fehlverhalten, sondern vermehrt auf der Förderung von Kompetenzen und Ressourcen zur positiven Lebensbewältigung.
Dieses Konzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky bildet einen weiteren Abschnitt dieser Arbeit und bildet mit der Studie von Emmy Werner die Grundlage der Gesundheitserhaltung und die Basis der Resilienz. Eingegangen wird im Besonderen auf das Kohärenzgefühl, da dieses Parallelen zu der Resilienz aufweist und wichtige Hinweise liefert. Das zweite Kapitel umfasst den Bereich der Resilienzforschung und hier insbesondere die Arbeit von Emmy Werner, die durch die Kauai-Studie den Grundstein für die Resilienzforschung legte. Weiter werden auch andere Studien transparent geschildert, um die Ergebnisse resümierend im Anschluss zusammenzufassen. Nachfolgend wird das Risiko– und Schutzfaktoren Konzept in seinen Einzelheiten aufgegliedert, um im nächsten Kapitel die Resilienzfaktoren darzulegen. Diese sind für die pädagogische Arbeit notwendige Bausteine, um mögliche Förderungsansätze klar zu strukturieren, da sie den Präventionsansatz ergeben. Das sechste Kapitel umfasst den praktischen Teil dieser Bachelor Arbeit und nimmt direkten Bezug auf die sozialpädagogische Praxis. Zur besseren Verstehbarkeit wird ein aktueller Stand der Resilienz in der Kinder– und Jugendhilfe angeführt und mit einem gezielten, pädagogischen Arbeitsfeld in den Kontext gebracht. Ihm folgt ein Fallbeispiel aus der Praxis, welches genanntes Konzept und dessen Notwendigkeit verdeutlichen soll. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der literaturbasierten Arbeit zusammengefasst und bewertet. Die Thesis, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, wird in ihren Facetten beantwortet und es werden konzeptionelle Impulse formuliert, die einen Ausblick auf die weitere, pädagogische Arbeit geben sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Struktur der Arbeit
- Theoretischer Hintergrund
- Begriffsbestimmung „Resilienz“
- Geschichtlicher Hintergrund
- Resilienz als dynamischer Anpassungsprozess
- Resilienzforschung und relevante Studien
- Kauai-Längsschnittstudie
- Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- Das Konzept der Salutogenese von Aaaron Antonovsky
- „sence of coherence“ – Kohärenzgefühl
- Entwicklung und Veränderbarkeit von Kohärenz
- Generalisierte Widerstandsressourcen
- Resümee der Forschungsergebnisse
- Risiko- und Schutzfaktorenkonzept
- Risikofaktorenkonzept
- Vulnerabilitätsfaktoren
- Risikofaktoren
- Schutzfaktorenkonzept
- Personale Ressourcen
- Soziale Ressourcen
- Familiäre Ressourcen
- Resümee Risiko- und Schutzfaktoren
- Resilienzfaktoren
- Positives Selbstkonzept
- Selbststeuerungsfähigkeit
- Selbstwirksamkeit
- Soziale Kompetenzen
- Umgang mit Stress
- Problemlösekompetenzen
- Resilienz in der sozialpädagogischen Praxis
- Projekt Petra - PAN
- Fallbeispiel
- Verlauf der Hilfe
- Resümee
- Begriffsbestimmung von Resilienz und dessen historischer Hintergrund
- Resilienzforschung und relevante Studien zur Identifizierung von Faktoren, die Resilienz begünstigen oder behindern
- Das Konzept der Salutogenese und die Bedeutung des Kohärenzgefühls für die Entwicklung von Resilienz
- Die Rolle von Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Resilienz
- Die Identifizierung und Beschreibung von relevanten Resilienzfaktoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Resilienz in der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel ist es, die Förderung von Resilienz als zentralen Auftrag der Sozialen Arbeit zu beleuchten und in den Kontext der pädagogischen Arbeit zu stellen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt das Thema Resilienz in der Sozialen Arbeit und insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe vor. Die Autorin erläutert ihre persönlichen Erfahrungen und motiviert die Fragestellung der Arbeit, die untersucht, was Menschen in ihrer Lebensbewältigung unterscheidet.
Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund des Themas Resilienz. Der Begriff wird definiert und seine historischen Wurzeln aufgezeigt. Die Kapitel beschäftigt sich mit dem dynamischen Anpassungsprozess, den Resilienz darstellt und beleuchtet relevante Studien in der Resilienzforschung, wie die Kauai-Längsschnittstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie. Das Konzept der Salutogenese und die Bedeutung des Kohärenzgefühls werden erläutert und die Entwicklung und Veränderbarkeit von Kohärenz werden näher betrachtet.
Kapitel 3 resümiert die Forschungsergebnisse und stellt das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept vor. Die Kapitel beschreibt die verschiedenen Risikofaktoren, die die Entwicklung von Resilienz negativ beeinflussen können, und die Schutzfaktoren, die Resilienz fördern können.
Kapitel 4 betrachtet die wichtigsten Resilienzfaktoren, wie das positive Selbstkonzept, die Selbststeuerungsfähigkeit, die Selbstwirksamkeit, die sozialen Kompetenzen, den Umgang mit Stress und die Problemlösekompetenzen.
Kapitel 5 beleuchtet die Anwendung von Resilienz in der sozialpädagogischen Praxis. Die Kapitel beschreibt das Projekt Petra – PAN und analysiert ein Fallbeispiel, um die praktische Anwendung der Resilienzförderung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu demonstrieren.
Schlüsselwörter
Resilienz, Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Arbeit, Potentialaktivierung, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Salutogenese, Kohärenzgefühl, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, Soziale Kompetenzen, Stressbewältigung, Problemlösekompetenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Resilienz" in der Kinder- und Jugendhilfe?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, Krisen durch Rückgriff auf persönliche und soziale Ressourcen zu bewältigen.
Was ist das Konzept der Salutogenese?
Ein von Aaron Antonovsky entwickeltes Modell, das sich darauf konzentriert, welche Faktoren den Menschen gesund erhalten (im Gegensatz zur Pathogenese).
Welche Studie legte den Grundstein für die Resilienzforschung?
Die Kauai-Längsschnittstudie von Emmy Werner gilt als Pionierarbeit der modernen Resilienzforschung.
Was versteht man unter dem "Kohärenzgefühl"?
Das "Sense of Coherence" beschreibt eine Grundorientierung, die Welt als verstehbar, handhabbar und bedeutsam zu erleben.
Welche Faktoren fördern die Resilienz bei Kindern?
Dazu zählen ein positives Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen und ein stabiles soziales Umfeld (Schutzfaktoren).
Wird in der Arbeit ein Praxisbeispiel genannt?
Ja, die Arbeit stellt das Projekt "Petra - PAN" vor und analysiert ein konkretes Fallbeispiel aus der sozialpädagogischen Praxis.
- Quote paper
- Lisa Günther (Author), 2017, Resilienzförderung in der Kinder- und Jugendhilfe. Wie gelingt Potenzialaktivierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128735