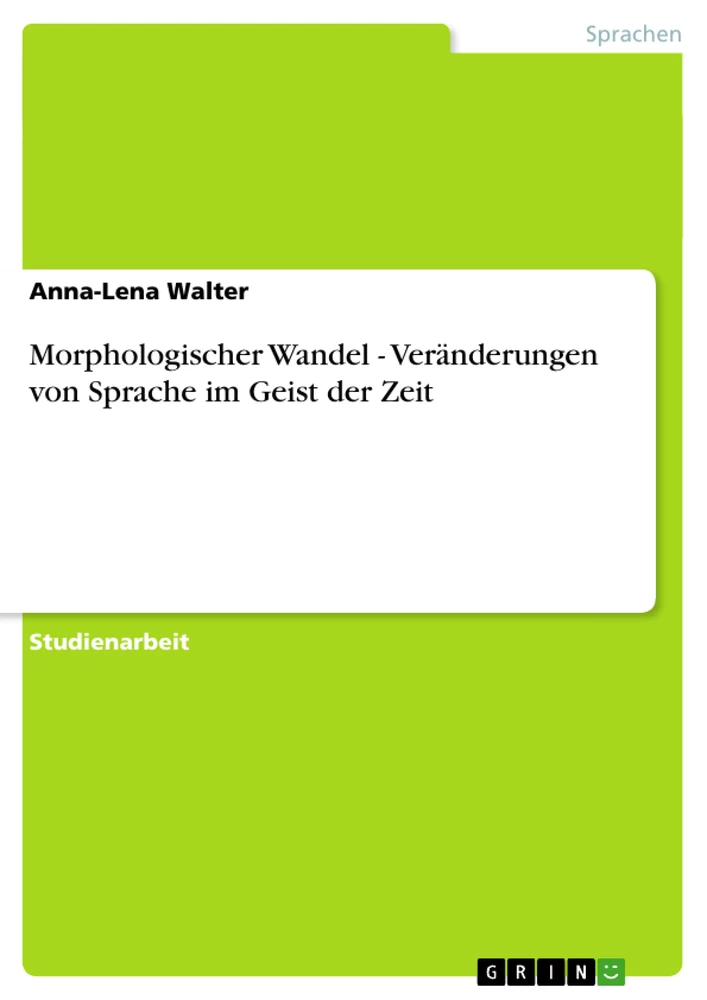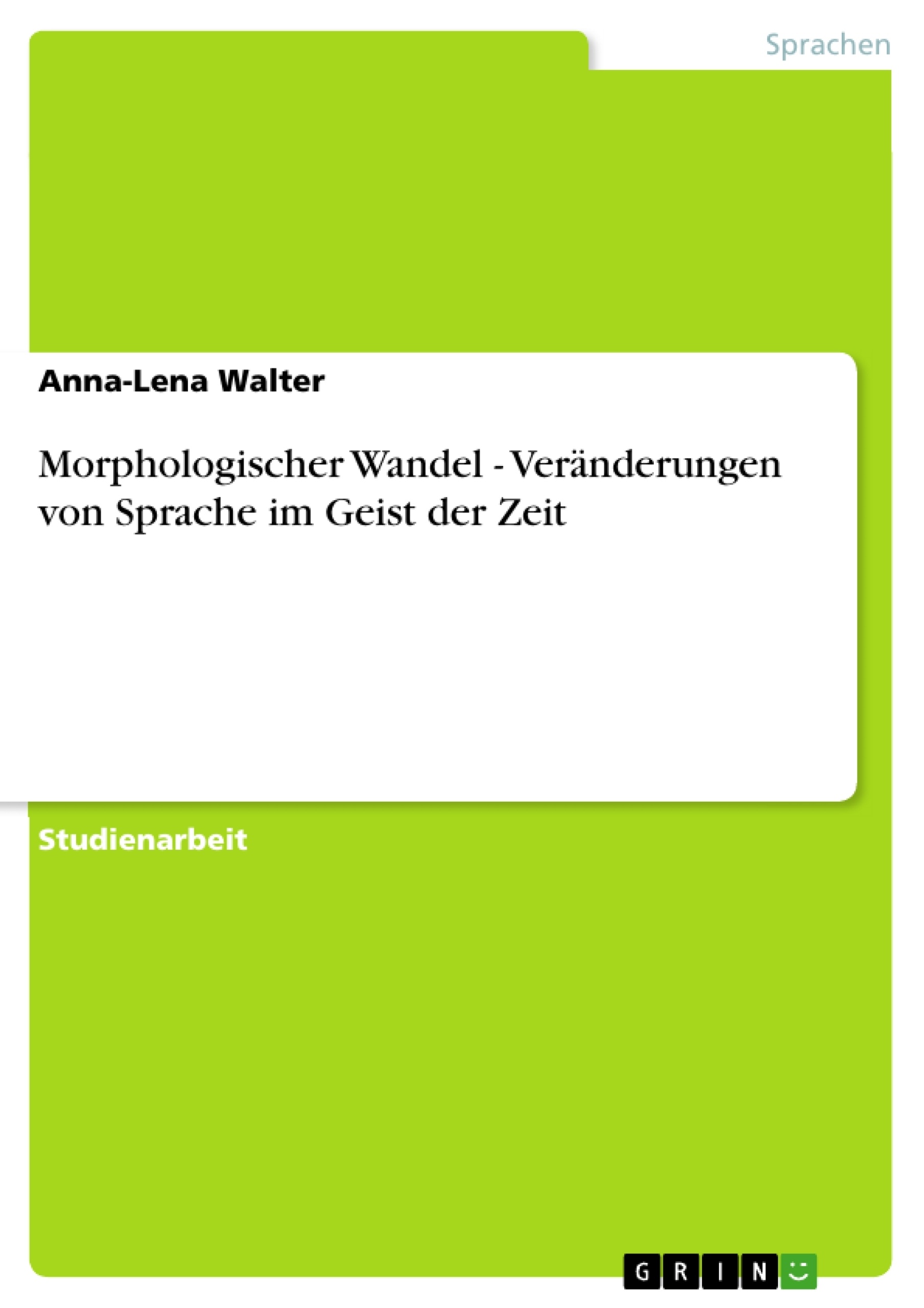„Alle natürlichen Sprachen befinden sich in ständigem Wandel.“
Ob heute oder vor 300 Jahren, ob in England, Italien oder Deutschland. Zu jeder Zeit, in allen Ländern und Bereichen, lässt sich das besondere Phänomen des Sprachwandels finden und steht deshalb auch seit einigen Jahrzehnten im Zentrum der Untersuchungen historischer Sprachwissenschaft. Obwohl die kontinuierliche Veränderung der Sprache meist ohne unser Wissen, ganz unbemerkt vor unseren Augen geschieht, lässt sich bei genauerer Betrachtung das Ausmaß stetiger Weiterentwicklung und Wandlung doch deutlich erkennen. Leider erfolgt damit meist eine negative Assoziation „in allen Kulturnationen und über alle Zeiten hinweg: von Platon über Quintilian und Rousseau bis hin zu Kemal Pascha, Helmut Kohl oder Prinz Charles“ . Die einen sprechen von Sprachverfall, dem Niedergang der deutschen Kultur , andere von zunehmender Verunreinigung der britischen Variante des Englischen durch amerikanischen Eingriff.
Schuldige für den Prozess der „Verwahrlosung“ von Sprache werden gesucht, neue Medien und die Schule, als Verursacher recht häufig genannt. Keller bietet in diesem Zusammenhang eine recht einleuchtende Erklärung für das negative Verständnis des Phänomens Sprachwandel:
„Eine Sprache ist ein komplexes System konventioneller Regeln. Jede Veränderung einer Konvention beginnt notwendigerweise mit deren Übertretung; und Übertretungen sprachlicher Konventionen nennt man „Fehler“. Wenn der Fehler schließlich zum allgemeinen Usus geworden ist, dann hat er aufgehört, ein Fehler zu sein und eine neue Konvention ist entstanden.“
Demnach scheint es vollkommen natürlich zu sein, dass Veränderungen der Sprache von Laien zunächst als „Fehler“ angesehen werden, als etwas Neues, etwas das wir nicht kennen und meist nur widerwillig annehmen.
Im Folgenden soll deshalb nun versucht werden einen genaueren, tiefgründigeren Blick hinter die Kulissen des Phänomens Sprachwandel zu werfen, Begrifflichkeiten zu klären und im Besonderen den Sprachwandel aus morphologischer Sicht näher zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was versteht man unter dem Begriff „Sprachwandel“
- 3. Morphologischer Wandel
- 3.1 Grundlegendes
- 3.2 Flexionsmorphologie
- 3.2.1 Analogischer Wandel
- 3.2.2 Morphemabbau
- 3.3 Wortbildungswandel
- 3.3.1 Univerbierung
- 3.3.2 Grammatikalisierung
- 3.3.3 Wortbildungsregel
- 3.4 Natürlicher grammatischer Wandel
- 3.4.1 Markiertheit
- 3.4.2 Morphosemantische Transparenz
- 3.4.3 Konstruktioneller Ikonismus
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den morphologischen Wandel im Deutschen. Ziel ist es, den Begriff des Sprachwandels zu klären und verschiedene Aspekte des morphologischen Wandels detailliert zu beleuchten. Dabei werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch konkrete Beispiele aus der Sprachgeschichte betrachtet.
- Definition und Verständnis von Sprachwandel
- Der morphologische Wandel als Teilprozess des Sprachwandels
- Analogischer Wandel und Morphemabbau als zentrale Mechanismen
- Wortbildungswandel und seine verschiedenen Arten
- Prinzipien des natürlichen grammatischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachwandel ein und betont dessen Kontinuität und die oft negative Konnotation von Veränderungen. Sie stellt die These auf, dass Sprachwandel ein natürlicher Prozess ist, der zunächst als „Fehler“ wahrgenommen wird, bevor er sich etabliert. Die Arbeit kündigt eine genauere Betrachtung des Sprachwandels aus morphologischer Perspektive an, insbesondere die Klärung von Begriffen und die Beleuchtung verschiedener Aspekte des Wandels.
2. Was versteht man unter dem Begriff „Sprachwandel“: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von „Sprachwandel“. Es beginnt mit der Definition von „Wandel“ als Veränderung über die Zeit und betrachtet anschließend den komplexeren Begriff „Sprache“. Hierbei wird die linguistische Unstimmigkeit in der Sprachdefinition angesprochen, und es wird ein gemeinsamer Nenner gefunden: Sprache als komplexes System aus Teilsystemen. Das „Zwiebelmodell“ von Nübling visualisiert die verschiedenen Ebenen der Sprache und zeigt, wie Sprachwandel in diesen Schichten unterschiedlich wirkt.
3. Morphologischer Wandel: Dieses Kapitel behandelt den morphologischen Wandel umfassend. Es beginnt mit grundlegenden Konzepten und setzt sich dann mit der Flexionsmorphologie auseinander, einschließlich analogischem Wandel (Ausgleich, proportionale Analogie, Volksetymologie) und Morphemabbau. Weiterhin werden die verschiedenen Arten des Wortbildungswandels (Univerbierung, Grammatikalisierung, Wortbildungsregeln) sowie Prinzipien des natürlichen grammatischen Wandels (Markiertheit, morphosemantische Transparenz, Konstruktioneller Ikonismus) detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Sprachwandel, Morphologischer Wandel, Analogischer Wandel, Morphemabbau, Wortbildungswandel, Grammatikalisierung, Univerbierung, Markiertheit, Morphosemantische Transparenz, Konstruktioneller Ikonismus, Flexionsmorphologie, Deutsches Sprachsystem.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Morphologischer Wandel im Deutschen
Was ist der Hauptgegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich umfassend mit dem morphologischen Wandel im Deutschen. Es erklärt den Begriff des Sprachwandels, untersucht verschiedene Aspekte des morphologischen Wandels und analysiert konkrete Beispiele aus der Sprachgeschichte.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Verständnis von Sprachwandel, morphologischer Wandel als Teilprozess des Sprachwandels, analogischer Wandel und Morphemabbau, Wortbildungswandel (Univerbierung, Grammatikalisierung, Wortbildungsregeln), Prinzipien des natürlichen grammatischen Wandels (Markiertheit, morphosemantische Transparenz, Konstruktioneller Ikonismus), sowie eine detaillierte Betrachtung der Flexionsmorphologie.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die den Sprachwandel einführt. Es folgt ein Kapitel zur Definition von Sprachwandel, gefolgt vom Hauptteil über den morphologischen Wandel. Dieser Teil wird in Unterkapitel zu Flexionsmorphologie und Wortbildungswandel unterteilt. Das Dokument schließt mit einem Fazit und einer Liste von Schlüsselbegriffen.
Welche konkreten Beispiele für morphologischen Wandel werden behandelt?
Konkrete Beispiele werden zwar nicht explizit genannt, aber die verschiedenen Arten des morphologischen Wandels (analogischer Wandel, Morphemabbau, Univerbierung, Grammatikalisierung) werden detailliert erklärt und an den Prinzipien des natürlichen grammatischen Wandels (Markiertheit, morphosemantische Transparenz, Konstruktioneller Ikonismus) veranschaulicht. Die Analyse stützt sich auf theoretische Grundlagen und implizit auf Beispiele aus der Sprachgeschichte des Deutschen.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Sprachwandel, Morphologischer Wandel, Analogischer Wandel, Morphemabbau, Wortbildungswandel, Grammatikalisierung, Univerbierung, Markiertheit, Morphosemantische Transparenz, Konstruktioneller Ikonismus, Flexionsmorphologie, Deutsches Sprachsystem.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Das Ziel ist es, den Begriff des Sprachwandels zu klären und verschiedene Aspekte des morphologischen Wandels detailliert zu beleuchten. Es verbindet theoretische Grundlagen mit konkreten Beispielen, um ein umfassendes Verständnis des morphologischen Wandels im Deutschen zu vermitteln.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Dokument enthält folgende Kapitel: * **Einleitung:** Einführung in den Sprachwandel und die Thematik des Dokuments. * **Was versteht man unter dem Begriff „Sprachwandel“?:** Definition von Sprachwandel und Sprache als komplexes System. * **Morphologischer Wandel:** Detaillierte Auseinandersetzung mit Flexionsmorphologie, Wortbildungswandel und Prinzipien des natürlichen grammatischen Wandels. * **Fazit:** Zusammenfassung der Ergebnisse.
An wen richtet sich dieses Dokument?
Das Dokument richtet sich an Leser, die sich akademisch mit Sprachwandel und insbesondere morphologischem Wandel im Deutschen auseinandersetzen möchten. Es eignet sich für Studierende der Linguistik und verwandter Fächer.
- Arbeit zitieren
- Anna-Lena Walter (Autor:in), 2008, Morphologischer Wandel - Veränderungen von Sprache im Geist der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112828