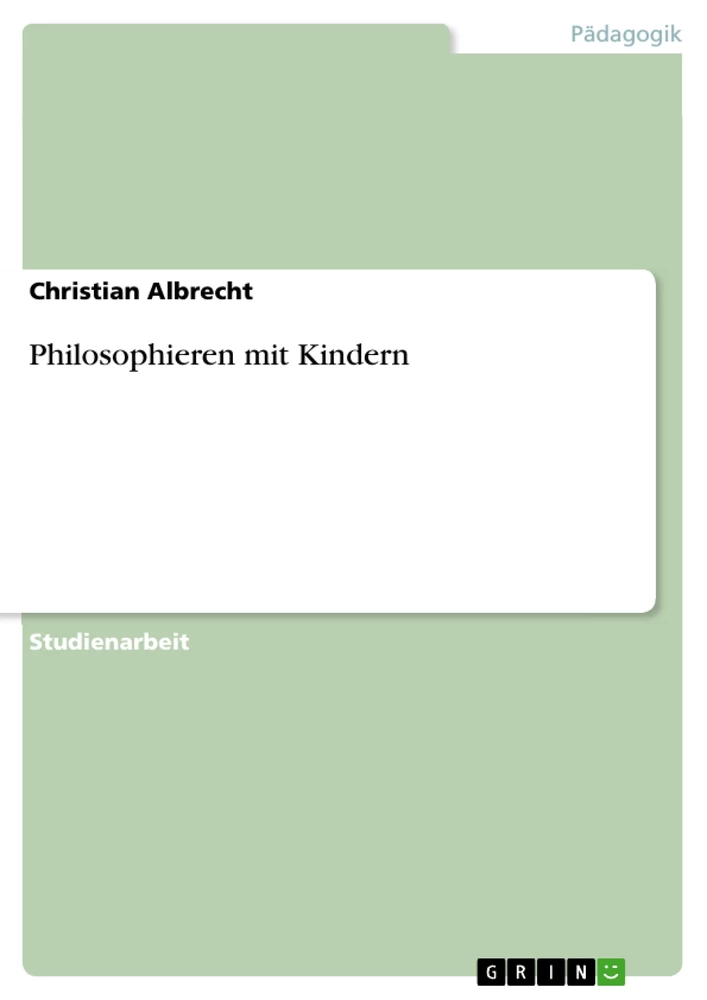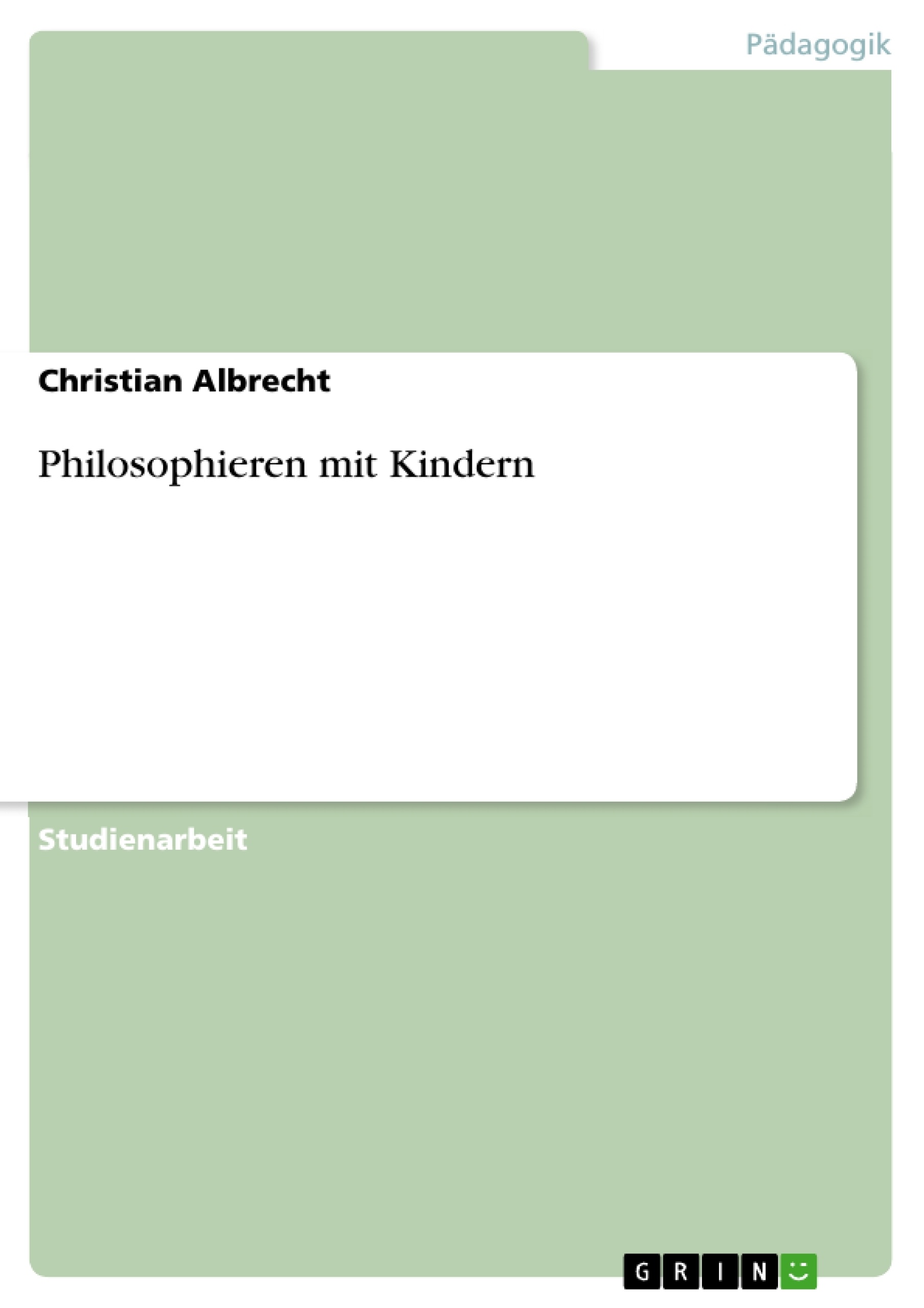Heutzutage wird in vielen Klassen auf internationaler Ebene philosophiert. Dies basiert auf der Faktizität, dass vor allem in der Grundschule Sinnfragen zu den ambivalentesten Themen - wie zum Beispiel „Gott oder Gerechtigkeit“ - gestellt werden. Dabei ist das Philosophieren nicht nur auf einzelne Fächer begrenzt, sondern kann in jedem Fach betrieben werden.
Dies steht im Widerspruch zu den rekapitulationistischen Vorstellungen und Modellen, welche versuchen uns nahe zu legen, dass ein Kind nicht in der Lage wäre, sich mit komplexen Themenbereichen wie zum Beispiel der „Sterbehilfe“ auseinanderzusetzen. Als einer der Gründe hierfür wird aufgeführt, dass sich das Kind in einer prä-rationalen Welt befinden würde.
Doch ist dies ein wirklicher Fakt? Sind Kinder wirklich nicht in der Lage, Fragen komplexer Natur zu diskutieren? Und welchen Sinn beziehungsweise welche Vorteile sollten sie daraus ziehen? Diese Fragen versucht die vorliegende Arbeit zu beantworten. Dazu wird im ersten Kapitel genauer auf die Definition der Begriffe Philosophie und philosophieren und deren Elemente eingegangen, um einen besseren Einstieg in die Thematik zu ermöglichen.
Im zweiten Kapitel soll auf die Methoden des Philosophierens mit Kindern eingegangen werden. So sollen Begriffe wie: Begriffliches Arbeiten, Argumentieren, Sokratisches Gespräch und Gedankenexperimente näher beleuchtet werden.
Das vorletzte Kapitel widmet sich direkt dem Philosophieren mit Kindern. Sowohl die Praxis als auch eventuelle Vorteile und Möglichkeiten der Kinder, welche sie durch das Philosophieren erhalten, werden aufgezeigt. Aber auch welche Voraussetzungen gegebenenfalls notwendig sind, um sich dem Prozess des Philosophierens unterwerfen zu können, und die dabei verwendeten Medien werden dargestellt.
Das letzte Kapitel widmet sich äußeren Faktoren zum Thema „Philosophieren mit Kindern“. So werden sowohl den Ebenen philosophierender Einrichtungen, welche sich dem Thema „Philosophieren mit Kindern“ widmen, als auch die geschichtliche Entwicklung weltweit und besonders innerhalb der Bundesrepublik vorgestellt. Aber auch die für das Philosophieren mit Kindern unverzichtbare Fortbildungsmaßnahmen werden thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1 – Die Philosophie
- Kapitel 1.1 – Definition von Philosophie/philosophieren
- Kapitel 1.2 – Elemente des Philosophierens
- Kapitel 1.2.1 - Staunen
- Kapitel 1.2.2 - Fragen
- Kapitel 1.2.3 - Nachdenken
- Kapitel 1.2.4 - Zweifeln
- Kapitel 1.2.5 - Weiterdenken
- Kapitel 1.2.6 – Infragestellen
- Kapitel 2 – Methoden des Philosophierens mit Kindern
- Kapitel 2.1 - Begriffliches Arbeiten
- Kapitel 2.2 – Argumentieren
- Kapitel 2.3 – Das sokratische Gespräch
- Kapitel 2.4 – Gedankenexperimente
- Kapitel 3 - Philosophieren mit Kindern intern
- Kapitel 3.1 - Bedeutung des Philosophierens mit Kindern
- Kapitel 3.2 – Vorteile des Philosophierens mit Kindern
- Kapitel 3.3 – Voraussetzungen zum Philosophieren mit Kindern
- Kapitel 3.4 Visuelle Medien
- Kapitel 3.5 - Philosophieren mit Kindern in der Praxis
- Kapitel 4 - Philosophieren mit Kindern extern
- Kapitel 4.1 – Geschichtliche Entwicklung des Philosophierens mit Kindern
- Kapitel 4.2 – Fortbildungen zum Thema Philosophieren mit Kindern
- Kapitel 4.3 – Ebenen philosophierender Einrichtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Vorteile des Philosophierens mit Kindern. Sie hinterfragt die Annahme, dass Kinder aufgrund ihres Alters nicht in der Lage sind, komplexe philosophische Fragen zu diskutieren. Die Arbeit beleuchtet sowohl methodische Aspekte des Philosophierens mit Kindern als auch dessen Bedeutung und praktische Umsetzung im schulischen und außerschulischen Kontext.
- Definition und Elemente des Philosophierens
- Methoden des Philosophierens mit Kindern (begriffliches Arbeiten, Argumentieren, Sokratisches Gespräch, Gedankenexperimente)
- Bedeutung und Vorteile des Philosophierens für Kinder
- Praktische Umsetzung und Voraussetzungen des Philosophierens mit Kindern
- Historische Entwicklung und aktuelle Praxis des Philosophierens mit Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 – Die Philosophie: Dieses Kapitel beginnt mit der Definition von "Philosophie" und "Philosophieren", wobei der griechische Ursprung und die Vielfältigkeit der philosophischen Disziplinen hervorgehoben werden. Es werden zwei Auffassungen von Philosophie unterschieden: die esoterische, die auf dem gesammelten Wissen über Sinn und Zweck der Welt basiert, und die exoterische, die davon überzeugt ist, dass jeder Mensch philosophieren kann. Anschließend werden die zentralen Elemente des Philosophierens detailliert beschrieben: Staunen als Grundlage, Fragen als Antrieb, Nachdenken als Prozess, Zweifeln als Motor, Weiterdenken als dynamischer Aspekt und Infragestellen als Korrekturmechanismus. Die Ausführungen zeigen, dass Philosophieren kein statischer, sondern ein dynamischer Prozess des Hinterfragens und des kritischen Denkens ist.
Kapitel 2 – Methoden des Philosophierens mit Kindern: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Methoden, die das Philosophieren mit Kindern ermöglichen. Es beleuchtet "begriffliches Arbeiten" als Grundlage für klare Kommunikation, "Argumentieren" als Fähigkeit zum konstruktiven Austausch von Standpunkten, das "Sokratische Gespräch" als Methode der gelenkten Fragen und "Gedankenexperimente" als Möglichkeit, komplexe Themen auf zugängliche Weise zu erarbeiten. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit dieser Methoden im Kontext der kindlichen Entwicklung und der Fähigkeit, Kinder zu einem eigenständigen philosophischen Denken anzuregen.
Kapitel 3 - Philosophieren mit Kindern intern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung und den Vorteilen des Philosophierens für Kinder. Es werden die positiven Auswirkungen auf die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung herausgestellt. Weiterhin werden die Voraussetzungen für erfolgreiches Philosophieren mit Kindern erörtert, einschließlich der Rolle visueller Medien und die praktische Umsetzung in verschiedenen Kontexten. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der positiven Effekte und der notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Durchführung.
Kapitel 4 - Philosophieren mit Kindern extern: Das Kapitel widmet sich den externen Faktoren, die das Philosophieren mit Kindern beeinflussen. Die historische Entwicklung des Philosophierens mit Kindern wird ebenso betrachtet wie die Rolle von Fortbildungen für Erzieher und Lehrer. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beschreibung verschiedener Ebenen philosophierender Einrichtungen und deren Beitrag zur Förderung des philosophischen Denkens bei Kindern. Der Fokus liegt auf der Einbettung des Philosophierens in einen breiteren gesellschaftlichen und institutionellen Kontext.
Schlüsselwörter
Philosophieren mit Kindern, Grundschule, Methoden, Sokratisches Gespräch, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenz, begriffliches Arbeiten, Argumentieren, Gedankenexperimente, Fortbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Philosophieren mit Kindern"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema "Philosophieren mit Kindern". Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Text untersucht die Möglichkeiten und Vorteile des Philosophierens mit Kindern, betrachtet methodische Aspekte und die praktische Umsetzung im schulischen und außerschulischen Kontext.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Philosophie im Allgemeinen, inklusive Definition und Elemente des Philosophierens. Kapitel 2 konzentriert sich auf Methoden des Philosophierens mit Kindern (begriffliches Arbeiten, Argumentieren, Sokratisches Gespräch, Gedankenexperimente). Kapitel 3 befasst sich mit der Bedeutung und den Vorteilen des Philosophierens für Kinder (intern), einschließlich der Voraussetzungen und der praktischen Umsetzung. Kapitel 4 widmet sich externen Faktoren wie der historischen Entwicklung, Fortbildungen und verschiedenen Ebenen philosophierender Einrichtungen.
Wie wird Philosophie definiert und welche Elemente des Philosophierens werden beschrieben?
Das Dokument unterscheidet zwischen einer esoterischen und exoterischen Auffassung von Philosophie. Die Elemente des Philosophierens umfassen Staunen, Fragen, Nachdenken, Zweifeln, Weiterdenken und Infragestellen. Philosophieren wird als dynamischer Prozess des Hinterfragens und kritischen Denkens dargestellt.
Welche Methoden des Philosophierens mit Kindern werden vorgestellt?
Das Dokument stellt folgende Methoden vor: begriffliches Arbeiten für klare Kommunikation, Argumentieren für den konstruktiven Austausch von Standpunkten, das Sokratische Gespräch als Methode der gelenkten Fragen und Gedankenexperimente zur Erarbeitung komplexer Themen auf zugängliche Weise.
Welche Bedeutung und Vorteile hat das Philosophieren für Kinder?
Das Philosophieren mit Kindern wird als förderlich für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung beschrieben. Es werden positive Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung hervorgehoben.
Welche Voraussetzungen sind für das Philosophieren mit Kindern notwendig?
Das Dokument beschreibt die notwendigen Rahmenbedingungen für erfolgreiches Philosophieren mit Kindern, einschließlich der Rolle visueller Medien und der praktischen Umsetzung in verschiedenen Kontexten.
Wie wird die historische Entwicklung und die aktuelle Praxis des Philosophierens mit Kindern dargestellt?
Kapitel 4 beleuchtet die historische Entwicklung des Philosophierens mit Kindern, die Rolle von Fortbildungen für Erzieher und Lehrer und verschiedene Ebenen philosophierender Einrichtungen, die zum philosophischen Denken bei Kindern beitragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter umfassen: Philosophieren mit Kindern, Grundschule, Methoden, Sokratisches Gespräch, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenz, begriffliches Arbeiten, Argumentieren, Gedankenexperimente, Fortbildung.
- Arbeit zitieren
- Christian Albrecht (Autor:in), 2008, Philosophieren mit Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112811