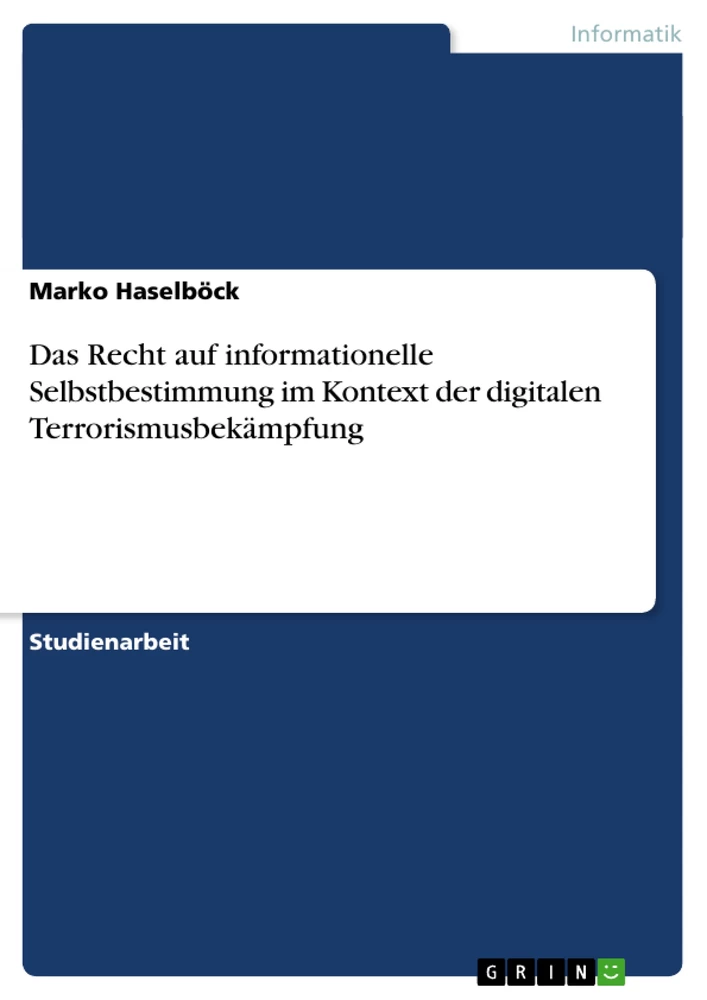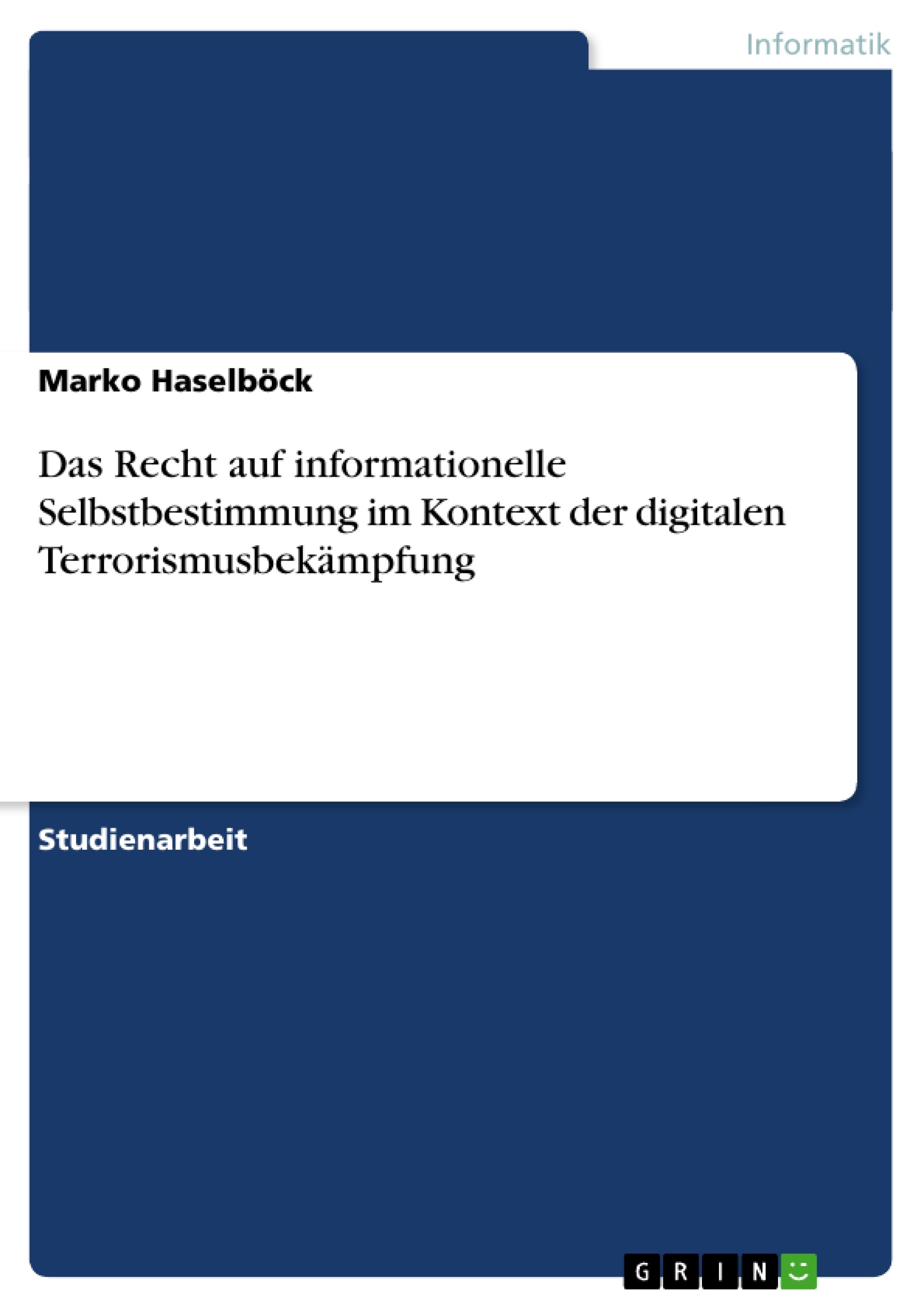Der Verfasser behandelt in der vorliegenden Hausarbeit die Thematik „Das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung im Kontext der digitalen Terrorismusbekämpfung“.
Nach Definitionen der informationellen Selbstbestimmung, der Strafverfolgung und
des Terrorismus werden die aktuellen Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung
aufgezeigt, sowie der Zielkonflikt zwischen Strafverfolgung und der Wahrung der
Grundrechte. „Im deutschen Recht bezeichnet die Informationelle Selbstbestimmung das Recht
des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner
personenbezogenen Daten zu bestimmen. Es handelt sich dabei nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um ein Datenschutz-Grundrecht,
welches im Grundgesetz nicht ausdrücklich erwähnt wird. Der Vorschlag, ein
Datenschutz-Grundrecht in das Grundgesetz einzufügen, fand bisher nicht die
erforderliche Mehrheit.
Das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist eine Ausprägung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts und wurde vom Bundesverfassungsgericht im so genannten
Volkszählungsurteil 1983 als Grundrecht anerkannt. Ausgangspunkt für das
Bundesverfassungsgericht ist das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, also Art. 2 Abs. 1
GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG (unter B II 1 a) des Urteils).“
„Kurz beantwortet bedeutet informationelle Selbstbestimmung: Jeder hat das Recht
zu wissen, wer was wann über ihn weiß.“
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- DEFINITION „INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG“
- DEFINITION „STRAFVERFOLGUNG“
- DEFINITION „TERRORISMUS“
- MABNAHMEN DER DIGITALEN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG
- Anti-Terror-Datei
- Gesetz zur Telekommunikationsüberwachung
- ZIELKONFLIKT ZWISCHEN STRAFVERFOLGUNG UND GRUNDRECHTE
- FAZIT
- QUELLENVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und den Maßnahmen der digitalen Terrorismusbekämpfung. Die Arbeit analysiert die Definitionen der informationellen Selbstbestimmung, der Strafverfolgung und des Terrorismus, um anschließend die aktuellen Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung im digitalen Raum zu beleuchten. Im Fokus steht dabei der Zielkonflikt zwischen der effektiven Strafverfolgung und der Wahrung der Grundrechte.
- Definition und Abgrenzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung
- Definition und Bedeutung der Strafverfolgung im Kontext der Terrorismusbekämpfung
- Analyse der aktuellen Maßnahmen der digitalen Terrorismusbekämpfung
- Bewertung des Zielkonflikts zwischen Strafverfolgung und Grundrechten
- Diskussion der ethischen und rechtlichen Herausforderungen der digitalen Terrorismusbekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Kontext der digitalen Terrorismusbekämpfung“ ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das Kapitel „Definition „Informationelle Selbstbestimmung““ erläutert das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als ein Datenschutz-Grundrecht, das sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ableitet. Es wird die Bedeutung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im Kontext der digitalen Welt und die Herausforderungen durch die zunehmende Datensammlung und -verwertung durch staatliche und private Akteure beleuchtet.
Das Kapitel „Definition „Strafverfolgung““ definiert den Begriff der Strafverfolgung im Kontext der Terrorismusbekämpfung und betont die Bedeutung der Informationsgewinnung und -verarbeitung für die effektive Strafverfolgung. Es werden die Herausforderungen der Strafverfolgung im digitalen Raum und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten beleuchtet.
Das Kapitel „Definition „Terrorismus““ analysiert die Definition des Terrorismus im Rahmen des „Übereinkommens zu Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus“ und beleuchtet die Herausforderungen der Terrorismusbekämpfung im digitalen Raum. Es werden die verschiedenen Formen des digitalen Terrorismus und die Möglichkeiten der Nutzung des Internets zur Planung und Durchführung von Terroranschlägen diskutiert.
Das Kapitel „Maßnahmen der digitalen Terrorismusbekämpfung“ stellt die wichtigsten Maßnahmen der digitalen Terrorismusbekämpfung vor, darunter die Anti-Terror-Datei und das Gesetz zur Telekommunikationsüberwachung. Es werden die Vor- und Nachteile dieser Maßnahmen im Hinblick auf die Effektivität der Terrorismusbekämpfung und die Wahrung der Grundrechte diskutiert.
Das Kapitel „Zielkonflikt zwischen Strafverfolgung und Grundrechte“ analysiert den Zielkonflikt zwischen der effektiven Strafverfolgung und der Wahrung der Grundrechte im Kontext der digitalen Terrorismusbekämpfung. Es werden die verschiedenen Interessen und Perspektiven der beteiligten Akteure, wie z.B. der Strafverfolgungsbehörden, der Geheimdienste und der Bürger, beleuchtet und die Notwendigkeit eines ausgewogenen Abwägungsprozesses zwischen Sicherheit und Freiheit betont.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die digitale Terrorismusbekämpfung, die Anti-Terror-Datei, das Gesetz zur Telekommunikationsüberwachung, Strafverfolgung, Grundrechte, Datenschutz, Sicherheit und Freiheit. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der digitalen Terrorismusbekämpfung im Spannungsfeld zwischen effektiver Strafverfolgung und Wahrung der Grundrechte.
- Quote paper
- Marko Haselböck (Author), 2006, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Kontext der digitalen Terrorismusbekämpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112780