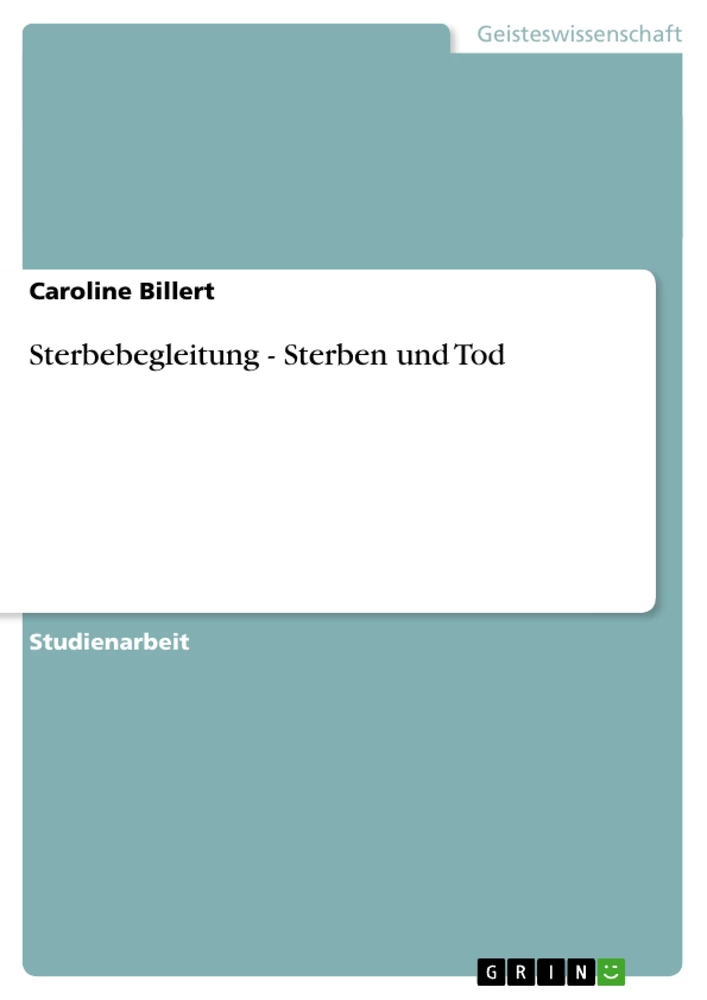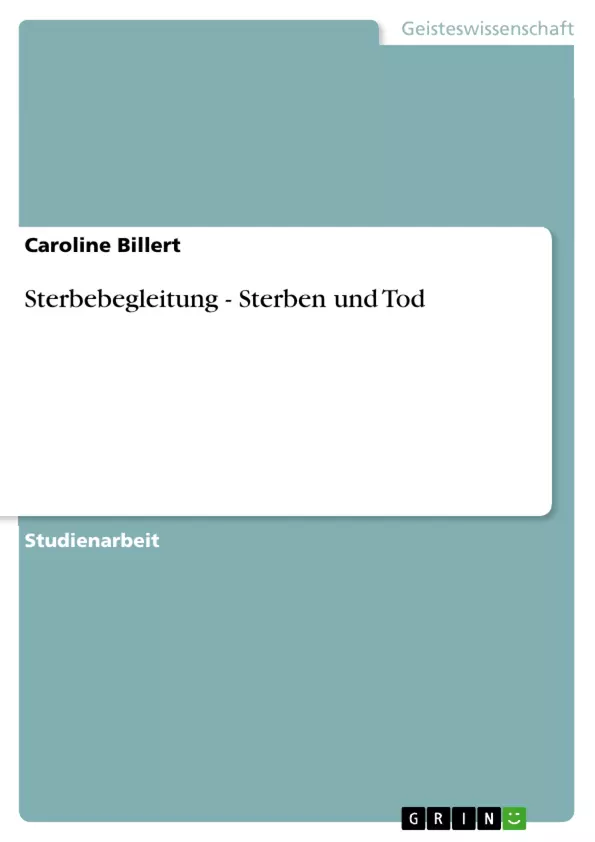„ Der Anspruch eines jeden Menschen auf einen würdigen Tod ist nur unzugänglich gewährleistet!“
Dieses Zitat von Werner Schell verdeutlicht, wie dringend ein Ausbau und eine Verbesserung von Sterbebegleitung in Deutschland ist. Trotz großem medizinischem Fortschritt und gestiegener Lebenserwartung ist die Versorgung Sterbender unzureichend. Bis zu 900 000 Menschen sterben jährlich in der Bundesrepublik Deutschland. Fast die Hälfte stirbt in Krankenhäusern, oder Pflegeeinrichtungen. Zahlreiche der betroffenen Patienten haben Angst, nicht in Würde sterben zu können. „Apparatemedizin“ , statt Schmerztherapie und Kommunikation, heißt es in den meisten Fällen. Laut Personal, sind es circa 25% aller Sterbefälle, die unwürdig den Tod erleiden. In Krankenhäusern fehlen oft Zeit und richtige Ausbildung, für eine angemessene Sterbebegleitung.
Die menschliche Endlichkeit betrifft jeden. Deshalb sollten alle, über Ablauf des Sterbens, und Möglichkeiten die einem zur Verfügung stehen, aufgeklärt werden. Denn unzählige kennen weder Palliativmedizin, noch Hospizarbeit.
Von vielen wird das Thema Sterben als unangenehm wahrgenommen. Angst, Ungewissheit und Verdrängung sind oft die Reaktionen. Jedoch ist die Tabuisierung des Thema Todes in Deutschland auch zum größten Teil eine Behauptung. Es gab in den letzten Jahren mehrere Veränderungen in ärztlichen Praxen und eine deutliche Verbesserung von Versorgungsstrukturen.
Bei einer öffentlichen Diskussion, die das Thema Sterbehilfe oder Sterbebegleitung betrifft, ist eine rationale und sachliche Basis erforderlich. Es müssen immer die Reaktionen, Erfahrungswerten, oder auch der Glauben Einzelner, bei diesem kritischen Thema mit einbezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärung
- 2.1 Sterbebegleitungen im Gesundheitswesen
- 2.2 Tötung auf Verlangen
- 2.3 Ärztliche Beihilfe zum Suizid
- 2.4 Beendigung, Begrenzung und Unterlassen von Therapie
- 3. Möglichkeiten der Willensbekundung
- 3.1 Patientenverfügungen
- 3.2 Vorsorgevollmachten
- 3.3 Betreuungsverfügungen
- 4. Adäquate psychische Betreuung sterbender Menschen
- 4.1 Welche Wünsche und Bedürfnisse haben Schwerkranke und ihre Begleiter
- 4.2 Kommunikation
- 5. Palliativmedizin
- 5.1 Aufgaben der Palliativmedizin
- 5.2 Palliativmedizinischer Bedarf
- 6. Hospize
- 6.1 Historische Entwicklung
- 6.2 Unterschied und Vergleich von Hospiz und Palliativstationen
- 7. Versorgung, Finanzierung und Leistungsanbieter
- 8. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die aktuelle Situation der Sterbebegleitung in Deutschland. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der Sterbebegleitung zu beleuchten und die Notwendigkeit einer Verbesserung der Versorgung Sterbender hervorzuheben. Die Arbeit analysiert die rechtlichen und ethischen Herausforderungen sowie die vorhandenen Möglichkeiten der psychischen Betreuung und medizinischen Versorgung.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung
- Möglichkeiten der Patienten-Willensbekundung (Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten)
- Rollen und Aufgaben von Palliativmedizin und Hospizen
- Psychische Betreuung sterbender Menschen und deren Angehörige
- Versorgungsstrukturen und Finanzierung der Sterbebegleitung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont den dringenden Bedarf an Verbesserungen in der Sterbebegleitung in Deutschland. Sie verweist auf die hohe Zahl jährlicher Todesfälle und die unzureichende Versorgung vieler Sterbender, die oft unter unwürdigen Bedingungen sterben müssen. Der Mangel an Zeit und angemessener Ausbildung im Krankenhauspersonal wird als wesentlicher Faktor genannt. Das Thema Sterben wird als tabuisiert dargestellt, obwohl es in den letzten Jahren positive Veränderungen in der ärztlichen Praxis und den Versorgungsstrukturen gegeben hat. Die Notwendigkeit einer rationalen und sachlichen öffentlichen Diskussion über Sterbehilfe und Sterbebegleitung wird hervorgehoben.
2. Begriffserklärung: Dieses Kapitel klärt den umfassenden Begriff der Sterbebegleitung, der von professionellen Leistungen bis hin zu familiärem Engagement reicht. Es differenziert zwischen "aktiver" und "passiver" Sterbehilfe, wobei die "passive" Sterbehilfe eingeschränkt erlaubt, die "aktive" hingegen abgelehnt wird. Die problematischen Definitionsgrenzen werden anhand von Beispielen (z.B. Abbruch der Beatmung) veranschaulicht. Die problematische Geschichte des Begriffs "Euthanasie" im Nationalsozialismus wird hervorgehoben, und die Notwendigkeit einer klaren und eindeutigen Begriffsdefinition wird betont, die verschiedene Disziplinen (Medizin, Pflege, Juristik, Geschichte) einbezieht. "Aktive" Sterbehilfe wird als "Tötung auf Verlangen" oder "ärztliche Beihilfe zum Suizid" umschrieben, während "passive" Sterbehilfe Begriffe wie "Therapiebegrenzung" oder "Schmerzbehandlung mit eventueller Lebensverkürzung" umfasst.
2.2 Tötung auf Verlangen: Dieses Kapitel diskutiert die Tötung auf Verlangen im Kontext der Sterbebegleitung. Es werden unterschiedliche Meinungen und Perspektiven dargelegt. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten wird gegen die weitreichenden medizinischen Interventionmöglichkeiten abgewogen. Die fehlende gesetzliche Regelung in Deutschland und die Strafbarkeit nach § 216 StGB werden erklärt. Die Ablehnung der Tötung auf Verlangen durch die Bundesärztekammer und verschiedene Organisationen wird dargelegt. Im Gegensatz dazu werden die Argumente von Wissenschaftlern, Juristen und Theologen angeführt, die in Ausnahmefällen eine Straffreiheit befürworten.
Schlüsselwörter
Sterbebegleitung, Sterbehilfe, Palliativmedizin, Hospiz, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Tötung auf Verlangen, ärztliche Beihilfe zum Suizid, Würde, Selbstbestimmung, Recht auf Sterben, Gesundheitswesen, Kommunikation, psychische Betreuung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Sterbebegleitung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die aktuelle Situation der Sterbebegleitung in Deutschland. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte, von rechtlichen und ethischen Herausforderungen bis hin zu Möglichkeiten der psychischen Betreuung und medizinischen Versorgung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Notwendigkeit einer verbesserten Versorgung Sterbender.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Rechtliche Rahmenbedingungen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung, Möglichkeiten der Patienten-Willensbekundung (Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten), Rollen und Aufgaben von Palliativmedizin und Hospizen, psychische Betreuung sterbender Menschen und deren Angehörige sowie Versorgungsstrukturen und Finanzierung der Sterbebegleitung.
Welche Begriffe werden in der Hausarbeit erklärt?
Die Hausarbeit klärt zentrale Begriffe wie Sterbebegleitung, Sterbehilfe (aktive und passive), Tötung auf Verlangen, ärztliche Beihilfe zum Suizid, Therapiebegrenzung und die historische Problematik des Begriffs "Euthanasie". Es werden die Unterschiede und Überschneidungen dieser Begriffe detailliert erläutert.
Wie wird die "Tötung auf Verlangen" behandelt?
Das Kapitel "Tötung auf Verlangen" diskutiert unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zu diesem Thema. Es werden das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und die medizinischen Interventionmöglichkeiten gegeneinander abgewogen. Die fehlende gesetzliche Regelung in Deutschland und die Strafbarkeit nach § 216 StGB werden ebenso erklärt wie die Positionen der Bundesärztekammer und anderer Organisationen sowie Argumente für eine mögliche Straffreiheit in Ausnahmefällen.
Welche Rolle spielen Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten?
Die Hausarbeit behandelt Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten als wichtige Instrumente der Patienten-Willensbekundung. Sie erläutert deren Bedeutung für die Selbstbestimmung am Lebensende und im Kontext der Sterbebegleitung.
Welche Bedeutung haben Palliativmedizin und Hospize?
Die Arbeit beschreibt die Aufgaben der Palliativmedizin und die Rolle von Hospizen in der Sterbebegleitung. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Hospizen und Palliativstationen beleuchtet.
Wie wird die psychische Betreuung Sterbender behandelt?
Die psychische Betreuung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen ist ein wichtiger Aspekt der Hausarbeit. Es wird untersucht, welche Bedürfnisse Schwerkranke und ihre Begleiter haben und wie eine adäquate Kommunikation gestaltet werden kann.
Wie sind die Versorgungsstrukturen und die Finanzierung der Sterbebegleitung in Deutschland?
Die Hausarbeit analysiert die bestehenden Versorgungsstrukturen und Finanzierungssysteme der Sterbebegleitung in Deutschland, um die Herausforderungen und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit betont den dringenden Bedarf an Verbesserungen in der Sterbebegleitung in Deutschland und ruft zu einer rationalen und sachlichen öffentlichen Diskussion über Sterbehilfe und Sterbebegleitung auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Sterbebegleitung, Sterbehilfe, Palliativmedizin, Hospiz, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Tötung auf Verlangen, ärztliche Beihilfe zum Suizid, Würde, Selbstbestimmung, Recht auf Sterben, Gesundheitswesen, Kommunikation, psychische Betreuung.
- Citar trabajo
- Caroline Billert (Autor), 2007, Sterbebegleitung - Sterben und Tod, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112772