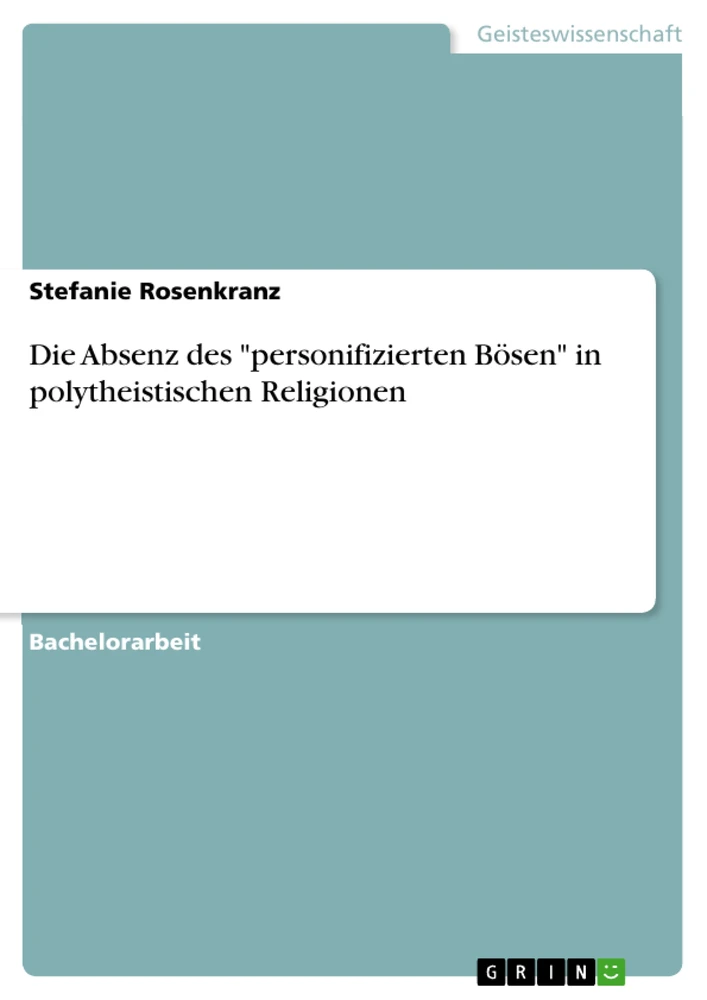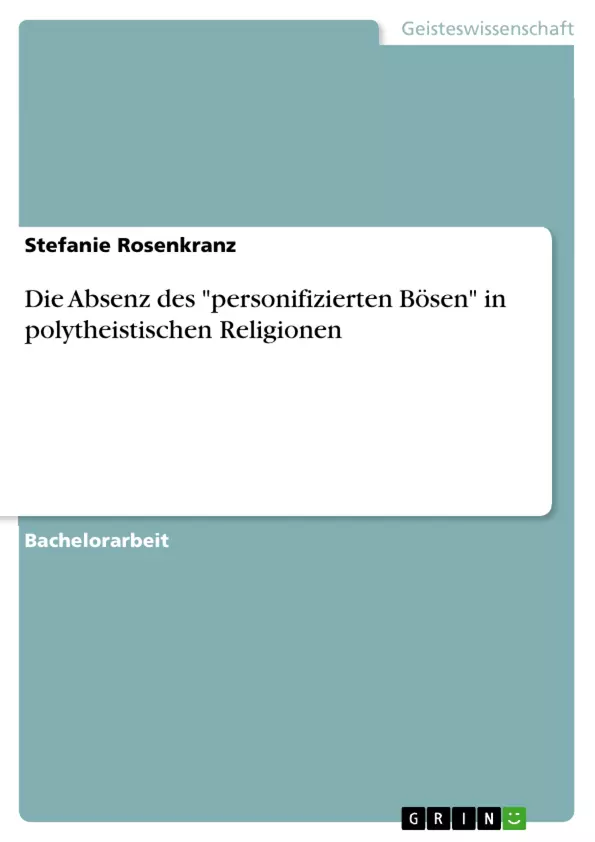In den antiken polytheistischen Religionen, wie etwa die der Ägypter, Griechen oder der alten Römer, scheint ein Teufel als solches zu fehlen. Oder möchte er nur nicht erkannt und kann deswegen nicht klar benannt werden? Es ist allgemein bekannt, dass der Teufel oft im Detail steckt. Daher soll im Rahmen dieser Arbeit die Absenz des personifizierten Bösen, anhand der im Vorfeld genannten polytheistischen Religionen und deren Konzeptionen des Bösen, untersucht werden.
Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Im ersten wird auf die Ambivalenz des Bösen näher eingegangen. Daher werden zunächst die Bemühungen, sich dem Phänomen des Bösen, anhand verschiedener philosophischer
und theologischer Erklärungsansätze, begrifflich zu bemächtigen, verdeutlicht. Der religionswissenschaftliche Diskurs ist hierbei von besonderem Interesse.
Im zweiten, überwiegend rekonstruktiv angelegten Kapitel, wird sich mit der theologischen und kulturgeschichtlichen Genese und den Entwicklungsphasen der Teufelsfigur näher auseinandergesetzt. Neben einer der frühesten bekannten Darstellungen, werden Funktion und Bedeutung eines absoluten, bösen Prinzips im Tanach und im Neuen Testament näher herausgearbeitet. Zudem wird die Teufelsfigur anhand ihrer Entwicklung und Darstellung im abendländischen Volksglauben, von ca. 500-1.200 n. Chr., näher erläutert.
Im dritten Kapitel erfolgt eine Untersuchung der Absenz des personifizierten Bösen in polytheistischen Religionen. Es werden zunächst die stärksten Teufelsadaptionen der griechischen, römischen und ägyptischen Religion vorgestellt und
anhand einer vergleichenden Analyse, den monotheistischen Teufelsfigurationen, gegenübergestellt. Abschließend
werden im letzten Kapitel die Erkenntnisgewinne zusammenfasst und zu einem Fazit gelangt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Ambivalenz des Bösen
- 3. Satan, Teufel, Luzifer - Religionsgeschichtliche und theologische Grundlagen
- 3.1. Genese und Entwicklungsphasen der Teufelsfigurationen in monotheistischen Religionen
- 3.1.1. Judentum - Der Satan im Tanach
- 3.1.2. Christentum - Der Teufel im Neuen Testament
- 3.1.3. Teufelsfigurationen im abendländischen Mittelalter
- 3.2. Höllenkonzepte
- 4. Die Absenz des „personifizierten Bösen“ in polytheistischen Religionen
- 4.1. Die Konzeption des Bösen in der griechisch-römischen Mythologie
- 4.2. Die Konzeption des Bösen in der ägyptischen Mythologie
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Abwesenheit einer personifizierten Bösen Gestalt in polytheistischen Religionen im Vergleich zu monotheistischen Glaubensrichtungen. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Konzepte des Bösen in diesen Religionen zu analysieren und die Gründe für die Abwesenheit einer zentralen Teufelsfigur in polytheistischen Mythen zu ergründen.
- Ambivalenz des Bösen und dessen begriffliche Erfassung
- Entwicklung der Teufelsfigur in monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum)
- Konzeption des Bösen in der griechischen und römischen Mythologie
- Konzeption des Bösen in der ägyptischen Mythologie
- Vergleichende Analyse der Konzepte des Bösen in monotheistischen und polytheistischen Religionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Abwesenheit einer personifizierten bösen Gestalt in polytheistischen Religionen ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für dieses Phänomen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Autorin erläutert die Schwierigkeiten, das Konzept des Bösen in verschiedenen philosophischen und theologischen Ansätzen zu fassen, und hebt die begrenzte wissenschaftliche Quellenlage zu diesem Thema hervor. Die Arbeit wird als vergleichende Untersuchung der Konzepte des Bösen in monotheistischen und polytheistischen Religionen angelegt.
2. Die Ambivalenz des Bösen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen philosophischen und theologischen Versuchen, das Phänomen des Bösen zu definieren und zu erklären. Es wird die Schwierigkeit hervorgehoben, dem Bösen einen eindeutigen Begriff zu verleihen, und die Ambivalenz des Bösen als komplexes Phänomen wird betont. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse der unterschiedlichen Konzepte des Bösen in verschiedenen Religionen, indem es die Vielschichtigkeit des Themas aufzeigt.
3. Satan, Teufel, Luzifer - Religionsgeschichtliche und theologische Grundlagen: Dieses Kapitel analysiert die Genese und Entwicklung der Teufelsfigur in monotheistischen Religionen, insbesondere im Judentum und Christentum. Es werden die Funktionen und Bedeutungen des Teufels im Tanach und im Neuen Testament untersucht, sowie die Entwicklung der Teufelsfigur im abendländischen Mittelalter. Das Kapitel liefert einen detaillierten Hintergrund, um die Abwesenheit einer vergleichbaren Figur in polytheistischen Religionen im späteren Vergleich zu kontrastieren.
4. Die Absenz des „personifizierten Bösen“ in polytheistischen Religionen: Dieses Kapitel untersucht die Konzepte des Bösen in ausgewählten polytheistischen Religionen, wie der griechischen, römischen und ägyptischen Mythologie. Es werden die relevanten Mythen und Überlieferungen analysiert, um herauszufinden, wie das Böse in diesen Religionen konzipiert und dargestellt wird. Der Fokus liegt auf dem Vergleich mit den monotheistischen Konzepten des Bösen, um die Abwesenheit einer zentralen, personifizierten bösen Gestalt zu erklären. Die Kapitel 4.1 und 4.2 gehen im Detail auf die jeweiligen Mythologien ein.
Schlüsselwörter
Personifiziertes Böses, Polytheismus, Monotheismus, Teufel, Satan, Luzifer, Griechische Mythologie, Römische Mythologie, Ägyptische Mythologie, Religionsgeschichte, Theologie, Vergleichende Religionswissenschaft, Ambivalenz des Bösen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Abwesenheit einer personifizierten bösen Gestalt in polytheistischen Religionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Abwesenheit einer personifizierten bösen Gestalt in polytheistischen Religionen im Vergleich zu monotheistischen Glaubensrichtungen. Sie analysiert die unterschiedlichen Konzepte des Bösen in diesen Religionen und ergründet die Gründe für die Abwesenheit einer zentralen Teufelsfigur in polytheistischen Mythen.
Welche Religionen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht monotheistische Religionen (insbesondere Judentum und Christentum) mit polytheistischen Religionen, wobei die griechische, römische und ägyptische Mythologie im Detail untersucht werden.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Ambivalenz des Bösen, die Entwicklung der Teufelsfigur in monotheistischen Religionen, die Konzeption des Bösen in der griechischen, römischen und ägyptischen Mythologie sowie eine vergleichende Analyse der Konzepte des Bösen in monotheistischen und polytheistischen Religionen.
Wie wird die Teufelsfigur in monotheistischen Religionen dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Genese und Entwicklung der Teufelsfigur (Satan, Teufel, Luzifer) im Judentum und Christentum, untersucht deren Funktionen und Bedeutungen im Tanach und Neuen Testament und beleuchtet deren Entwicklung im Mittelalter.
Wie wird das Böse in polytheistischen Religionen konzipiert?
Die Arbeit analysiert relevante Mythen und Überlieferungen der griechischen, römischen und ägyptischen Mythologie, um die Konzepte des Bösen in diesen Religionen zu verstehen und mit den monotheistischen Konzepten zu vergleichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Ambivalenz des Bösen, ein Kapitel zur Teufelsfigur in monotheistischen Religionen, ein Kapitel zur Abwesenheit einer personifizierten bösen Gestalt in polytheistischen Religionen (mit Unterkapiteln zu griechischer, römischer und ägyptischer Mythologie) und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Personifiziertes Böses, Polytheismus, Monotheismus, Teufel, Satan, Luzifer, Griechische Mythologie, Römische Mythologie, Ägyptische Mythologie, Religionsgeschichte, Theologie, Vergleichende Religionswissenschaft, Ambivalenz des Bösen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Warum gibt es in polytheistischen Religionen keine zentrale, personifizierte böse Gestalt wie in monotheistischen Religionen?
Welche Schwierigkeiten werden bei der Bearbeitung des Themas angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeit, dem Bösen einen eindeutigen Begriff zu verleihen, und die Ambivalenz des Bösen als komplexes Phänomen. Weiterhin wird die begrenzte wissenschaftliche Quellenlage zu diesem Thema angesprochen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist als vergleichende Untersuchung der Konzepte des Bösen in monotheistischen und polytheistischen Religionen angelegt, beginnend mit einer Einführung in die Thematik und einer Diskussion der Ambivalenz des Bösen, gefolgt von detaillierten Analysen der jeweiligen Religionen und abschliessend einer Schlussbetrachtung.
- Citar trabajo
- Stefanie Rosenkranz (Autor), 2015, Die Absenz des "personifizierten Bösen" in polytheistischen Religionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127675