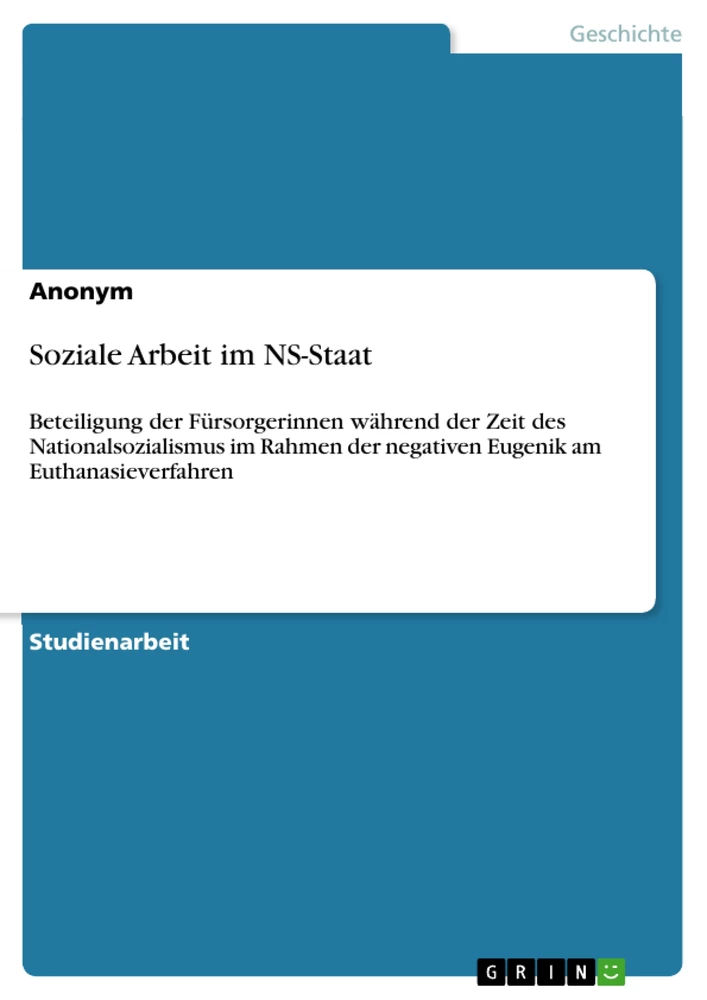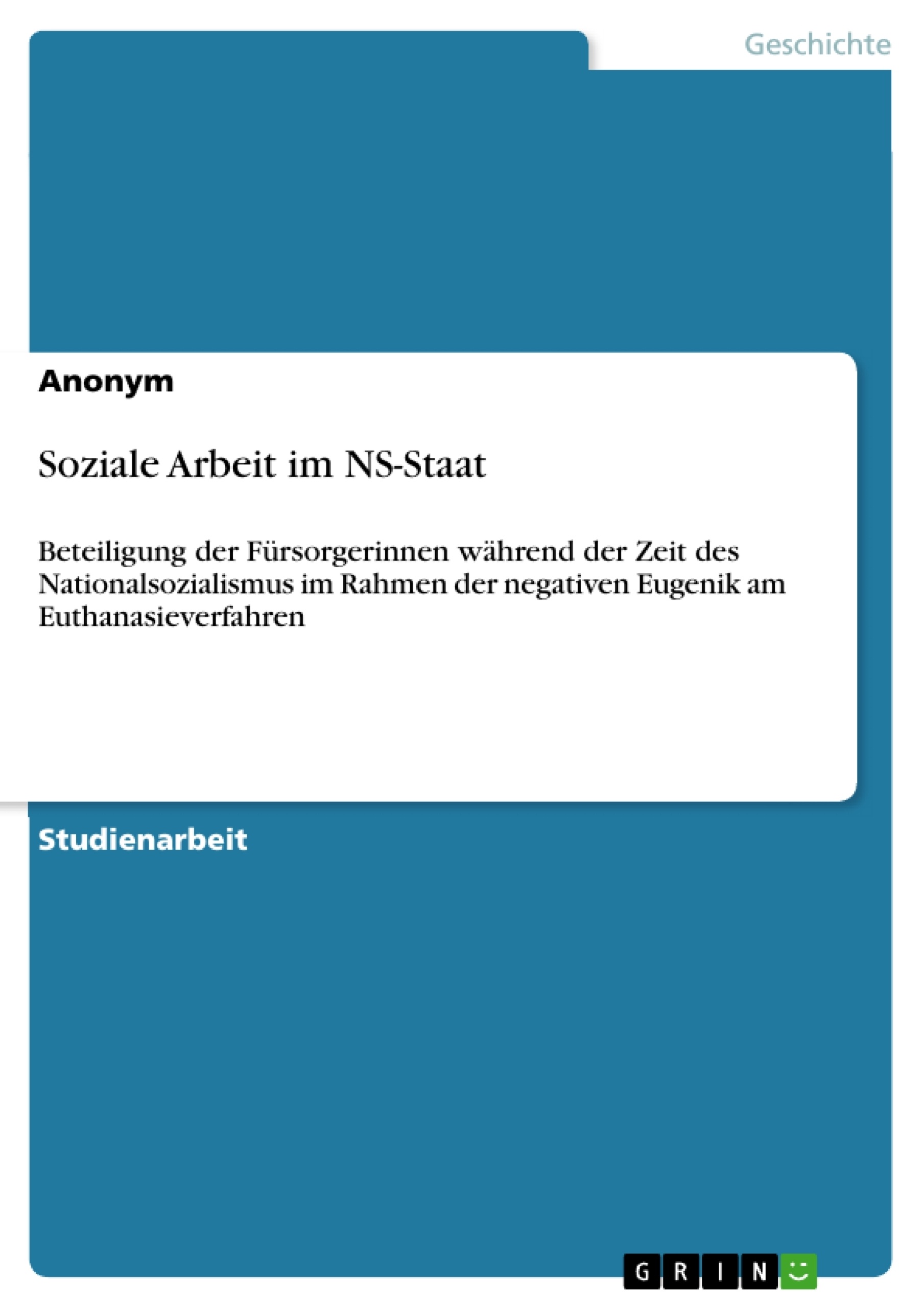In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen, welche im Jahr 1933 begann als Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde und 1945 mit der Kapitulation der Wehrmacht endete. Den bisherigen Wohlfahrtsstaat verwandelten die Nationalsozialisten in einen Volkswohlfahrtsstaat, wobei lediglich die Aspekte der Rassenhygiene erhalten geblieben sind und dazu dienen sollten, die »wertvollen brauchbaren« von den »unbrauchbaren« Menschen kategorisch zu trennen. In der Zeit des Nationalsozialismus kam es zu zahlreichen Euthanasieverfahren an verschiedenen, der NS-Ideologie nicht entsprechenden, sogenannten »lebensunwerten« Menschen, wie Anfangs mit dem Aspekt der Rassenhygiene erwähnt. Sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten täglich mit Menschen deren (sozialen) Probleme beispielsweise von (seelischen-) Behinderungen über Arbeits- und Wohnungslosigkeit bis hin zu Abhängigkeitserkrankungen reichen. Diese Menschen jedoch galten nach der NS-Ideologie als „Lebensunwerte“ (Münchmeier, 2014). Dementsprechend stelle ich die These auf, dass sich Fürsorgerinnen während der Zeit des Nationalsozialismus im Rahmen der negativen Eugenik am Euthanasieverfahren beteiligt haben. Demzufolge möchte ich Ihnen einen Ausblick über die folgenden Kapitel der Hausarbeit geben. Im zweiten Kapitel möchte ich mich einer kurzen Übersicht zur Volkspflege widmen, damit der weitere Verlauf der Hausarbeit verstanden werden kann, wobei sich ausführlichere Erläuterungen dessen im Anhang 1 und 2 befinden. Das dritte Kapitel soll von Gründen handeln, warum Fürsorgerinnen sich dem Nationalsozialismus anpassten. Das vierte Kapitel soll von den Aufgaben handeln, welche Fürsorgerinnen in der Zeit des Nationalsozialismus in ihrer Tätigkeit ausführten. Anschließend soll im fünften Kapitel ein Fazit der gesamten Erkenntnisse und ein Ausblick bezüglich der Hausarbeit gegeben werfen. Als Hinweis sei noch zu erwähnen: Diskriminierende oder ausgrenzende Begriffe des „Dritten Reiches“, welche die Verfasserin unter ausdrücklicher Distanzierung nutzt, werden in dieser Hausarbeit übernommen und kursiv in »eckigen Anführungszeichen« angeführt. Obwohl FürsorgerInnen 1933 in VolkspflegerInnen umbenannt wurden, wird aufgrund der begrifflichen Benutzung innerhalb der Hauptliteratur die Berufsbezeichnung „Fürsorgerin“ verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Die nationalsozialistische >> Volkspflege<<
- Warum sich Fürsorgerinnen dem sozialen Rassismus anpassten
- Aufgaben der FürsorgerInnen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rolle von Fürsorgerinnen im nationalsozialistischen Deutschland. Ziel ist es, die Anpassung von Fürsorgerinnen an den sozialen Rassismus der NS-Ideologie zu untersuchen und die Aufgaben, die sie in dieser Zeit ausübten, zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen des nationalsozialistischen Volkswohlfahrtsstaates auf die soziale Arbeit und die Gründe, warum sich Fürsorgerinnen dieser Ideologie unterordneten.
- Die nationalsozialistische »Volkspflege« und die Transformation des Wohlfahrtswesens
- Die Anpassung von Fürsorgerinnen an die NS-Ideologie und ihre Gründe
- Die Aufgaben von Fürsorgerinnen im Kontext der »Volksgemeinschaft«
- Die Rolle der Eugenik und Rassenhygiene in der sozialen Arbeit
- Die Folgen der NS-Ideologie für die soziale Arbeit und die Klienten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Situation des Wohlfahrtsstaates im nationalsozialistischen Deutschland. Das zweite Kapitel widmet sich der »Volkspflege«, der nationalsozialistischen Interpretation des Wohlfahrtswesens, und beschreibt ihre Ziele und Methoden. Im dritten Kapitel werden verschiedene Gründe untersucht, warum Fürsorgerinnen sich dem sozialen Rassismus der Nationalsozialisten anpassten, darunter die schwierigen Arbeitsbedingungen und der Druck der NS-Propaganda.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Fürsorgerinnen, Volkspflege, Nationalsozialismus, Eugenik, Rassenhygiene, Volksgemeinschaft, soziale Arbeit, Wohlfahrtsstaat, Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen
Was verstand man im Nationalsozialismus unter „Volkspflege“?
Die „Volkspflege“ war die NS-Interpretation der Wohlfahrt, die darauf abzielte, „wertvolle“ von „unbrauchbaren“ Menschen nach rassenhygienischen Kriterien zu trennen.
Beteiligten sich Fürsorgerinnen an den Euthanasieverfahren?
Die Arbeit stellt die These auf, dass Fürsorgerinnen im Rahmen der negativen Eugenik aktiv an der Selektion und den Verfahren beteiligt waren.
Warum passten sich soziale Fachkräfte der NS-Ideologie an?
Gründe waren unter anderem schwierige Arbeitsbedingungen nach der Weltwirtschaftskrise, der Druck der NS-Propaganda und die Umstrukturierung des Wohlfahrtsstaates.
Was änderte sich für die Klienten der Sozialen Arbeit nach 1933?
Menschen mit Behinderungen, Abhängigkeitserkrankungen oder Obdachlose galten plötzlich als „lebensunwert“ und wurden systematisch diskriminiert oder verfolgt.
Wie wurden Fürsorgerinnen im NS-Staat offiziell genannt?
Im Jahr 1933 erfolgte eine Umbenennung der Berufsbezeichnung von Fürsorgerin in „Volkspflegerin“.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Soziale Arbeit im NS-Staat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127111