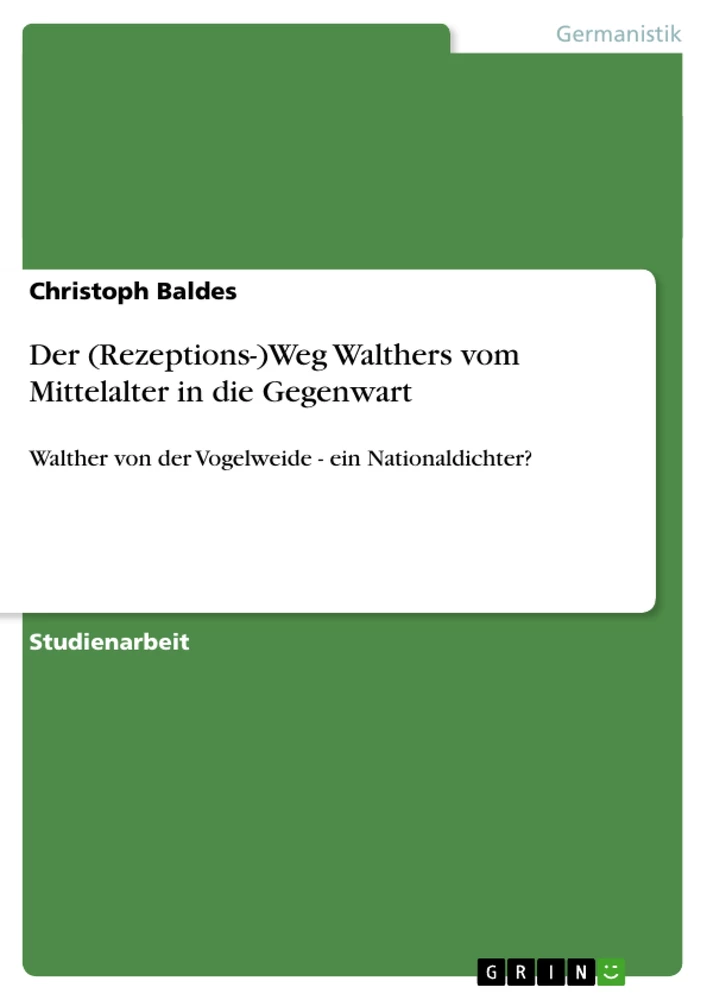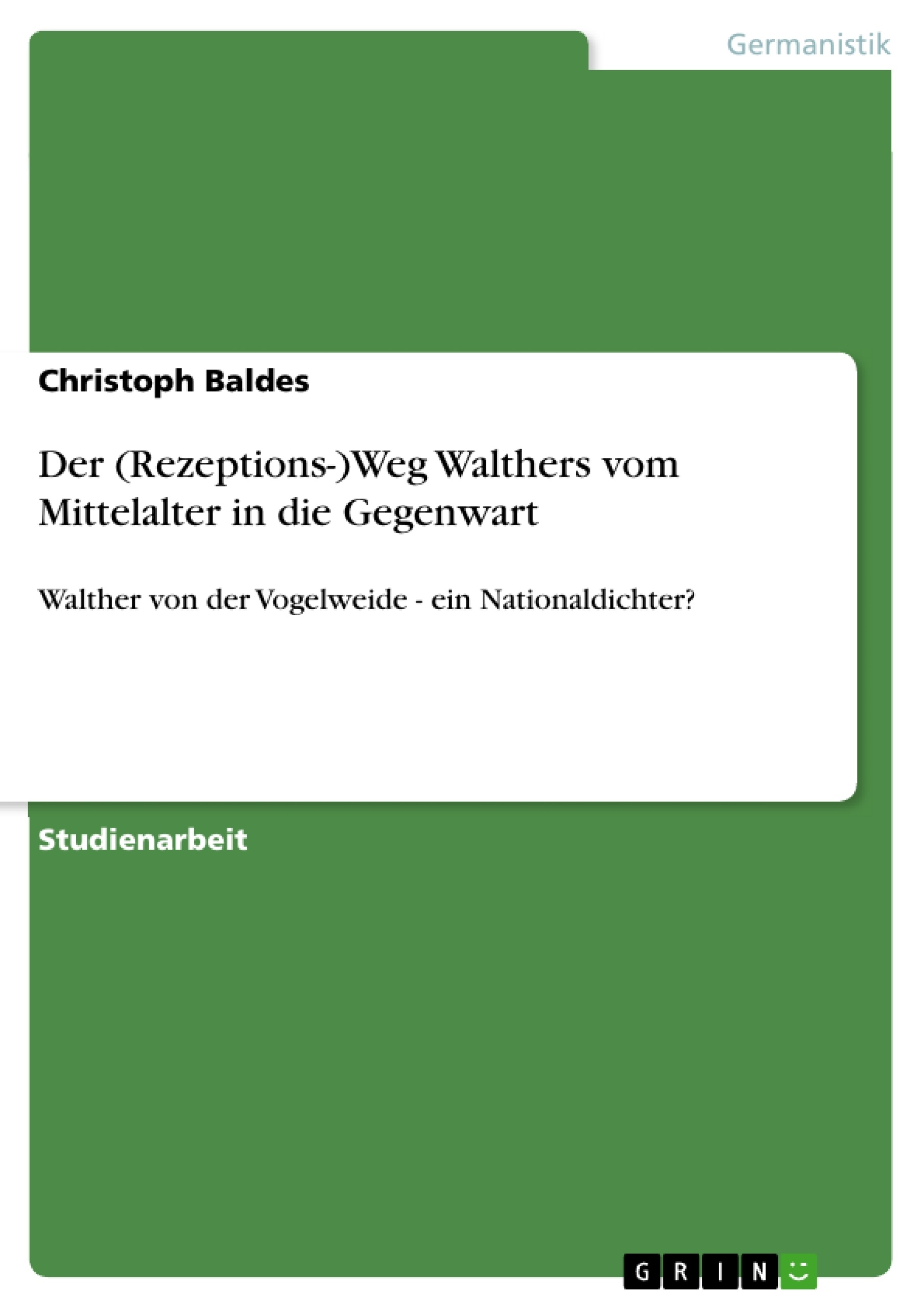Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem der bedeutendsten Sänger und Dichter des Mittelalters, Walther von der Vogelweide. Man weiß nur sehr wenig über sein Leben, Lebenszeugnisse existieren kaum. Klar ist: Walther verbrachte sein Leben als „fahrender Berufssänger“ (Verfasserlexikon, 670). Seine Lebensdaten werden auf die Zeit zwischen 1170 und 1230 rekonstruiert. Weiter lässt sich mit einiger Sicherheit annehmen, dass er aus dem ministerialen Stand stammt; eine niedere Ritterherkunft ohne Rechtsansprüche ist ebenfalls nicht auszuschließen. Auch unklar ist seine Herkunft. Während sich die Südtiroler sicher sind, dass Walther einer der ihren war, erheben gleichzeitig Franken, Böhmen, Thurgauer und selbst Schweizer „Anspruch“ auf Walther. [...] Wie oben in der Kurzbiographie zu sehen, ist nur wenig über die Person und das Leben Walthers bekannt. Die Wissenschaft ist viel auf Vermutungen und zweifelhafte Überlieferungen angewiesen. Trotzdem ist Walther wohl einer der bekanntesten Schriftsteller Deutschlands: Jeder Schüler dürfte seinen Namen schon einmal gehört haben. Bemerkenswert ist dabei die Kontinuität, mit der Walther über viele Jahre, vielleicht sogar Generationen hinweg seinen Weg immer wieder in die Schulbücher findet: Er ist keine „Modeerscheinung“. Von angesehenen Wissenschaftlern wird er gar als „Sänger des Reiches“ tituliert (vgl. Richter). Dabei kommt die Frage auf, warum wir nur so wenig über ihn wissen, wenn er wirklich so populär ist. Aus diesem Grund beschäftigt sich diese Hausarbeit mit dem Weg der Waltherrezeption, angefangen zu seinen Lebzeiten bis hin in die heutige Zeit. [...] Die Walther-Rezeption ist in dieser Arbeit in fünf Phasen unterteilt, die größtenteils ideologisch gekennzeichnet sind: Angefangen im Mittelalter, arbeitet sie sich über Aufklärung, Nationalismus und Nationalsozialismus in die Gegenwart vor. Dabei kann die Arbeit nicht dem Anspruch gerecht werden, jede Epoche bis ins letzte Detail darzustellen. Vielmehr soll sie einen allgemeinen Überblick liefern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Der Sangspruchdichter Walther von der Vogelweide: Kurzbiographie
- 1.2 Hinführung zum Thema
- 1.3 Vorgehen bei der Untersuchung
- 2. Die Veränderungen des Werkes Walthers im Laufe seiner Rezeptionsgeschichte
- 2.1 Walther im Mittelalter
- 2.1.1 Walther am Anfang seiner Rezeptionsgeschichte
- 2.1.2 Erste Veränderungen am Werk Walthers: Die Meistersinger
- 2.2 Walther im Zeitalter der Aufklärung
- 2.3 Walther im Zeitalter des Nationalismus
- 2.4 Walther im Zeitalter des Nationalsozialismus
- 2.5 Walther in der Gegenwart
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte des Werkes Walther von der Vogelweides vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Ziel ist es, die Veränderungen des Walther-Bildes im Laufe der Zeit aufzuzeigen und die jeweiligen ideologischen Einflüsse auf die Interpretation seiner Werke zu beleuchten. Die Untersuchung konzentriert sich auf die wichtigsten Phasen der Rezeption und ausgewählte Vertreter dieser Epochen.
- Entwicklung des Walther-Bildes über verschiedene Epochen
- Einfluss ideologischer Strömungen auf die Interpretation von Walthers Werk
- Veränderungen in der Wertschätzung von Minnesang und Sangspruchdichtung
- Die Rolle Walthers in der nationalen Identität Deutschlands
- Die Bedeutung von Walthers Werk für die Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel bietet eine kurze Biographie Walther von der Vogelweides, da über sein Leben nur wenig bekannt ist. Es skizziert sein Leben als fahrender Sänger, seine möglichen sozialen Wurzeln und die Unsicherheiten bezüglich seiner Herkunft. Das Kapitel führt das Thema der Rezeptionsgeschichte ein, die sich mit der Frage auseinandersetzt, warum Walther trotz spärlicher biografischer Informationen so populär ist. Es erläutert die Methode der Arbeit, die die Rezeption in fünf ideologisch geprägte Phasen unterteilt: Mittelalter, Aufklärung, Nationalismus, Nationalsozialismus und Gegenwart.
2. Die Veränderungen des Werkes Walthers im Laufe seiner Rezeptionsgeschichte: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und untersucht die Rezeption Walthers in verschiedenen historischen Epochen. Es beginnt mit einer Betrachtung der Rezeption im Mittelalter, die zunächst sehr spärlich war und sich auf wenige Verse beschränkte, bevor sie sich im späten Mittelalter fast ganz verlor. Die folgenden Abschnitte widmen sich der Aufklärung, dem Nationalismus, dem Nationalsozialismus und schließlich der Gegenwart. Für jede Epoche werden wichtige Vertreter der Walther-Rezeption vorgestellt, um die jeweiligen Tendenzen und Probleme aufzuzeigen. Das Kapitel hebt die Schwierigkeit hervor, die umfangreiche Walther-Forschung der Gegenwart umfassend darzustellen.
2.1 Walther im Mittelalter: Der Abschnitt analysiert die frühe Rezeption von Walthers Werk, die durch fehlende Niederschriften und die damit verbundene beschränkte Verbreitung seiner Dichtungen gekennzeichnet war. Trotz der Seltenheit von Handschriften erreichte Walther schon zu seinen Lebzeiten und im darauf folgenden Mittelalter große Bekanntheit, wie Thomasin von Zerclaeres Erwähnung belegt. Sein "Minne-Wettstreit" mit Reinmar von Hagenau und die Anerkennung durch Gottfried von Straßburg und Wolfram von Eschenbach trugen maßgeblich zu seinem Ruhm bei. Die zunehmende Bedeutung seiner Spruchdichtung im Vergleich zum Minnesang wird ebenfalls thematisiert.
2.1.2 Erste Veränderungen am Werk Walthers: Die Meistersinger: Dieser Abschnitt behandelt die Übernahme von Walthers Werk durch die Meistersinger. Sie integrierten seine Melodien in ihre eigenen Texte, wobei die originale Überlieferung der Strophenschemata nicht immer beibehalten wurde. Die Adaption durch die Meistersinger zeigt die anhaltende Relevanz von Walthers Werk auch in einer sich verändernden kulturellen Landschaft, die vom Aufkommen eines städtischen Bürgertums geprägt war. Die Meistersinger repräsentieren also eine Transformation der ursprünglichen Form, die die Anpassung an neue ästhetische und gesellschaftliche Standards verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Walther von der Vogelweide, Rezeptionsgeschichte, Minnesang, Sangspruchdichtung, Mittelalter, Aufklärung, Nationalismus, Nationalsozialismus, Gegenwart, Literaturgeschichte, Ideologie, Interpretation.
FAQ: Rezeptionsgeschichte des Werkes Walther von der Vogelweides
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte des Werkes Walther von der Vogelweides vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Das Ziel ist es, die Veränderungen des Walther-Bildes im Laufe der Zeit aufzuzeigen und die ideologischen Einflüsse auf die Interpretation seiner Werke zu beleuchten.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Walther-Bildes über verschiedene Epochen (Mittelalter, Aufklärung, Nationalismus, Nationalsozialismus, Gegenwart), den Einfluss ideologischer Strömungen auf die Interpretation seines Werkes, Veränderungen in der Wertschätzung von Minnesang und Sangspruchdichtung, die Rolle Walthers in der nationalen Identität Deutschlands und die Bedeutung seines Werkes für die Literaturgeschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Rezeptionsgeschichte in verschiedenen Epochen und eine Zusammenfassung. Die Einleitung umfasst eine Kurzbiographie Walthers, eine Hinführung zum Thema und die Beschreibung der Methodik. Das Hauptkapitel analysiert die Rezeption Walthers im Mittelalter (inkl. der Rolle der Meistersinger), der Aufklärung, des Nationalismus, des Nationalsozialismus und der Gegenwart. Jedes Kapitel widmet sich den wichtigsten Vertretern und Tendenzen der jeweiligen Epoche.
Wie wird die Rezeption im Mittelalter dargestellt?
Die Rezeption im Mittelalter wird als zunächst spärlich, dann aber durch die Anerkennung durch bedeutende Persönlichkeiten wie Thomasin von Zerclaeres, den "Minne-Wettstreit" mit Reinmar von Hagenau und die Anerkennung durch Gottfried von Straßburg und Wolfram von Eschenbach gekennzeichnet beschrieben. Die zunehmende Bedeutung seiner Spruchdichtung im Vergleich zum Minnesang wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen die Meistersinger?
Die Meistersinger werden als wichtige Akteure in der Transformation des Werkes Walthers dargestellt. Sie integrierten seine Melodien in eigene Texte, wobei die originale Überlieferung der Strophenschemata nicht immer beibehalten wurde. Ihre Adaption zeigt die anhaltende Relevanz von Walthers Werk in einer sich verändernden kulturellen Landschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Walther von der Vogelweide, Rezeptionsgeschichte, Minnesang, Sangspruchdichtung, Mittelalter, Aufklärung, Nationalismus, Nationalsozialismus, Gegenwart, Literaturgeschichte, Ideologie, Interpretation.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit unterteilt die Rezeptionsgeschichte in fünf ideologisch geprägte Phasen: Mittelalter, Aufklärung, Nationalismus, Nationalsozialismus und Gegenwart. Diese Einteilung dient der Analyse der jeweiligen Einflüsse auf die Interpretation von Walthers Werk.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Veränderungen des Walther-Bildes im Laufe der Zeit auf und beleuchtet die jeweiligen ideologischen Einflüsse auf die Interpretation seiner Werke. Sie verdeutlicht, wie die Rezeption von Walthers Werk eng mit den jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontexten verknüpft ist.
- Citation du texte
- Christoph Baldes (Auteur), 2002, Der (Rezeptions-)Weg Walthers vom Mittelalter in die Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112678