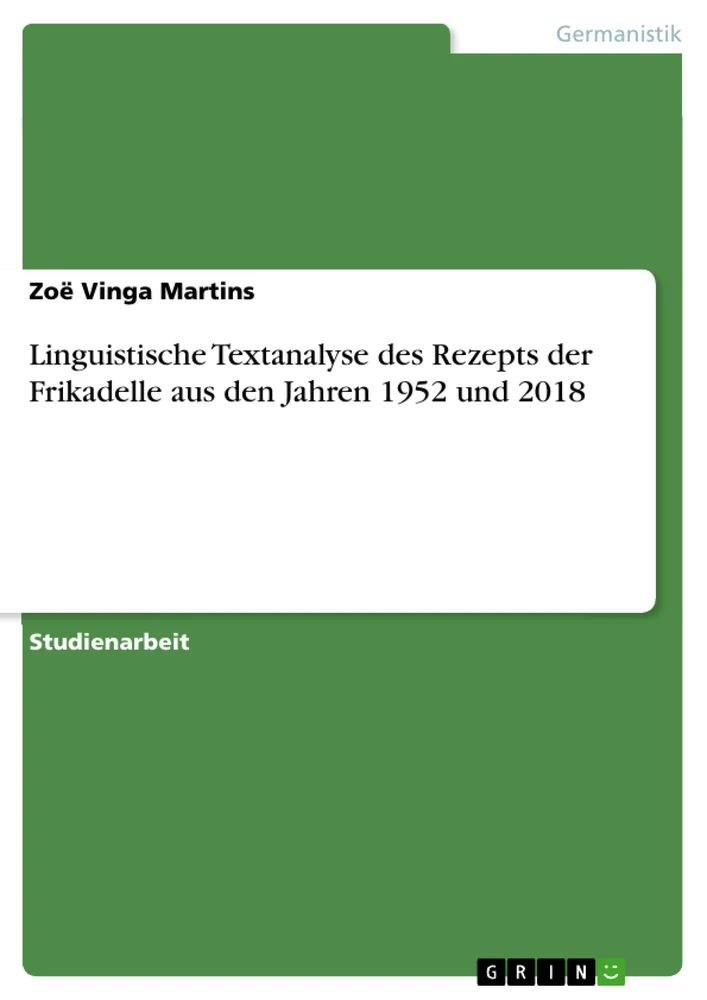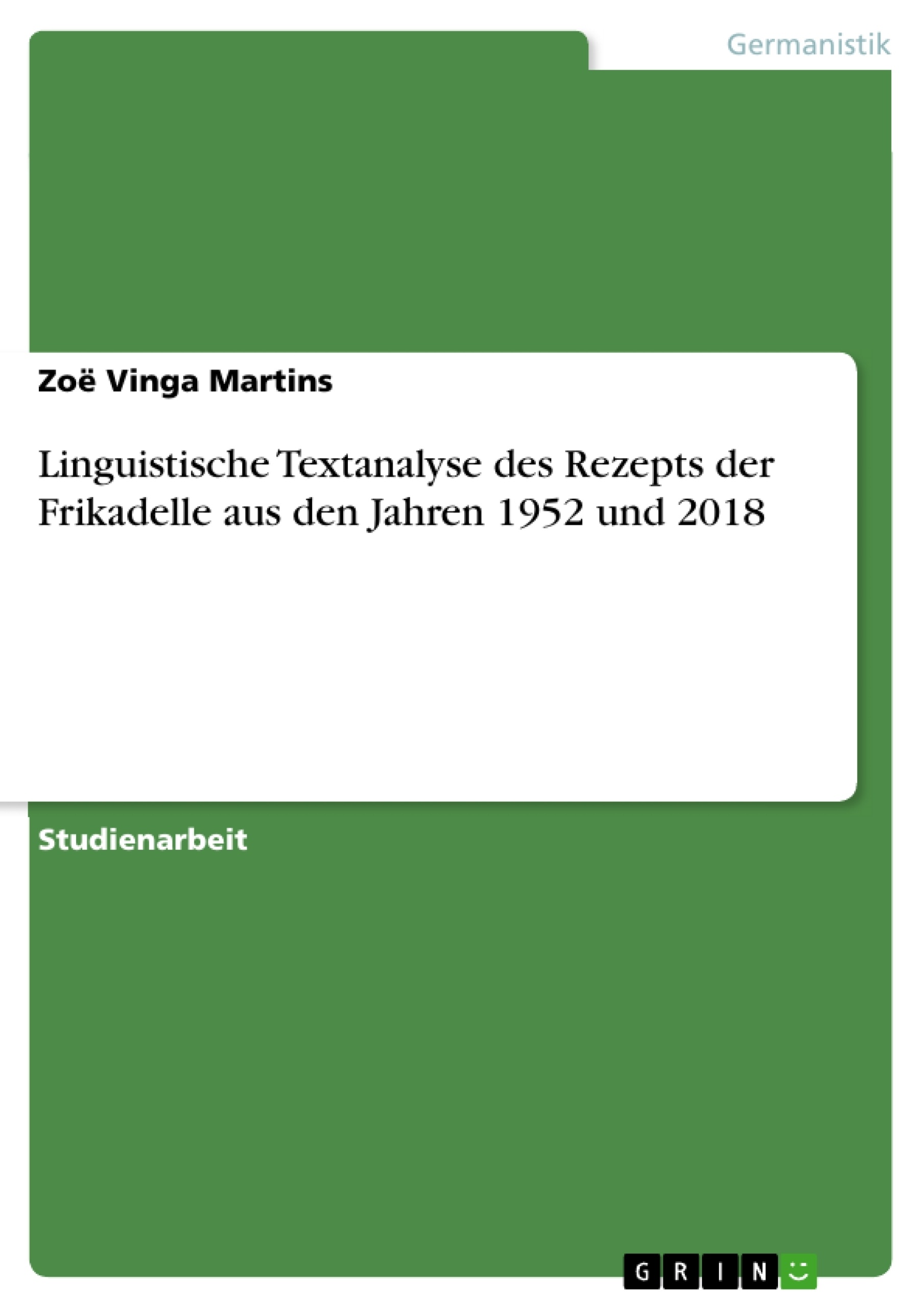Sprache ist das Werkzeug der Menschen, um Gedanken zu formulieren, sich mitzuteilen und damit Teil der Gesellschaft zu sein. Dass die Welt in einem ständigen Wandel steht, liegt an der sich ständig wandelnden Mentalität der Menschen. Diese Mentalität ist über Sprache ersichtlich und durch Texte festgehalten. Um die Entwicklung der Gesellschaft mitsamt ihren Ansichten und Denkweisen untersuchen und nachvollziehen zu können, ist die Entwicklung der Sprache zu untersuchen. Diese Entwicklung ist in Texten der jeweiligen Zeit festgehalten.
Ein Kochrezept stellt beispielhaft einen solchen Text dar, der dieser Sprachdynamik unterliegt. Kochrezepte bilden einen festen Bestandteil des Alltags. Somit lassen sich Rückschlüsse auf eben diesen Alltag ziehen. Sie geben Einblicke in das Verhältnis zwischen Emittenten und Rezipienten, die Beziehung zu Essen, zur Verfügung stehende Lebensmittel, die ideale Ernährungsweise und vieles mehr. Die Linguistik enthält schon seit den 1960er Jahren die Untersuchung von Texten und Textsorten. Kochrezepte sind dabei vereinzelt vertreten, bilden jedoch eine Minderheit, vergleichende Analysen fehlen vollständig. Deshalb ist die folgende Arbeit von wissenschaftlicher Bedeutung. Die Analyse erfolgt nach Klaus Brinker, der ein umfangreiches Mehrebenenmodell ausgearbeitet hat, welches sich aufgrund seiner Tiefe ideal für diese Arbeit eignet.
In dieser Arbeit liegt der Fokus auf zwei Beispielen für Kochrezepte: Das Rezept "Bratklopse" aus dem Jahr 1952 und das Rezept "Frikadellen" aus dem Jahr 2018. Beide Rezepte entstammen allgemeinen Kochbüchern. Dadurch lassen sie sich sehr gut miteinander vergleichen. Die Analyse bezieht ansatzweise die Bildlichkeit mit ein. Der Umfang dieser Arbeit lässt nur zwei Beispiele und eine grundlegende Erläuterung des Mehrebenenmodells zu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung und Inhalte der Textlinguistik
- 3. Das Phänomen Text
- 3.1 Textdefinition
- 3.2 Textsorten
- 3.3 Textmuster
- 3.4 Bedeutung der bisherigen Erkenntnisse für die Textsorte Kochrezept
- 4. Bisherige Erkenntnisse der Sprachwissenschaft zur Sprache in Kochrezepten
- 5. Das Mehrebenenmodell zur Textanalyse nach Brinker
- 6. Eine Analyse der Rezepte „Bratklopse“ und „Frikadellen“
- 6.1 Bratklopse
- 6.1.1 Funktionsebene
- 6.1.2 Thematische Ebene
- 6.1.3 Grammatische Ebene
- 6.2 Frikadellen
- 6.2.1 Funktionsebene
- 6.2.2 Thematische Ebene
- 6.2.3 Grammatische Ebene
- 6.1 Bratklopse
- 7. Vergleich der Analysen
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die sprachliche Entwicklung in Kochrezepten anhand eines Vergleichs zwischen einem Rezept für "Bratklopse" aus dem Jahr 1952 und einem Rezept für "Frikadellen" aus dem Jahr 2018. Ziel ist es, die Dynamik der Sprache im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen aufzuzeigen und die Anwendbarkeit des Mehrebenenmodells nach Brinker auf die Textsorte Kochrezept zu demonstrieren.
- Sprachwandel im Kontext von Kochrezepten
- Anwendungsbeispiel des Mehrebenenmodells nach Brinker
- Vergleichende Textanalyse zweier Rezepte unterschiedlicher Epochen
- Entwicklung der Textsorte Kochrezept
- Sprachliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Kochrezepten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Dynamik ein und argumentiert, dass die Analyse von Kochrezepten als Texte Aufschluss über gesellschaftliche Entwicklungen gibt. Sie begründet die wissenschaftliche Relevanz der Arbeit aufgrund der bisher fehlenden vergleichenden Analysen von Kochrezepten und kündigt den methodischen Ansatz (Mehrebenenmodell nach Brinker) und den Fokus auf zwei Rezepte an. Die Einleitung legt den Fokus auf die Verwendung von Sprache als Spiegelbild der Gesellschaft und die Notwendigkeit, Sprachentwicklung durch Textanalyse zu untersuchen. Kochrezepte werden als geeigneter Textkörper ausgewählt, da sie einen festen Bestandteil des Alltags bilden und Einblicke in verschiedene gesellschaftliche Bereiche bieten.
2. Die Entstehung und Inhalte der Textlinguistik: Dieses Kapitel bietet einen knappen Überblick über die Entstehung und die zentralen Inhalte der Textlinguistik. Es wird der Paradigmenwechsel in der Sprachwissenschaft in den 1960er und 1970er Jahren beschrieben, der von einer systemorientierten hin zu einer kommunikations- und funktionsbezogenen Sprachbetrachtung führte. Die Bedeutung des kommunikativen Kontextes für die Textinterpretation wird hervorgehoben, und die Interdisziplinarität der Textlinguistik wird betont. Zentrale Fragen der Textlinguistik wie das Wesen und die Struktur von Texten werden angesprochen, um den theoretischen Rahmen für die folgende Analyse zu legen. Die Entwicklung der Textlinguistik wird als notwendig für das Verständnis von Texten und deren Kontext beschrieben, was die Grundlage für die spätere Analyse bildet.
3. Das Phänomen Text: Dieses Kapitel erläutert den Begriff "Text" und führt die Konzepte "Textsorte" und "Textmuster" ein. Es betont die Bedeutung des Kontextverständnisses für die Textanalyse, wobei die Definition von Text nach Brinker im Mittelpunkt steht: ein kohärenter, von einem Emittenten erzeugter Zeichenfolgen mit einer erkennbaren kommunikativen Funktion. Der Kapitel beschreibt die grammatische und thematische Ebene der Textanalyse, mit Fokus auf Kohärenzbedingungen und die verschiedenen Arten der thematischen Entfaltung. Wichtig ist die Betonung des Kontextes, sowohl innerhalb des Textes selbst als auch im gesellschaftlichen Kontext. Die Unterscheidung zwischen expliziter und impliziter Wiederaufnahme von Themen und die Rolle von Konjunktionen und Adverbien werden erklärt.
4. Bisherige Erkenntnisse der Sprachwissenschaft zur Sprache in Kochrezepten: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text enthält keine Informationen über den Inhalt dieses Kapitels. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
5. Das Mehrebenenmodell zur Textanalyse nach Brinker: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text enthält keine detaillierte Beschreibung des Mehrebenenmodells. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden, außer dass das Kapitel das Modell erklärt, welches für die Analyse in Kapitel 6 verwendet wird.)
Schlüsselwörter
Textlinguistik, Kochrezepte, Sprachwandel, Mehrebenenmodell (Brinker), Textsortenanalyse, Kommunikation, Kohärenz, Thematische Ebene, Grammatische Ebene, Rezeptvergleich, 1952, 2018, Bratklopse, Frikadellen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Kochrezepten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sprachliche Entwicklung in Kochrezepten anhand eines Vergleichs zwischen einem Rezept für "Bratklopse" aus dem Jahr 1952 und einem Rezept für "Frikadellen" aus dem Jahr 2018. Der Fokus liegt auf der Dynamik der Sprache im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und der Anwendbarkeit des Mehrebenenmodells nach Brinker auf die Textsorte Kochrezept.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet das Mehrebenenmodell nach Brinker zur Textanalyse. Diese Methode erlaubt die Betrachtung des Textes auf verschiedenen Ebenen (funktionale, thematische und grammatische Ebene), um ein umfassendes Verständnis der sprachlichen Gestaltung zu erreichen. Ein vergleichender Ansatz wird angewendet, um die sprachlichen Unterschiede zwischen den beiden Rezepten zu identifizieren und zu interpretieren.
Welche Texte werden analysiert?
Analysiert werden zwei Kochrezepte: ein Rezept für "Bratklopse" aus dem Jahr 1952 und ein Rezept für "Frikadellen" aus dem Jahr 2018. Der zeitliche Abstand zwischen den Rezepten soll den Sprachwandel über einen längeren Zeitraum verdeutlichen.
Welche Ebenen werden bei der Textanalyse betrachtet?
Die Analyse betrachtet die Funktionsebene (Kommunikativer Zweck des Textes), die thematische Ebene (Entwicklung und Kohärenz der Themen) und die grammatische Ebene (sprachliche Strukturen und Mittel) der beiden Rezepte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Entstehung und Inhalte der Textlinguistik, Das Phänomen Text, Bisherige Erkenntnisse der Sprachwissenschaft zur Sprache in Kochrezepten, Das Mehrebenenmodell nach Brinker, Analyse der Rezepte "Bratklopse" und "Frikadellen", Vergleich der Analysen und Fazit. Die Kapitel behandeln die theoretischen Grundlagen, die Methodik und die Ergebnisse der Analyse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Sprachwandel in Kochrezepten aufzuzeigen und die Anwendbarkeit des Mehrebenenmodells nach Brinker auf diese Textsorte zu demonstrieren. Die Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis der Beziehung zwischen Sprache und gesellschaftlichen Veränderungen leisten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Textlinguistik, Kochrezepte, Sprachwandel, Mehrebenenmodell (Brinker), Textsortenanalyse, Kommunikation, Kohärenz, Thematische Ebene, Grammatische Ebene, Rezeptvergleich, 1952, 2018, Bratklopse, Frikadellen.
Welche Aspekte des Sprachwandels werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Sprachwandel im Kontext von Kochrezepten, indem sie die sprachlichen Unterschiede zwischen den beiden Rezepten aus unterschiedlichen Epochen analysiert. Dies umfasst Veränderungen in der Wortwahl, im Satzbau und in der kommunikativen Gestaltung.
- Quote paper
- Zoë Vinga Martins (Author), 2019, Linguistische Textanalyse des Rezepts der Frikadelle aus den Jahren 1952 und 2018, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119767