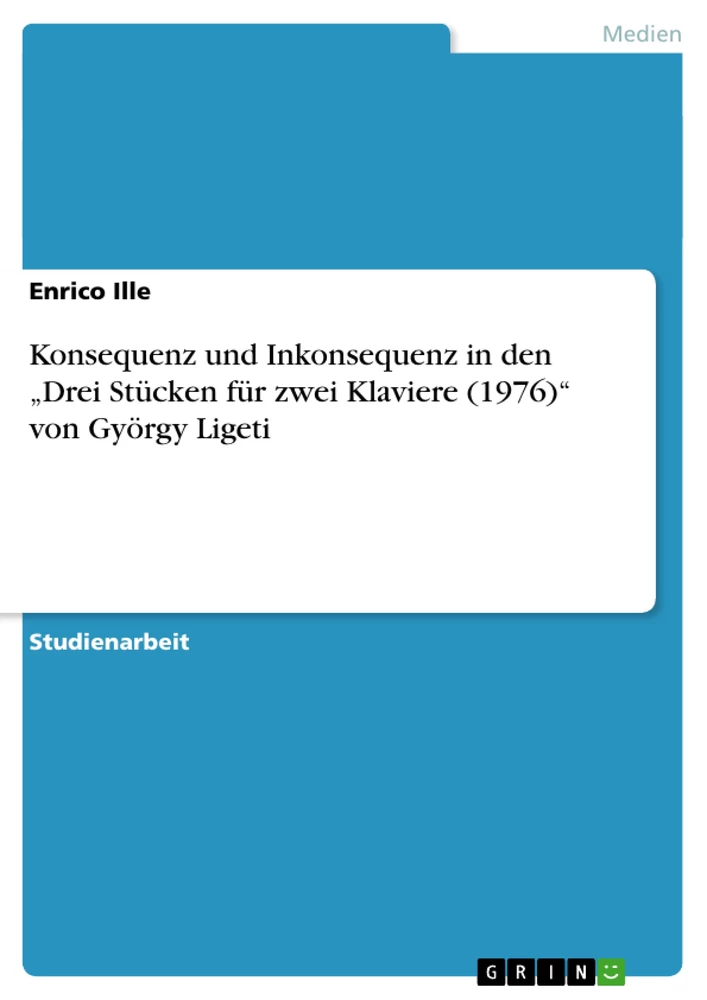Die Drei Stücke für zwei Klaviere haben bereits die Abhandlung in drei verschiedenen Größenordnungen hinter sich: Zum Ersten durch die kurze Einführung, die Ligeti selbst zu dem Stück geschrieben hat, zum Zweiten durch die musiktheoretische Analyse von Reinhard Febel (1978) und zum Dritten durch die ausgedehnte Gesamtanalyse von Stephen Ferguson (1994). Hinzu kommen Behandlungen am Rande oder von Einzelteilen, wie etwa von Herman Sabbe (1987), bei Constantin Floros (1996) und bei Marina Lobanova (2002).
Wegen der teilweisen Akribie in den bisherigen Analysen der Stücke liegt daher die Beschäftigung mit einem spezifischen Aspekt nahe. Der Gedanke, sich über die Frage nach konsequenter Umsetzung vorgegebener Konzeptionen und postulierter Einflüsse den Stücken anzunähern, entstand auf Grund einer Äußerung des Komponisten:
„Beim Komponieren geht es wie in der wissenschaftlichen Forschung auch darum, einer Fragestellung systematisch nachzugehen. Das funktioniert in der Kunst nicht wie in der Wissenschaft, trotzdem sehe ich Analogien, wie man zu bestimmten Lösungen kommt.“[1]
Die Herangehensweise, sich durch das Komponieren einer selbstgestellten Aufgabe bzw. einem Problem zu stellen und deren Lösung anzustreben, ist sicherlich jedem Komponisten mehr oder weniger bekannt, ist es doch ein wesentlicher Bestandteil kreativen Daseins, sich das Leben schwer zu machen. Dass das nicht allein ein Wesenszug romantischen Künstlertums und seiner Tradition ist, zeigt nicht zuletzt Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“.
Seine zweischneidige Herkunft sowohl aus einem amateur-wissenschaftlichen Umfeld im Elternhaus als auch aus früher musikbezogener Tätigkeit führt bei Ligeti jedoch den Aspekt Problemlösungs-orientierten Komponierens über die Stufe eines allgemeinen Wesenszuges weit hinaus.
Nicht zuletzt umfangreiche Erklärungen und eigens definierte Begrifflichkeiten wie „Entfaltungsform“ bzw. „Bewegungsform“, „Webetechnik“ oder „Gitterüberlagerung“ zeigen das tiefverwurzelte Bedürfnis, das eigene künstlerische Schaffen auch auf vorrangig rationaler Ebene zu artikulieren und erfahrbar zu machen. Wie zutreffend diese Verwortlichungen oft genug sind, ist zumindestens für die Frage des Durchdachtseins sehr aufschlussreich, ohne dass sie zu einer Unterbewertung der ebenso oft überwiegenden irrationalen Elemente führen sollten, die Ligetis Äußerungen letztlich zumeist eher kreativ-assoziativ als analytisch-wissenschaftlich werden lassen. [...]
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Monument
2. Selbstporträt mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei)
3. In zart fließender Bewegung
Quellenverzeichnis
Einleitung
Die Drei Stücke für zwei Klaviere haben bereits die Abhandlung in drei verschiedenen Größenordnungen hinter sich: Zum Ersten durch die kurze Einführung, die Ligeti selbst zu dem Stück geschrieben hat, zum Zweiten durch die musiktheoretische Analyse von Reinhard Febel (1978) und zum Dritten durch die ausgedehnte Gesamtanalyse von Stephen Ferguson (1994). Hinzu kommen Behandlungen am Rande oder von Einzelteilen, wie etwa von Herman Sabbe (1987), bei Constantin Floros (1996) und bei Marina Lobanova (2002).
Wegen der teilweisen Akribie in den bisherigen Analysen der Stücke liegt daher die Beschäftigung mit einem spezifischen Aspekt nahe. Der Gedanke, sich über die Frage nach konsequenter Umsetzung vorgegebener Konzeptionen und postulierter Einflüsse den Stücken anzunähern, entstand auf Grund einer Äußerung des Komponisten:
„Beim Komponieren geht es wie in der wissenschaftlichen Forschung auch darum, einer Fragestellung systematisch nachzugehen. Das funktioniert in der Kunst nicht wie in der Wissenschaft, trotzdem sehe ich Analogien, wie man zu bestimmten Lösungen kommt.“[1]
Die Herangehensweise, sich durch das Komponieren einer selbstgestellten Aufgabe bzw. einem Problem zu stellen und deren Lösung anzustreben, ist sicherlich jedem Komponisten mehr oder weniger bekannt, ist es doch ein wesentlicher Bestandteil kreativen Daseins, sich das Leben schwer zu machen. Dass das nicht allein ein Wesenszug romantischen Künstlertums und seiner Tradition ist, zeigt nicht zuletzt Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“.
Seine zweischneidige Herkunft sowohl aus einem amateur-wissenschaftlichen Umfeld im Elternhaus als auch aus früher musikbezogener Tätigkeit führt bei Ligeti jedoch den Aspekt Problemlösungs-orientierten Komponierens über die Stufe eines allgemeinen Wesenszuges weit hinaus.
Nicht zuletzt umfangreiche Erklärungen und eigens definierte Begrifflichkeiten wie „Entfaltungsform“ bzw. „Bewegungsform“, „Webetechnik“ oder „Gitterüberlagerung“ zeigen das tiefverwurzelte Bedürfnis, das eigene künstlerische Schaffen auch auf vorrangig rationaler Ebene zu artikulieren und erfahrbar zu machen. Wie zutreffend diese Verwortlichungen oft genug sind, ist zumindestens für die Frage des Durchdachtseins sehr aufschlussreich, ohne dass sie zu einer Unterbewertung der ebenso oft überwiegenden irrationalen Elemente führen sollten, die Ligetis Äußerungen letztlich zumeist eher kreativ-assoziativ als analytisch-wissenschaftlich werden lassen.
Sicherlich ist das hohe Maß an geistiger Durchdringung vor dem Hintergrund der Avantgarde in Köln, Darmstadt und Donaueschingen nichts Ungewöhnliches, für die Suche nach einem geeigneten Weg zur Annäherung an ein Werk Ligetis spielt das jedoch keine Rolle.
Nachbemerkung:
Für diese Arbeit lag die Publikation von Ferguson nicht vor, sodass sie als Bezugspunkt ebenso wie die Teile der Einführung von Ligeti, die nicht bei Constantin Floros zitiert sind, fehlen. Alle weiteren genannten Artikel wurden als Quellen benutzt.
1. Monument
Die gedankliche Grundlage, die hinter dem ersten der drei Stücke steht, benennt Ligeti in seiner Einführung folgendermaßen:
„Bei genauer Realisation der dynamischen Differenzierung erscheint die Musik, als wäre sie dreidimensional, wie ein Hologramm, das im imaginären Raum steht. Diese Raumillusion verleiht der Musik einen statuarischen, immobilen Charakter (= Monument).“[2]
Dahinter steht folgender Aufbau: Beginnend in Klavier I werden zweimal oktav-verstärkte Töne in leicht variierenden Abständen angeschlagen. Die Veränderungen der Zeitabstände zwischen den Anschlägen folgt dem zyklischen Muster erst einer Verlängerung, dann einer Verkürzung der dazwischenliegenden Pausen in Sechzehntelschritten, wobei es einen zentralen Abstand gibt, der schrittweise über- bzw. unterschritten wird. Jeder Zyklus besteht aus acht Anschlägen; die Tonhöhe wird dabei zu Beginn nicht verändert, ebenso wie die Lautstärke (ff).
Kurz vor Vollendung des ersten Zyklus tritt eine zweite Ebene in Klavier II hinzu, neben deren Bewegungsmuster dem gleichen Gesetz folgt, wenn auch mit einem halb so großen zentralen Abstand und in einem anderen Metrum (6/8 gegen 4/4 in Klavier I). Unterschiedlich in der Tonhöhe ergibt sich ein erster Klang; Lautstärke ist auch in Ebene II ff.
In ähnlicher Weise treten nach und nach vier weitere Ebenen mit jeweils unterschiedlichen zentralen Abständen, Tonhöhen und Lautstärken hinzu. Die dadurch bewirkte rhythmische und klangliche Verdichtung wird im weiteren Verlauf intensiviert, zum Einen durch die Verkürzung der zentralen Abstände auf allen Ebenen bis zur Sechzehntel, zum Anderen durch Ausdehnung der Lage in beide Richtungen. Dazu kommt eine fortschreitende Komplexität der dynamischen Unterschiede.
Am Schluss steht die Auflösung der rhythmischen, klanglichen und dynamischen Komplexität in verklingende Einzelton-Sechzehntel in höchster Lage.
Ligeti benutzt zur Beschreibung der Struktur dieses Vorgangs die Begriffe „Entfaltungsform / Bewegungsform“, wobei die damit gemeinte Entwicklung von einer einfachen Idee zu komplexer Verflechtung in einem großen Teil von Ligetis Kompositionen zur Anwendung kommt. Mag Ligeti erst im Zusammenhang mit den DSfzK[3] zu dieser Begriffsbildung gekommen sein, als spezifische Konzeptionsidee können sie nicht gesehen werden.
Vielmehr sind es zwei teils gegensätzliche Konzeptionen, von denen die erste, die „Entfaltungs- / Bewegungsform“, ein kompositionstechnische ist, die zweite, die Raumillusion, eine rezeptionstechnische. Auch diese beiden Elemente, nämlich ein intendiertes Hörergebnis und sein kompositorisches Erwirken, sind bei Ligeti häufig anzutreffen. Nur scheint in diesem Fall ein Widerspruch zwischen beiden vorzuliegen, wo sonst Kausalität vorherrscht.
Eine Kompositionsstruktur, die darauf ausgerichtet ist, eine spezifische Entwicklung umzusetzen, nämlich die Zunahme von Komplexität, beinhaltet eine Betonung der Zeitlichkeit des Werkes, denn Entwicklung kann nur in der Zeit stattfinden. Kompositionen, die den Eindruck von Räumlichkeit erzeugen, sind geprägt von stetigen Wiederholungen gleicher Elemente, Erzeugung eines tonalen Rahmens, dessen inneren Elemente ohne Veränderung des Ausdrucks anklingen, Auflösung einer die Zeit einteilenden Rhythmik u.Ä.. Sie arbeiten gerade mit dem Verlust eines Zeitgefühls, weil „nichts passiert“, sondern nur ist.
Wie kann also eine Entwicklung, eine Bewegung, Raumillusion erzeugen? Die Erklärung von Ligeti, dass das Vorhandensein von dynamischen Schichten die Räumlichkeit vermittelt, kann nicht zufrieden stellen, da es ja gerade um deren Diskontinuität und damit Zeitlichkeit geht. Auch der Hinweis, dass diese Diskontinuität in klar nachvollziehbaren Schritten vollzogen wird, kann bei zunehmender Undurchschaubarkeit der Strukturen für einen primären Höreindruck nicht überzeugen, ebensowenig wie das Empfinden von Nähe und Ferne durch die leichten Abweichungen im rhythmischen Zyklus, die spätestens beim Hinzutreten der dritten Ebene nicht mehr wahrnehmbar sind.
Scheitert hier die rezeptionstechnische Konzeption an einem zu rationalisierten Verständnis der kompositionstechnischen?
Zur Beantwortung dieser Frage muss geklärt werden, was zu dem gewünschten Höreindruck, dem eines immobilen räumlichen Objektes, führt. Die Wahrnehmung eines Objektes als räumlich wird, wie bereits gesagt, durch Kontinuität erreicht, Kontinuität in Ausdehnung, Form, wesentlichen Merkmalen. Alles was mit diesem Objekt passiert, liegt im Bereich des Zeitlichen, die Wirkung einer Entwicklung in der Zeit am räumlichen Objekt.
Dementsprechend gewinnt ein akustisches Phänomen genau dann den Charakter eines in erster Linie räumlichen Objekts, wenn es in überwiegendem Maße über gleichbleibende Elemente verfügt, die den Eindruck des Zeitlichen überdecken, der bei Musik naturgemäß immer vorhanden ist. Das ist u.a. der Fall bei sehr langsamem Tempo bzw. einer Anhäufung sehr großer Notenwerte, die durch den Eindruck des Stillstandes Erstarrung der Zeit zum Raum vermitteln und bei festgelegtem modalem Rahmen z.B. in nordindischer Kunstmusik, der einen tonalen Raum mit einem bestimmtem atmosphärischen Gehalt definiert.
Auch in der westeuropäischen und nordamerikanischen Kunstmusik gab es verschiedene teils experimentelle Ansätze dazu, u.a. bei Ockeghem durch harmonischen Stillstand und bei Ligeti durch Auflösung des rhythmischen Bewegung in Klangflächen.
Wenn keines dieser Elemente im vorliegenden Werk vorhanden ist, stellt sich die Frage, ob es sich, unter Bewahrung einer Raumillusion, tatsächlich um Immobilität oder um eine spezifische Art der zeitlichen Entwicklung eines räumlichen Objekts oder ein völlig anderes Wahrnehmungsergebnis handelt. Dazu ist es nötig, vorerst konzeptionelle Ideen in der Kompositionstechnik zu untersuchen, die dem Werk innewohnen.
Da völlig auf den bis hierhin vernachlässigten kompositionstechnischen Gehalt ausgerichtet soll dabei Febels Analyse im Vordergrund stehen, die dem Stück durch den Nachweis nahezu lückenloser konzeptioneller Strenge fast seriellen Charakter zuschreibt und somit dem Aspekt des Konsequenten sehr entgegenkommt.[4] Die Abweichungen, die vor diesem Hintergrund doch relativ häufig auftreten, lassen zum Einen an die „zweischneidige Herkunft“ Ligetis denken, ziehen aber in Bezug auf den untersuchten Aspekt in erster Linie ihre Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Motivation zu klären muss daher im Vordergrund stehen.
Febel beschreibt das Stück als „Gewebe von Tonrepetitionen“[5], das neben seinen rhythmischen Schichten und dynamischen Mitteln auch über eine Skalenbindung verfügt. Letztere ist der Strukturschilderung am Anfang des Kapitels hinzuzufügen.
In der Aufbauphase der sechs Schichten verändert sich die jeweilge Tonhöhe nicht. Das entstehende Tongebilde hat die Tonhöhen des2 / c2 / h1 / a1 / ges1 / f1. Das nun folgende Herabsteigen geschieht anfangs in Halbtonschritten, später in Ganztonschritten oder noch größeren Intervallen. Dem entgegen läuft die Gesamtentwicklung, wie schon erwähnt, über Oktavierungen ebenso in äußere hohe wie tiefe Lage.
Es gibt somit in der Konstruktion folgende Inkonsequentheiten: Abweichungen vom schrittweisen Herabsetzen der Tonabstände, Sprünge in der Herabsetzung der zentralen Abstände, Sprünge in der Herabsetzung der relativen Lautstärke, Sprünge in der Herabsetzung der absoluten Tonhöhe, Ungleichheiten bei der Veränderung der Parameter Tonhöhe und Dynamik. Nur die ersteren sollen hier betrachtet werden.
Zur Verdeutlichung dienen zwei Grafiken von Febel (Grafik 1, Grafik 2), die sich beide auf die Entwicklung von Tonabständen und Tonhöhe beziehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 1, Febel 1978, 42
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 2, Febel 1978, 43
Febel meint dazu: „Bei diesen Ungenauigkeiten handelt es sich höchst wahrscheinlich um Regulativa, die das ablaufende Schema der Repetitionen an bestimmten Stellen gefügig machen sollen.“[6] Er verweist dabei auf zwei Stellen - einmal auf die mit „x“ gekennzeichnete (Grafik II,2), bei der die eigentlich zu erwartenden Werte 2 / 3 Sechzehntel zu 5 zusammengezogen wurden, sowie auf Takt 60 bzw. die vorherige Verschiebung in der Repetition von I,3, die zur Bildung eines Sextakkords d-Moll führt. „Hier wurde also der Zufall manipuliert!“[7]
So klar sich - möglicherweise - bei der letzteren Abweichung ein ‚dramaturgischer’ Sinn ergibt, so wenig ist er an anderen Stellen zu erkennen. Die „x“-Stelle in Takt 48 erhält durch das ‚Auslassen’ des ces zwar auch einen tonal verortbaren Klang (ges mit b ein Sechzehntel später), der sich diffus in eine es-Moll / Ges-Dur Tonalität eingliedert, aber als Klang ebenso durch das ces vorher ‚sabotiert’ wird, wie das d-Moll durch die Umrahmung durch ces und des. Konstruiert man ein „Was-wäre-wenn“ mit dem Spitzenwert 12, der konzeptionell gesehen dazwischen gehört hätte, sieht man, dass der im Stück häufig anzutreffende Quart-/ Quintklang, hier d-a, in Klavier I schon in Takt 59 verhindert wäre, was wohl eher den Grund darstellt - zumal der schnelle Klangwechsel zwischen Tritonus und Quarte schon vorher im Stück ‚thematisiert’ wurde und die Beziehung d-a für Ligeti durchaus über mehrere Stücke hinwegreichende Bedeutung hat.
Es handelt sich also - möglicherweise - um eine spielerische Manipulation, sowie in Takt 48, da durch die Manipulation eine Wiederholung der Klangfolge am Taktanfang vermieden wird, um eine spielerische Innovation, die das Überwinden der Gleichartigkeit über die Strenge der Konzeption stellt. Darauf wird noch zurückzukommen sein.
Es muss Mutmaßung bleiben, dass sämtliche andere Abweichungen in ähnlicher Weise der Lebendigkeit in der Entwicklung geschuldet sind bzw. in ihrer zunehmenden Häufung zum Ende hin der konzeptionellen Idee der Strukturauflösung folgen. Entscheidend ist, dass beides dem Bereich des Ereignisses, des Fortschreitens zugehört und damit primär zeitlich ist.
Die drei erwähnten Analysen setzen bei der letztendlichen Verortung des Stückes verschiedene Schwerpunkte.
Febel schreibt „diese[m] flimmernde[n] Gewebe“ - ganz im Sinne des Erfinders - Räumlichkeit zu, als „dem Hörer verschiedene Ebenen, Entfernungen, gleichsam Vorder-, Mittel- und Hintergründe suggerierend“[8].
Lobanova benennt als kompositorisches Ziel Ligetis unter Bezugnahme auf seine Einführung die Klangfarben-Einheit zwischen verschiedenen Schichten. Diese Einheit, so Lobanova, existiert aber gleichzeitig mit diversifizierenden Bezügen der Schichten aufeinander, so ihre unterschiedliche metrische Grundlage und die Illusion unterschiedlicher Geschwindigkeiten durch eine talea mit vier verschiedenen Grundwerten, die aber zunehmend an Wahrnehmungsgrundlage verliert. Resultat ist eine „ illusory parallel form[9] “ von wie Objekte in einen imaginären musikalischen Raum gesetzten rhythmischen Schichten. Außerdem nutze Ligeti erneut das „discrete-continual paradox“[10], also die Gegensätzlichkeit von Einzeltönen zur Fläche.
Floros verweist eher auf die dynamische Differenzierungsarbeit in Zusammenhang mit dem oben genannten Zitat aus Ligetis Einführung und beschreibt darüber hinaus den Eindruck des Hämmerns, Bauens und Wachsens, der das Stück wie eine Studie über das Martellato erscheinen lässt - hier besteht eine Parallele zu Febels „Gewebe von Tonrepetitionen“ (siehe oben).
Nimmt man diese Aussagen zusammen, ergibt sich eine Verschiebung im Rezeptionsergebnis. Ligeti behält seine Affinität zu einer ganz bestimmten Form von Entwicklung, die wiederum aber das Entstehen eines reinweg monumentalen, immobilen Charakters verhindert. Es entsteht jedoch kein „flimmerndes Gewebe“, sondern ein Bild von lange Zeit klaren Konturen, so unklar auch seine Struktur bleibt - das bewirkt auch die Spielanweisung Ligetis, so wenig Pedal wie möglich zu benutzen.
So wenig Beweglichkeit auch im Klang besteht, die „Vorder-, Mittel- und Hintergründe“ der Objekte in einem imaginären musikalischen Raum sind im Bauen und Wachsen begriffen. Das ganze Bild muss also erst entdeckt werden!
So ist der primäre Wahrnehmungseindruck dieses Monuments keineswegs der eines immobilen Objekts, sondern eher eines großen, das langsam in Bewegung kommt und dabei schließlich zu feinem Staub zerfällt. Genauer gesagt, die Einzelschichten der Komposition werden als einzelne Objekte oder Objektteile gehört, die sich immer mehr ineinander verzweigen und dabei ein zunehmend diffuses Gesamtbild ergeben, das schließlich nur noch als leichter, nebliger Lichtschein erkennbar ist.
Darin ist nicht ein Scheitern des angestrebten Rezeptionszieles zu sehen, sondern vielmehr eine Erweiterung im eigentlichen Kunstwerk. Das von Ligeti entworfene Bild eines Hologramms muss um eine Ereignisebene erweitert werden: Das Gestaltannehmen und Verschwimmen eines langsam ins Licht gedrehten Hologramms.
Jetzt als Inhalt dieses Hologramms z.B. eine der von Ligeti geliebten (immobilen) Radierungen Piranesis zu sehen fällt allerdings nicht schwer, denn auch jene geben der Wahrnehmung die ‚Aufgabe’, erst nach und nach alle Einzelheiten zu erkennen und sich dann in ihnen zu verlieren. Die Strenge der Konzeption weicht der Faszination der Verwirrung.
2. Selbstporträt mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei)
Von den drei Stücken ist das Selbstporträt von der Machart her das einfachste, was bei seiner Einbeziehung des Minimalismus nicht verwundert. Erst die Allusion an Chopin zum Schluss bringt wieder die Fülle an Material, die den Randstücken innewohnt.
Das Stück ist deutlich in vier Teile geteilt, was Constantin Floros im Zusammenhang mit dem Titel und in Folge einer Analyse der verwendeten Elemente dazu brachte, darin jeweils eine der Allusionen zu sehen: an Ligeti selbst (Gitterüberlagerung), an Steve Reich (1936, Phasenverschiebung), an Terry Riley (1935, Patternwiederholung) und an Chopin (1810-1849). Doch so klar die Teile auch erkennbar sind, so scheint doch diese blockhafte Zuschreibung nicht ausreichend zu sein.
Der erste Teil (A-l) hat als blockierte Tasten in der linken Hand c2-h1-a1 (I) bzw. des2-b1-a1 (II). Dadurch ergeben sich in den rotierenden Bewegung in der rechten Hand d bzw. eses und des (nur in Klavier I) als klingende Töne. Die Abstände zwischen diesen klingenden Tönen (bis N, dann kommen weitere dazu) werden durch die Anzahl der angeschlagenen blockierten Tasten (= Pausen) reguliert. Die rotierenden Bewegungen entwickeln sich erst in Klavier I von sieben auf drei Elemente mit jeweils 18 / 10 / 24 / 14 Wiederholungen, während Klavier II colla parte wiederholt, danach wiederholt Klavier I colla parte und die Bewegungen in Klavier II gehen ebenso linear von sechs auf zwei Elemente mit 8 / 12 / 16 Wiederholungen. Danach bilden sich die Ausgangsformen in gleicher Weise zurück, allerdings mit anderen Elementen- und Wiederholungszahlen, nämlich in Zweiersprüngen auf acht Elemente und 20 / 12 / colla parte bzw. 22 / 18 / 10 / colla parte Wiederholungen.
Bei der Rückbildung in Klavier II werden neue klingende Töne hinzugenommen (c, h), ebenso bei deren Erweiterung in Klavier I (des, ais / b), so dass durch die untrennbare klangliche Einheit der Klaviere praktisch auch die blockierten Töne auftauchen und somit nunmehr nur noch zur rhythmischen Gliederung dienen.
Der Vorgang der Erweiterung wird jetzt immer unregelmäßiger auf beide Klaviere verteilt, wobei das Gegenüber jeweils colla parte wiederholt. So spielt Klavier II 8 Wiederholungen einer 10-Elementen-Figur, Klavier I 6, dann wieder Klavier II 4 Wiederholungen von 12 Elementen, Klavier I 16.
Bei dieser ‚Übergabe’ der neuen Figur handelt es sich jeweils um eine genaue Wiederholung, deren klingende Töne und Rhythmik sich jedoch auf Grund der verschiedenen blockierten Tasten verändern.
Dabei hält Klavier II bis Z die ‚Innovationsaufgabe’ zur Neueinführung inne, nach einer letztendlichen Erweiterung auf 13 Elemente und der Erweiterung des Tonraums auf fes / e in Klavier II übernimmt Klavier I diese Position. Dabei spielen für die Wiederholungen lediglich gerade Zahlen eine Rolle (4 / 6 / 12 / 14 / 16), ohne dass ein rechnerisches Schema zu Tage tritt.
Bei f wiederholt sich der Vorgang der Innovationsübergabe, ab Z wurde die Elementenanzahl von 10 in Zweierschritten auf 6 herabgesetzt, bis l führt das bis zu einem Triller, der sich in beiden Klavieren aus den klingenden Tönen e und d zusammensetzt. Unter dem durch Fermaten festgehaltenen Triller wandeln sich die blockierten Tasten schrittweise in beiden Klavieren zur Figur c2-h1-g1-f1-e1-d1, womit der zweite Teil beginnt.
Aus der Gegenüberstellung der jeweiligen Figuren und ihrer Übernahme ergibt sich eine Innovations- bzw. eine Kommunikationsstruktur zwischen den beiden Klavieren, in der anfangs Klavier I die Oberhand hat (‚Übergabe’ von acht Figuren), die dann für drei Figuren an Klavier II übergeben wird, ebenso für drei wieder zurück, und schließlich werden wieder drei Figuren von Klavier II vorgegeben. Es ergibt sich nur eine Unregelmäßigkeit bei S, wo Klavier I eine Variation vornimmt, die nicht in Klavier II auftaucht; sie führt letztlich dazu, dass Klavier I eine Figurenvariante mehr hat.
Insgesamt ist hier aber Stringenz der Konzeption gegeben, die durchbrochen wird durch die nur äußerlich regelmäßige Wiederholungen - nur Verwendung von geraden Zahlen, aber ohne erkennbares Schema, sondern von der ungefähren Ausrichtung zu länger oder kürzer getragen - sowie durch das unterschiedliche klangliche und rhythmische Ergebnis - diskursiv gesprochen: Es ergibt sich eine Kommunikation, in der ähnliche und aufeinander bezogene Ideen kursieren, jedoch das Ergebnis bei jedem der beiden Teilnehmer auf Grund anderer Voraussetzungen unterschiedlich ausfällt. Dieses diskursive Moment tritt auch im weiteren Verlauf häufiger zu Tage.
Die vorheruige Gleichförmigkeit in Dynamik (mp), Tonraum (e2-b1) und Akzentuierung wird nach dem Versinken des letzten Teils im ppp (m) jäh durchbrochen. „Schwungvoll, energisch“ in subito ff bildet Teil 2 in verschiedener Hinsicht das genaue Gegenteil des ersten.
Die neue Ausgangsfigur, eine mit Sprüngen durchsetzte, herabführende Linie mit akzentuiertem Abschluss, wird einmal unisono vorgetragen, dann folgt Klavier II den weiteren Entwicklung in Klavier I als Echo im p. Da es hierbei nur zwei Abweichungen gibt, reicht es aus, die Vorgaben zu untersuchen.
Durch die blockierten Töne c2-h1-g1-f1-e1-d1 sind im verwendeten Tonraum f2-as vorerst nur die Töne f2-e2-es2-d2-des2-b1-a1-as1-ges1-es1-des1 und alles darunter möglich. Diese Voraussetzung ändert sich ab v, wo der akzentuierte Schlusston c1 in den Block übernommen wird. In gleicher Weise werden h und a1 temporär hinzugenommen, während der restliche Block bis auf c1 und d1 bis LL3 schrittweise abgebaut wird. Auf Grund der Bewegungsrichtung kommen nur a, h und c1 als mehrmals festgehaltene und losgelassene Schlusstöne zur Verwendung, eine Ausnahme bildete hier wiederum das a1.
Entwicklungsgrundlage ist auch hier eine zunehmend schwächer werdende Regelmäßigkeit und eine zunehmend stärker werdende Rolle der Innovation und Fortspinnung in Richtung einer Idee vom Abschluss - ähnlich dem Triller im ersten Teil.
Zu Beginn ist die Konstitution noch stabil - Figuren aus elf Elementen, ein wiederholtes, melodieartiges Fortschreiten der Schlusstöne (des-c-h-es) und ihre scheinbare Sequenzierung. Letztere wird durch das schon angesprochene a1 durchbrochen, da es in c-h-a-des eine Oktavierung bringt. Der weitere Fortgang dieser ‚Melodie’ ist vom Verhaften zwischen h und c, sowie dem Dazwischenschieben von b und as bestimmt; auch erscheint ab und zu kein Schlusston. Die Fortführung im Kanon der linken Hände (NN) entspricht in seiner um eine kleine Sekunde verschobenen Sequenzierung zum Einen dem Vorherigen, führt zum Anderen die Erwartung einer Tonalität, die mit f-g-a-e-fis-gis möglich ist, durch ein plötzliches Abweichen in Klavier II um einen Halbton aufs Glatteis. Das ist sowohl ein von verschiedenen Komponisten gern genutztes komisches Element, bereitet mit den Tönen es und des aber ebenso die Tonalität des dritten Teils und damit auch der Chopin-Allusion (g-des-es) vor.
Erkennbar wird hier ein Prinzip der vorbereitenden Planung. Die jeweiligen Ausgangsideen der Teile scheinen schon von vornherein fertig gewesen zu sein, der Inhalt der Teile ist lediglich eine möglichst flüssige Hinführung unter Verwendung verschiedener Kompositionsprinzipien.
So sind die Endpunkte des angesprochenen Kanons die Grundlage des Blockes für Teil 3 (h und c), die Verkürzung der Figuren und der zunehmende Wegfall der akzentuierten Schlusstöne bei sukzessivem Reduzieren des Tonraums auf ges-c direkt mit der Anfangsfigur von Teil 3 verbunden (OO), sowie die dortige Verwendung sich abwechselnder ‚Patternbeiträge’ zwischen den Klavieren als quasi aufgelöstes Echo ein Entwicklungsweg des Voneinanderlösens (von der Gitterüberlagerung in Teil 1 bis zum über weite Strecken alleinigen Spielen in Teil 4).
Zu den weiteren vorbereitenden Entwicklungen ist die, wie bereits angesprochen, nur anfänglich regelmäßige Herabsetzung des Elementenanzahl in Teil 2 bis zur Anzahl 7 in Teil 3. Der anfänglichen sechsmaligen Wiederholung von eltteiligen Figuren, folgen vier zehnteilige, jedoch nur eine neunteilige, dann 13 / 12 / 11 / 10. Bei der elfteiligen Figur fehlt das erste Mal der Schlusston, ebenso wie bei der jetzt folgenden. Dann beginnt ein regelmäßigerer Abschnitt mit drei neunteiligen und drei achtteiligen Figuren. Nach nur einer siebenteiligen folgen vier weitere achtteilige, um schließlich in nur noch siebenteilige überzugehen.
Ein weitere Unregelmäßigkeit ergibt sich zwischen LL und MM in Klavier II, wo in Klavier I die Abschlussfigur gefunden ist, die 46 Mal wiederholt wird. Klavier Ii hat hier einen ‚Aussetzer’, scheint sich in die nun gleichbleibende Figur einzuhören und dann um drei Elemente versetzt bei der sechsten Wiederholung mit einzusetzen. Dem schließlich versinkenden Abschluss des Teiles ist hier also ein wesentlich größerer Raum als bei Teil 1 gegeben.
Auch im dritten Teil, der bis qq reicht und bei weitem der kürzeste ist, laufen parallel Patternentwicklung und mobile Tastenblockierung ab. Nach einem fff-Einstieg mit der leicht gewandelten Abschlussfigur aus Teil 2 und einem erneuten unisono mit der neuen Ausgangsfigur, verharrt die Lautstärke wiederum im f-Bereich. Anfangs werden in beiden Klavieren die gleichen Tasten blockiert, dann parallel jeweils um eine Figur verschoben verändert, so dass von e-c-H-A zu f-e-d-c-H übergegangen wird.
Ähnlich den vorherigen Teilen sind die Veränderungen in den resultierenden Tönen und Rhythmen schrittweise, hier in der abwechselnden Weiterführung jedoch komplizierter.
Zielpunkt ist die Entwicklung der Figur g-es-des. Er wird folgendermaßen erreicht: Die Ausgangsfiguren bei QQ / RR haben als Randtöne es und as bzw. g, bei gg sind die Zieltöne, wenn auch mit ‚humpeligem’ Rhythmus erreicht. Dazwischen schwankt der obere Randton zwischen f, ges / fis und g, verschwindet von WW bis ZZ, um schließlich mit f-g-fis-fis-g endgültig beibehalten zu werden.
Der untere Randton variiert in ähnlicher Weise zwischen as, g, ges, f und e, er wird zusammen mit den ihn anstrebenden Tönen unterhab von des praktisch aufgelöst, indem die nicht durch die blockierten Tasten verhinderten Töne sukzessive nicht mehr bedient werden. Zurück bleibt noch eine Zwischenfigur, die aus wechselnd auf- und abwärts gehenden großen und kleinen Sekunden mit den Tönen es, d, des / cis gebildet wird. Sie richtet sich nach und nach auf die Abfolge cis / d / es aus, um nach dem ‚Verschlucken’ des d die gewünschten Töne zu liefern.
Der Fortgang ab gg ist nunmehr die schrittweise Entfernung der vorhandenen ‚Pausen’, wie sonst auch durch An- bzw. Nichtanschlagen der blockierten Tasten reguliert. In der letztendlichen Übergangsphase zu rr finden noch einmal die Prinzipien Gitterüberlagerung (durch colla parte-Beibehaltung der Figur in Klavier II bei Abwandlung in Klavier I), die Phasenverschiebung (als darin enthaltenes Ergebnis unterschiedlicher Elementenanzahl) und die Patternwiederholung (bis zum Einsetzen der Phasenvarianzen) Anwendung. Dies ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Erstens wird deutlich, dass im Grunde genommen jeder der Teile jedes intendierte Kompositionsprinzip enthält - ohne Patternwiederholung keine Entwicklung von Phasenverschiebungen, ohne Phasenverschiebungen keine Gitterüberlagerung.
Zum anderen führen somit die vorherigen Prinzipien zur Chopin-Allusion hin, die also entweder ein neues Prinzip oder ein übergeordnetes Prinzip darstellt. Tatsächlich ist beides der Fall, wie die Materialbehandlung zeigt - die nun nicht mehr im Einzelnen wiedergegeben werden soll, da - weil hier erneut eine Masse an Material verwendet wird - seine ausführliche Behandlung - wie es bei Sabbe in Bezug auf das dritte Stück heißt - „strapaziös“[11] ist, sowohl in ihrer Ausarbeitung als auch im Nachvollziehen derselben.
Darum nur einige Charakteristika des vierten Teils: Entgegen der Machart der anderen Teile und entsprechend des Vorbilds bei Chopin ist keinerlei zielgerichtete Entwicklung zu erkennen, vielmehr scheint ein auf Nachahmung und darauf aufbauender Fortspinnung im Sinne einer strömenden Innovationsflut Grundlage des Abschnitts. Was bei Chopin jedoch voll drängendem und unerfüllbarem Ausdruckswillen entsteht, erscheint hier als berechnetes Kompositionsprinzip. fff-Einwürfe klingen nur wie ein Skelett des Aufbäumens bei Chopin, verlagert in schon angedeuteter kommunikativer Ausrichtung. Bei ss versucht Klavier II in das vorherige Solo von Klavier I einzudringen, indem er die gleiche Figur, aber statt pp fff spielt. Doch erst der zweite diesbezügliche Anlauf einen ‚Takt’ später, bei gleichzeitigem Aufleben des Klavier I zum fff bringt die Übernahme. Ein ähnlicher, aber erfolgloser Vorgang findet bei tt statt, erst bei uu erfolgt die erneute Übernahme des Figurenwirbels durch Klavier I. Nach einem weiteren Einwurf von Klavier II bei vv ‚schleicht’ es sich in pppp bei ww ein, bei gleichzeitigem Aufbau der Tastenblockierung D1-F1-G1-A1-H1-C; Klavier I folgt eine Oktave höher diesem Beispiel.
Da sich die nun in beiden Klavieren gespielten Figuren immer mehr in den abgesperrten Bereich bewegen, versanden sie poco a poco, bis bei xx nur noch die durch die Blockierung freischwingenden Saiten nachklingen und durch schrittweise Auflösung des Blocks zum Verstummen gebracht werden.
Es sind zwei elementare Entwicklungen, die festzustellen sind: Zum Einen die zunehmende ‚Vereinsamung’ der beiden Spieler, indem ihre Verhakung immer mehr gelöst wird - vom Gitter bis zum Solo.
Zum Anderen die Zunahme des Innovationsprinzips bzw. des Elements der Fortspinnung - von größtenteils linearer Entwicklung zum reinen Ideenspiel. Bei Sabbe wird dies als „Probabilistische Regel“ beschrieben, indem andauernde Kontinuität ansteigende Wahrscheinlichkeit von Diskontinuität bedeutet.
Vor dem biographischen Hintergrund Ligetis lässt sich darin leicht die Abneigung gegen Dogmatisierung erkennen. Was bei Febel Regulativa genannt wird, ist mindestens nebenher auch die Vermeidung der abweichungslosen Planung und kalten Linientreue. Bei aller Koketterie mit der Wissenschaftlichkeit, soviel lässt sich hier schon schlussfolgern, herrscht bei Ligeti das Primat der Kreativität. Was dieses nicht zulässt, wird von ihm nicht unterstützt.
In Bezug auf die genannten Vorbilder ist festzustellen, dass, neben der deutlichen Allusion im vierten Teil, vor allem die Übernahme von Konzeptionsideen und Entwicklungsprinzipien stattfand, zusammengehalten von der ganz eigenen Neigung, aus eigens Festgelegtem eigene Unordnung zu machen. Als Objekte dieser Entwicklung dienen nun sicherlich Pattern, deren Gleichförmigkeit durch Überlagerung und Verschiebung durchbrochen wird. Das Prinzip, das hinter der Auflösung steht, ist als Assoziativvernetzung des Materials der Anteil Chopins. Jedem zitierten Vorbild kommt also sich wandelnder Anteil an jedem Teil zu, und doch sind sie nur ein weiterer Beitrag zum eigentlichen Inhalt: dem Selbstporträt.
3. In zart fließender Bewegung
Nachdem im ersten Kapitel vor allem die Frage der Rezeption und ihrer Übereinstimmung mit von Ligeti postulierten Absichten gestellt wurde und im zweiten versucht wurde kompositorischen Prinzipien der Abweichung zu erkennen, soll nun der Blick mehr der Frage der Klaviertechnik zugewandt werden.
Als musikalische Bezugspunkte wurden für „Bewegung“ u.a. die Klavierwerke von Schumann und Brahms genannt[12]. Das stützt sich auf die typisch romantische Titelbezeichnung „zart fließend“, den Aspekt der durchgängigen, fließenden Bewegung, sowie den metrisch versetzten bzw. das Metrum aussetzenden Haltepunkten. Die Kombination von Fluss der Begleitungsfiguren und darin eingebetteten melodischen Haltepunkten ist auch bei Mendelssohn und Chopin zu finden, das klangliche Ergebnis ist reich an Bezügen zum Impressionismus von Debussy.
Eine lohnenswerte Frage ist dabei, was in diesem Sinne unter dem verschiedentlich angesprochenem „Romantic pianism“[13] zu verstehen ist bzw. unter dem gewählten Blickwinkel, inwieweit der Einfluss von romantischen Klaviertechniken die Gestaltung des Stückes bestimmt.
Im 19. Jahrhundert ging im Klavierspiel der Übergang vom handgelenkbetonten zum schulterbetonten Klavierspiel vor sich. Während im Barock in Tradition des Cembalospiels und in der Klassik in Folge eines Ideals der Klarheit vor allem mechanisches Fingerspiel gefordert waren, begann bei Beethoven eine Ausweitung der direkt aufeinanderfolgenden Lagenwechsel, Kombination umfangreicher Akkordketten sowie allgemeine Ausbreitung der verwendeten Klavierregionen. Speziell bei Field und Chopin kam zudem das Klangideal der Weichheit und der verschwommenen Klanglichkeit dazu, die besonders dichtes Legato und ausgiebige Benutzung der technisch zunehmend perfektionierten Pedale erforderte.
Je nach mehr oder weniger klassizistischer Ausrichtung bewegten sich die spezifischen Kompositionstechniken zwischen der klassischen Brillanz und den verschwimmenden Konturen bei Debussy. Entscheidend für den pianistischen Wert war jedoch das „Aus-der-Hand-Komponieren“, das zu einem hohen Standard der ‚Handhabbarkeit’ unter den von Pianisten geschriebenen Stücken führte. Selbst ausgesprochene Virtuosen wie Liszt und Rachmaninoff schrieben letztlich ‚physiogen’.
Schaut man unter diesem Blickwinkel auf Ligeti, so trifft man zum Einen auf seine Behauptung, nur begrenzte pianistische Fähigkeiten zu haben, auf der anderen jedoch auch die Aussage, dass beim Improvisieren manchmal „aus den Stellungen der Hände auf der Klaviatur neue Ideen“[14] entstehen. Zu beobachten ist jedenfalls, dass im Vergleich etwa zu allein auf die Konstruktion ausgerichteten Klavierstücken von Stockhausen Ligetis Stücke für Klavier ein hohes Maß an angenehmer Spielbarkeit innewohnt. Damit ist nicht Mangel an technischem Anspruch gemeint, sondern sich organisch aus den physiologischen Gegebenheiten der Hand ergebende Bewegungen. Ebenso wie bei Schubert zeigt sich, dass dabei nicht tatsächliches Virtuosentum, sondern Begabung zu pianistischem Denken zu solchen Ergebnissen führt, zumal Ligeti instrumentale Ausbildung an Tasteninstrumenten bekommen hat - seine diesbezüglichen Aussagen sind wohl als eitle Bescheidenheit zu verstehen.
Gute Handhabbarkeit zeichnet sich durch die Vermeidung bestimmter typischer Problemfelder des Klavierspiels aus. Dazu gehören im Bereich der fließenden Bewegungen physiologisch schwierige Fingerkombinationen wie Wechsel vierter / fünfter Finger, Untersetzen des Daumens und Repetitionen bzw. häufiger Wechsel der Kombinationen. Leicht sind dagegen auch ohne große Übung rollende Bewegungen, bei denen entweder vom Daumen zum kleinen Finger oder umgekehrt die Finger laufen gelassen werden können. Beispiele sind - um bei von Ligeti bevorzugten Komponisten zu bleiben - zum Einen das Prelude op. 28 Nr. 8 fis-Moll von Chopin, in dem durchgängig die Fingerkombination 1-5-2-4-3-2-1-5 gefordert ist oder zum Anderen Feux d’artifice von Debussy mit gleichförmig rollenden Bewegungen zu Beginn. Im Allgemeinen ist alles also angenehm, was sich bei ruhiger Handhaltung spielen lässt.
Überblickt man daraufhin das vorliegende Stück von Ligeti unter dem Aspekt der Spielbarkeit, sind alle diese Kriterien überwiegend erfüllt. Es handelt sich um gleichförmig rollende Bewegungen, deren Ausrichtung bis auf eine Ausnahme gleich bleibt und deren Umfang im Bereich der fünf Finger jeder Hand bleibt, ebenfalls mit verschiedenen Ausnahmen. Die Notenwerte verlaufen konstant, Veränderungen treten nur nach und nach auf. Grundsätzlich sind also schwierige Fingersätze und Ermüdung durch ungünstige Handstellungen zu vermeiden.
Das betrifft vor allem die substanzbildenden Bewegungsformeln, einige Schwierigkeiten ergeben sich durch die erwähnten Ausnahmen und vor allem die festgehaltenen Töne.
Erstere ergeben sich in Klavier I ab Takt 21, Zählzeit 4, bei der sich der Richtungswechsel der Figuren durch heses-fis-as-g statt heses-as-g-fis andeutet und somit plötzlich die Fingerkombination 4-1-3-2 nach dem vorherigen Fluss 4-3-2-1 fordert. Für die rechte Hand stabilisiert sich die Situation ‚erst’ in Takt 23 nach häufigen Wechseln, die linke Hand erlebt eine ähnliche Entwicklung von Takt 23 bis Takt 24, Zählzeit 3. Danach bleibt die Kontinuität gewahrt.
Die linke Hand erfährt ein Durchbrechen der einfachen abrollen Bewegung von Takt 13, Zählzeit 3 bis Takt 21. Dabei verlässt die Begleitungsfigur den durch zehn Finger abdeckbaren Bereich und fordert einmaliges Nachsetzen der rechten Hand nach der ersten Figur der linken. Da dies aber kontinuierlich jeweils im „Fünffinger-Bereich“ bleibt, ist die Erschwernis begrenzt.
Wie pianistisch diese ‚Untergrundorganisation’ der Begleitformeln gedacht wurde, zeigt sich duetlich in Takt 49. Genau - das ist entscheidend - in dem Moment, wo das Einsetzen des Spiegelkanons in Klavier II eine Hand aus der Bewegungsfigur herauszieht, wechselt die Rhythmik von Sextolen, die ohne Untersetzen nur mit zwei Händen spielbar sind, zu Quintolen; analog dazu Klavier I.
Begrenzte Erschwernis tritt durch die Einbeziehung bewegungsfremder Festhaltetöne bis Takt 14 hinzu. Dabei handelt es sich in Klavier I um die Quinte f-b, Takt 9, Zählzeit 4, die große Septime g-as, Takt 10, Zählzeit 2, die kleine Sexte f-a, Takt 10, Zählzeit 4, die kleine None as-g, Takt 11, Zählzeit 4, den Ton h, Takt 12, Zählzeit 1, die Töne c / dis, Takt 12, Zählzeit 2, die Töne ais / f, Takt 12, Zählzeit 4, die Töne d / cis, Takt 13, Zählzeit 1, die Töne es / c, Takt 13, Zählzeit 2 und den Ton e, Takt 13, Zählzeit 4. Im selben Taktraum auch analog in Klavier II.
Diese Festhaltetöne wurden nur deswegen aufgelistet, um auf eine Besonderheit aufmerksam zu machen, die gleichzeitig in ihrer Signifikanz eingeordnet werden muss. Im Fall der Septime und der Sexte in Takt 10, dem Ton h in Takt 12 und den Tönen cis und c in Takt 13 ergeben sich, bei genauer Beachtung des Notentextes, „Unspielbarkeiten“. Beispielsweise wird durch die Septime g-as, die über eine punktierte Viertel ausgehalten werden soll, der Ton g blockiert, der aber von der Bewegungsfigur ‚gebraucht’ wird. Das gleiche Problem ergibt sich beim f der kleinen Sexte und den anderen genannten Tönen. Bei den beiden Tönen in Takt 13 in der linken Hand wird ein Festhalten verlangt zu einer Bewegungsfigur, die nur mit 1-2-3 bzw. 1-2-4 gespielt werden kann. Im Fall des c (Zählzeit 2) ist also das Ansetzen der Bewegung mit dem Abstand einer großen Dezime erforderlich.
Es geht dabei nicht um eine unberechtigte Forderung, sondern um den eklatanten Unterschied zwischen einer genau ausgearbeiteten Spielbarkeit im Rest des Stückes und den Diskrepanzen an den genannten Stellen, die der „zart fließenden Bewegung“ entgegenstehen. Sie sind der einzige Hinweis, dass die konstruktive Idee der Festhaltetöne (ein Umkehrkanon, siehe Febel 1978, 49) der pianistischen Ausarbeitung widerspricht. Demgegenüber lassen sich zahlreiche Stellen in den Akkorde-bildenden Arpeggien finden, die den Festhaltetönen genau die Länge zuschreibt, die zu einer guten Spielbarkeit möglich ist. Dass Ligeti dabei alles, was den Umfang einer Oktave übersteigt, vermeidet, verstärkt den Eindruck einer Unstimmigkeit in den genannten Fällen.
Neben der, nicht dem romantischen Klavierspiel vorbehaltener Spielbarkeit, erfüllt das Stück sowohl das klangliche Ideal der Weichheit - selbst die akzentuierten Festhaltetöne sind mit der Spielanweisung cantabile versehen - als auch die verschwommene Klanglichkeit, die sich aus der Spielanweisung „Stets mit Pedal“ ergibt. Die Verdichtung des Legato ist dabei nicht nur erwünscht, sondern wesentlicher Teil der Entwicklung: Durch das durchgängige Festhalten der angeschlagenen Arpeggien ab Takt 29 / 30 gibt es gar keine andere Möglichkeit, als einen Ton an den anderen zu ‚kleben’. Was nun schließlich den Aspekt der Wuchtigkeit angeht, spricht das fffff in Takt 48 wohl für sich.
Ligeti tritt als spezifischer Gestalter dieses „Romantic pianism“ deutlich in der Gestaltung der Festhaltetöne in einer Technik der Blütezeit der Polyphonie statt in romantisch-verklärter Melodie zu Tage. Besonders der vollkommen konsequente Spiegelkanon, der in Grafik 3 aus seiner Umarbeitung in die Spielbarkeit genommen wurde, lässt in seiner atonalen Tonsprache und seiner Reminszenz an das Big-Ben-Motiv keinen Zweifel an seiner Provenienz.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 3: Spiegelkanon am Ende [Aufschlüsselung]
Die aus der Kombination der Einzelachsen hervorgehende Achse des Spiegelkanons ist der Ton a[15], der sowohl in den Drei Klavierstücken (erster Ton in Monument, verdoppelt blockierter Ton in Selbstporträt), als auch außerhalb derselben (z.B. Musica Ricercata, I) als ‚Urton’ für die Entwicklung komplexerer Figuren auftaucht. Hier ist, wie auch in gewissen anderen Affinitäten (z.B. Tritonus / Quarte / Quinte, Bevorzugung bestimmter Töne des b-Bereiches) und Konzepten (Entfaltungsform, Gitterüberlagerung, Innovationsprinzip) eine Kontinuität der Grundideen zu erkennen, die Ligetis Schaffen gewissermaßen - konsequent macht. Der hauptsächliche Reiz geht aber wahrscheinlich eher von seinen Inkonsequentheiten aus.
Quellenverzeichnis
Febel, Reinhard: György Ligeti: Monument - Selbstportrait - Bewegung (3 Stücke für 2 Klaviere). In: Zeitschrift für Musiktheorie 9, 1978, 35-50.
Floros, Constantin: György Ligeti. Jenseits von Avantgarde und Postmoderne, (Komponisten unserer Zeit, Band 26), Wien: Lafite, 1996.
Sabbe, Hermann: Das dritte der Drei Stücke für zwei Klavier. In: Metzger, Heinz-Klaus und Rainer Riehn (Hrsg.): György Ligeti. Studien zur kompositorischen Phänomenologie, Musik-Konzepte 53, München: edition text + kritik, 1987, 37-48.
Lobanova, Marina: György Ligeti. Style, Ideas, Poetics, Berlin: Ernst Kuhn, 2002.
Roelcke, Eckhard (Hrsg.): Träumen Sie in Farbe? György Ligeti im Gespräch mit Eckhard Roelcke, Wien: Paul Zsolnay, 2003.
[...]
[1] Roelcke 2003, 167
[2] zit. nach Floros 1996, 129-130
[3] ab hier verwendete Abkürzung für „Drei Stücke für zwei Klaviere“
[4] im Folgenden: Febel 1978, 35-47
[5] Febel 1978, 35
[6] Febel 1978, 44
[7] Febel 1978, 46
[8] Febel 1978, 35
[9] Lobanova 2002, 239
[10] Lobanova 2002, 243
[11] Sabbe 1987, 45
[12] vgl. Lobanova 2002, 246
[13] Lobanova 2002, 246
[14] Roelcke 2003, 167
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in den Drei Stücken für zwei Klaviere von György Ligeti?
Die Drei Stücke für zwei Klaviere sind ein Werk des ungarisch-österreichischen Komponisten György Ligeti, das aus den Teilen Monument, Selbstporträt mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei) und In zart fließender Bewegung besteht. Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Ligeti konsequent vorgegebene Konzeptionen und postulierte Einflüsse in seinen Stücken umsetzt. Dabei werden sowohl kompositionstechnische als auch rezeptionstechnische Aspekte berücksichtigt.
Welche Analysen der Drei Stücke für zwei Klaviere gibt es bereits?
Es gibt verschiedene Analysen des Werkes, darunter eine Einführung von Ligeti selbst, eine musiktheoretische Analyse von Reinhard Febel (1978) und eine Gesamtanalyse von Stephen Ferguson (1994). Außerdem gibt es Behandlungen am Rande oder von Einzelteilen von Herman Sabbe (1987), Constantin Floros (1996) und Marina Lobanova (2002).
Was ist die „Entfaltungsform / Bewegungsform“ bei Ligeti?
Ligeti benutzt die Begriffe „Entfaltungsform / Bewegungsform“ zur Beschreibung der Entwicklung von einer einfachen Idee zu komplexer Verflechtung in einem großen Teil seiner Kompositionen. Die Entfaltungsform ist demnach ein kompositionstechnisches Prinzip.
Was ist die Raumillusion in Ligetis "Monument"?
Ligeti beschreibt, dass die Musik von "Monument" durch die dynamische Differenzierung dreidimensional erscheint, wie ein Hologramm im imaginären Raum. Diese Raumillusion verleiht der Musik einen statuarischen, immobilen Charakter.
Welche Inkonsequenzen gibt es in der Komposition von "Monument"?
Es gibt Abweichungen vom schrittweisen Herabsetzen der Tonabstände, Sprünge in der Herabsetzung der zentralen Abstände, Sprünge in der Herabsetzung der relativen Lautstärke, Sprünge in der Herabsetzung der absoluten Tonhöhe und Ungleichheiten bei der Veränderung der Parameter Tonhöhe und Dynamik. Diese werden jedoch als Regulativa interpretiert, die das ablaufende Schema gefügig machen sollen.
Welche musikalischen Einflüsse finden sich im "Selbstporträt mit Reich und Riley"?
Das "Selbstporträt" enthält Allusionen an Ligeti selbst (Gitterüberlagerung), Steve Reich (Phasenverschiebung), Terry Riley (Patternwiederholung) und Frédéric Chopin. Das Stück ist in vier Teile geteilt, wobei jeder Teil auf einen dieser Einflüsse verweist.
Was ist das Innovationsprinzip im "Selbstporträt mit Reich und Riley"?
Das Innovationsprinzip beschreibt die zunehmende Bedeutung von Fortspinnung und Ideenspiel im Verlauf des Stückes. Anstatt einer linearen Entwicklung wird das Material assoziativ vernetzt. Das kann als Abneigung gegen Dogmatisierung verstanden werden.
Welche romantischen Klaviertechniken beeinflussen "In zart fließender Bewegung"?
Das Stück weist Bezüge zu Klavierwerken von Schumann, Brahms, Mendelssohn und Chopin auf. Es kombiniert fließende Bewegungen mit melodischen Haltepunkten und erinnert klanglich an den Impressionismus Debussys. Die Gestaltung der Festhaltetöne erinnert an die Blütezeit der Polyphonie.
Welche spieltechnischen Schwierigkeiten treten in "In zart fließender Bewegung" auf?
Das Stück ist überwiegend gut spielbar, da es gleichförmige und rollende Bewegungen verwendet. Es gibt jedoch einige Stellen, an denen Richtungswechsel der Figuren und Festhaltetöne die Spielbarkeit erschweren.
Welche Kontinuität gibt es zwischen den einzelnen Stücken?
Es lassen sich Kontinuitäten in den Grundideen erkennen, wie z.B. die Bevorzugung bestimmter Töne und Intervalle (Tritonus, Quarte, Quinte), die Entfaltungsform und das Innovationsprinzip. Diese Grundideen ziehen sich durch Ligetis Schaffen und machen es auf ihre Weise konsequent.
- Citar trabajo
- Enrico Ille (Autor), 2004, Konsequenz und Inkonsequenz in den „Drei Stücken für zwei Klaviere (1976)“ von György Ligeti, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111509