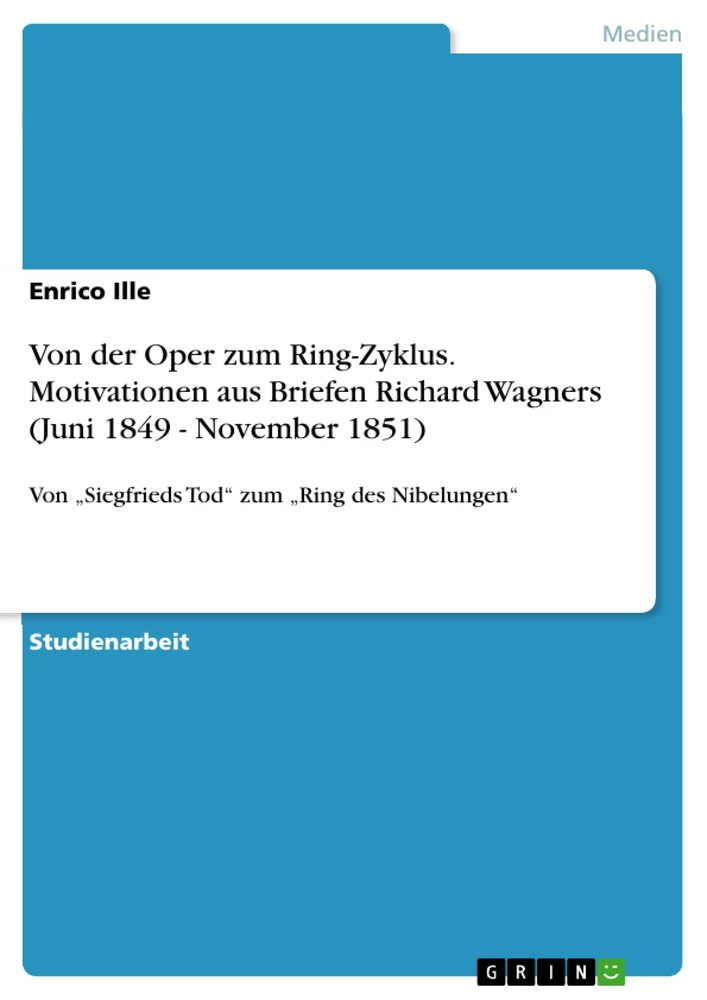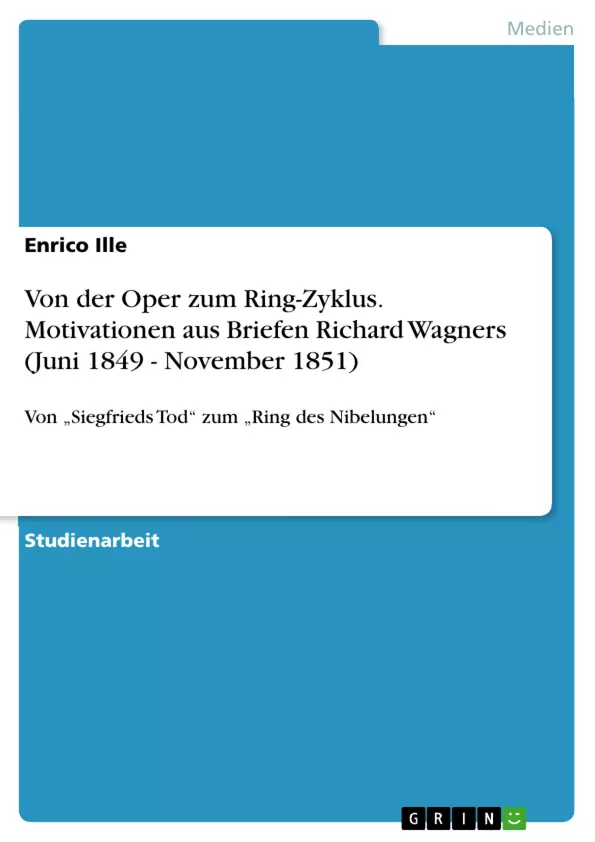„In diesem Sinne erwarte ich nun Ihre geneigte Erklärung, um zu wissen, daß ich Sie denjenigen beizuzählen habe, welche durch freiwillige Verpflichtung sich für den Zweck der Verwirklichung eines noch nie entworfenen künstlerischen Ideales, zu einem wahrhaft genossenschaftlichen Vereine von werthvollster Bedeutung verbinden.“
Diese Zeilen schrieb Richard Wagner am 14. Januar 1875 in einem Rundschreiben an die Sänger, die er für die Erstaufführung seines Ring-Zyklus gewinnen wollte. In der wechselvollen Beziehung, die Wagner von der ersten Auseinandersetzung mit dem Mythos 1848 bis zu seinem Tod 1883 zum Nibelungen-Werk einnahm, kennzeichnen sie einen seltenen Höhepunkt der Hochschätzung.
Werden die ersten Ausführungen zum Nibelungen-Mythos von einer allgemeinen Begeisterung für alte Mythen und einem zunehmend auch politischem Interesse an deutschem Volksgut getragen, wandelte sich dessen Bedeutung nach einer Phase des Theoretisierens mit dem „jungen Siegfried“ im Züricher Exil zu einer Ersatzbetätigung zum ‚wirklichen Leben’. Nach der Ausweitung auf den Opernzyklus trat der Stoff Ende der Fünfziger stark hinter den ‚Unternehmungen’ „Tristan und Isolde“ und „Die Meistersinger von Nürnberg“ zurück, um schließlich mit der Bekanntschaft von König Ludwig II. von Bayern als Festspiel realere Züge anzunehmen und für Wagner zur nationalen Aufgabe zu wachsen. Doch mit den Problemen des finanziellen Defizits nach der Erstaufführung und den daher notwendigen Konzerttätigkeiten in England versickerte das Gefühl des Triumphs schnell, und in den letzten Jahren seines Lebens fühlte sich Wagner nurmehr als stiller Beobachter der weiteren Aufführungstätigkeiten, ohne an erneute Bayreuther Festspiele zu glauben.
Diesen Weg genauer nachzuvollziehen hat zumindestens den einen Wert, wiederum die enge Verknüpfung zwischen der Schöpfung und den Bedingungen der Schöpfung zu sehen und den Eindruck der Integrität, Absolutheit und des unbedingten So-Seins, zu dem gerade sogenannte Meisterwerke verführen, zu relativieren.
Vielmehr zeigen jedoch die Äußerungen des Künstlers, der etwas schafft, was später als ‚Ausnahmewerk’ verstanden wird, inwieweit er ein Bewusstsein dafür entwickelt. Wie sich dieses Bewusstsein im Falle Wagners in Bezug auf den „Ring des Nibelungen“ in seiner Erweiterung von einer einzelnen Oper zu einem Zyklus entwickelte, soll der primäre Blickpunkt dieser Arbeit sein. [...]
Gliederung
Entwicklung von Thema und Methodik (mit Literaturverzeichnis)
Biographische Übersicht
Juni 1849 bis Oktober 1849 - „Ich muß jetzt an eine tüchtige arbeit gehen ...“
Juli 1850 bis November 1850 - „Das muß ich sagen: - du bist ein freund!“
Mai 1851 - „...nie mehr ein allgemeines, abstraktes Publikum vor Augen ...“
September bis November 1851 - „Mit dem Siegfried noch große Rosinen im kopfe ...“
12. / 20. Nov. 1851 - „...nicht etwa bloß Reflexion, sondern namentlich Begeisterung...“
Abschließende Betrachtungen
Entwicklung von Thema und Methodik
„In diesem Sinne erwarte ich nun Ihre geneigte Erklärung, um zu wissen, daß ich Sie denjenigen beizuzählen habe, welche durch freiwillige Verpflichtung sich für den Zweck der Verwirklichung eines noch nie entworfenen künstlerischen Ideales, zu einem wahrhaft genossenschaftlichen Vereine von werthvollster Bedeutung verbinden.“[1]
Diese Zeilen schrieb Richard Wagner am 14. Januar 1875 in einem Rundschreiben an die Sänger, die er für die Erstaufführung seines Ring-Zyklus gewinnen wollte. In der wechselvollen Beziehung, die Wagner von der ersten Auseinandersetzung mit dem Mythos 1848 bis zu seinem Tod 1883 zum Nibelungen-Werk einnahm, kennzeichnen sie einen seltenen Höhepunkt der Hochschätzung.
Werden die ersten Ausführungen zum Nibelungen-Mythos von einer allgemeinen Begeisterung für alte Mythen und einem zunehmend auch politischem Interesse an deutschem Volksgut getragen, wandelte sich dessen Bedeutung nach einer Phase des Theoretisierens mit dem „jungen Siegfried“ im Züricher Exil zu einer Ersatzbetätigung zum ‚wirklichen Leben’. Nach der Ausweitung auf den Opernzyklus trat der Stoff Ende der Fünfziger stark hinter den ‚Unternehmungen’ „Tristan und Isolde“ und „Die Meistersinger von Nürnberg“ zurück, um schließlich mit der Bekanntschaft von König Ludwig II. von Bayern als Festspiel realere Züge anzunehmen und für Wagner zur nationalen Aufgabe zu wachsen. Doch mit den Problemen des finanziellen Defizits nach der Erstaufführung und den daher notwendigen Konzerttätigkeiten in England versickerte das Gefühl des Triumphs schnell, und in den letzten Jahren seines Lebens fühlte sich Wagner nurmehr als stiller Beobachter der weiteren Aufführungstätigkeiten, ohne an erneute Bayreuther Festspiele zu glauben.
Diesen Weg genauer nachzuvollziehen hat zumindestens den einen Wert, wiederum die enge Verknüpfung zwischen der Schöpfung und den Bedingungen der Schöpfung zu sehen und den Eindruck der Integrität, Absolutheit und des unbedingten So-Seins, zu dem gerade sogenannte Meisterwerke verführen, zu relativieren.
Vielmehr zeigen jedoch die Äußerungen des Künstlers, der etwas schafft, was später als ‚Ausnahmewerk’ verstanden wird, inwieweit er ein Bewusstsein dafür entwickelt. Wie sich dieses Bewusstsein im Falle Wagners in Bezug auf den „Ring des Nibelungen“ in seiner Erweiterung von einer einzelnen Oper zu einem Zyklus entwickelte, soll der primäre Blickpunkt dieser Arbeit sein.
Die Annäherung an die überlieferten Äußerungen Richard Wagners trifft an erster Stelle auf die Schwierigkeit der Quantität und somit auf die Notwendigkeit der Selektion. Angesichts der Vielzahl an sekundären und tertiären Quellen über das, was Wagner gesagt und getan haben soll, und ihren oft stark unterschiedlichen, mehr oder weniger klaren Intentionen und Konnotationen bietet sich für einen begrenzten Umfang der alleinige Rückgriff auf Primärquellen an, in Bezug auf Äußerungen also Tagebücher, Briefe (privat / geschäftlich) und Schriften, wobei sich letztere zusammensetzen aus den theoretischen Schriften und den Artikeln und Reden in verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen u.Ä.
Tagebücher geben sicherlich den direktesten Einblick in die Gedankenwelt ihres Schreibers, da sie in den meisten Fällen ohne Adressaten sind, von dem man Antwort oder auch nur Reflexion erwartet, doch ihre hochgradige Spontanität macht es schwierig, eine über den Schreibmoment hinausreichende Geltung festzumachen.
Briefe sind als meist situative und halb-intentionale Äußerungen an spezifische Adressaten sowohl Spiegel des Schreibmoments mit seinen rationalen und emotionellen Inhalten, als auch der momentanen Beziehung zu einem Gegenüber und eines gewollten Eindrucks auf ihn. Der Aspekt des freien Aussprechens ist zwar stark an die Vertrautheit des Briefpartners gebunden, doch gerade dieses Gemisch aus gewollt und ungewollt Ausgesprochenem macht private Briefe zu reizvollen Abbildern des alltäglichen Spannungsfeldes zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein.
Schriften, die zur Veröffentlichung gedacht sind, haben dagegen meist nicht nur eine längere Entstehungszeit und somit ein höheres Maß an Durchdachtsein und bewusster Intentionalität in sich, sondern neigen darüber hinaus stärker zu einer an einer Allgemeinheit orientierten Ausdrucksweise. Sie verlieren so Spontanität und gewinnen an eher kontinuierlichen Gedankengängen. Ähnliches gilt für die anderen genannten Quellen, wenn auch in unterschiedlichem Maße.
Da Tagebücher von Wagner zum vorliegenden Thema zu wenig beitragen, kommen für die kontinuierliche Beobachtung eines längeren Zeitraums vor allem die Briefe in Frage, denn in Anbetracht des angestrebten Zieles, Einblick in die wechselnden Einstufungen des Rings über schriftliche Äußerungen Wagners zu bekommen, geben die theoretischen und politischen Schriften zwar eine weithin geistig entwickelte Position wieder, jedoch so wenig verdichtet, dass sie lediglich die geistige Grundlage, nicht jedoch die spezifischen Entwicklungen in der Positionierung darstellen. Ihre Aussagen müssen hierfür vorausgesetzt werden.
Ergeben sich damit die Briefe als hauptsächliche Quelle der Untersuchung, ist jedoch der Prozess der Einschränkung keineswegs abgeschlossen. Die derzeit bearbeitete Neuherausgabe der Wagner-Briefe zeigt, dass sie weit über 15 Bände füllen und die Zahl von 2000 übersteigen. Die notwendige Begrenzung ergibt nun zusammen mit der Frage der Verfügbarkeit ein derartig undurchsichtiges Netz an Selektionsentscheidungen, dass es nahezu unmöglich erscheint, dem Prozess des Ein- und Ausschließens von Briefen Transparenz zu bewahren.
Die daher erforderliche Bescheidenheit bei der Bewertung der Ergebnisse führt letztlich zu reiner „Betrachtung“ der vorkommenden Hinweise auf die Einordnung des Ringes als außerordentliches Werk in verschiedener Intensität und in einer Gegenüberstellung zu den dazugehörigen Rahmenbedingungen, ohne daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Wie bereits für die theoretischen Schriften gesagt, wird auch der biographische Hintergrund als vorhanden vorausgesetzt und infolgedessen nur zur Orientierung skizziert.
Zitatnachweise beziehen sich jeweils auch den gesamten Abschnitt bis zum vorherigen Nachweis ein. Ein Quellenverzeichnis entfällt, da nur zwei Quellen benutzt wurden:
Strobel, Gertrud und Werner Wolf (Hrsg.): Richard Wagner. Sämtliche Briefe, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik
- Band III. Briefe der Jahre 1849-1851, ²1983 [BA III]
- Band IV. Briefe der Jahre 1851-1852, 1979 [BA IV]
Biographische Übersicht
Die ersten Berührungen mit dem Nibelungen-Mythos finden kaum Niederschlag in Briefen und entziehen sich demgemäß einer dahingehenden Untersuchung. In den beiden frühen Schriften über den Mythos, einmal seine Beschreibung und Vorüberlegungen zu einer Dramatisierung in „Der Nibelungen-Mythus. Als Entwurf zu einem Drama“ (1848), dann als Gegenstand einer eingehenderen Untersuchung und interpretatorischen Ausweitung in „Die Wiebelungen. Weltgeschichte aus einer Saga“ (ebenfalls 1848), finden sich allerdings schon wesentliche Ansätze zu einer Auffassung des Stoffes, die weit über den reinen Mythen-Inhalt hinausgeht. Sind im „Nibelungen-Mythus“ schon alle wesentlichen Elemente des späteren Zyklus enthalten, so zeigt die „Weltgeschichte“, dass Wagner von vornherein in dem Mythos die Möglichkeit einer über den inhaltlichen Verlauf weit hinausreichenden Deutung gesehen hat.
Die Ausführung der Operndichtung „Siegfrieds Tod“, die Wagner im Zuge teils künstlerischer, teils politisch-revolutionärer Begeisterung in Dresden 1848 / 49 verfasst hatte, trafen auf die Notwendigkeit, im Exil vorerst ein festes finanzielles Standbein zu bekommen. So stand Wagner zwischen der eigenen Begeisterung und der seiner Freunde für das deutsch-nationale Sujet auf der einen Seite, und der Suche nach einem Opernstoff für das Publikum in Paris auf der anderen.
Die Vielzahl an Erwägungen, die Wagner vor allem bis Mitte 1850 in Bezug auf Opernstoffe anstellte, sei es „Jesus von Nazareth“, „Achilleus“, „Alexander der Große“ oder der dahingehend am weitesten bearbeitete „Wieland der Schmied“, die innere Unruhe, die er aus Deutschland mitgebracht hat, die Unsicherheit seiner künstlerischen und damit auch finanziellen Zukunft und nicht zuletzt die aus seinen sozial- und kunstrevolutionären Vorstellungen erwachsendenden hohen Ansprüche, die er an ein weiteres Werk stellte, verhinderten somit ein beständiges Arbeiten an „Siegfrieds Tod“. Liszts Bemühungen in Weimar brachten in diesem Zusammenhang letztlich nur eine geringe Stabilisierung.
In dieser Situation sah Wagner die Notwendigkeit für sich und die Öffentlichkeit, einige größere theoretische Vorüberlegungen anzustellen, die in „Oper und Drama“ und „Eine Mittheilung an meine Freunde“ ihre Manifestation fanden und zu denen auch der Gedanke an ein separates Theater und einer dazugehörigen Künstlerschule gehörten. Schon vorher hatte sich im Fortgang der Komposition an „Siegfrieds Tod“ zudem die Überzeugung ergeben, dass eine Ausgestaltung der restlichen Elemente des Mythos notwendig wird. Die Ausführung der Gesamtdichtung dauerte dann bis ins Jahr 1853.
Festzuhalten bleibt bis dahin, bevor nähere Betrachtungen der Briefe auch mehr Einzelheiten dieser Entwicklungen bringen werden, die anfängliche Beziehung, die zwischen dem ungeminderten weltumstürzlerischen Geist Wagners und dem Fortschreiten der Arbeit an „Siegfrieds Tod“ besteht. Nicht nur, dass hierbei die ursprüngliche Funktion des Werkes für Wagner offensichtlich wird, das ihm, wenn auch nicht als eigentliche Herbeiführung, so doch als künstlerisches Abbild der allgemeinen Menschheitsrevolution zur Aufführung nach seiner Vollendung erschien - in diesem Zusammenhang sind auch die immensen theoretischen Vorarbeiten zu sehen. Vielmehr verbleibt auch die Fragen nach den Motiven, die auf der einen Seite zur umfangreichen Ausweitung des kompositorischen Vorhabens führten, auf der anderen Seite aber zeitweilig erhebliche Verschiebungen in den Ansprüchen an das Werk und seine Wirkung herbeiführten.[2]
Juni 1849 bis Oktober 1849 - „Ich muß jetzt an eine tüchtige arbeit gehen ...“
Betrachtet man die Formulierungen zu Beginn des Untersuchungszeitraumes, ist „Siegfrieds Tod“ in diesen noch völlig in den allgemeinen Aspekt des Tätigwerdens eingebunden, wie auch in die Abgrenzung der „letzte[n] deutsche[n] dichtung“[3] - mit allen Konnotationen von „deutsch“ - von den Verpflichtungen in Paris. Dabei schwingt die Sehnsucht nach abgesicherter Ruhe zum Schaffen immer mit, hier noch eng an Minnas Verbleiben gebunden, sowie die Feststellung einer ausschließlichen Begabung zum Opernschreiben:
„Ich muß jetzt an eine tüchtige arbeit gehen, sonst vergehe ich: um jetzt aber arbeiten zu können bedarf ich der ruhe und einer heimat: ist meine frau bei mir - und in dem freundlichen Zürich - werde ich beides finden. Nur Eines habe ich vor mir, und Eines kann und will ich immer froh und freudig thun: arbeiten, d. h. für mich: opern schreiben. Zu allem übrigen bin ich untauglich [...]“[4]
Die Ablehnung jeglicher anderer Verpflichtung und Tätigkeit ist nicht zuletzt mit einer selbstverständlichen Forderung nach Absicherung der Lebensgrundlage verbunden, die Wagner mehrere Male an seine Freunde stellt, allen voran an Liszt. Hinzu tritt das weitere Ersuchen um Unterstützung durch Personen, die er fast im gleichen Atemzug in seinen politischen Äußerungen anklagt, so zum Beispiel die Familie Ritter oder den Weimarer Hof. Das sei nur deswegen erwähnt, um die Selbstverständlichkeit zu kennzeichnen, mit der Wagner Unterstützung seiner künstlerischen Pläne unabhängig seiner weiteren Äußerungen und sogar der intendierten Ausrichtung seiner Pläne fordert und auch erwartet, wobei er auf die Ehrenhaftigkeit der Kunst und die Freiheit des Künstlers verweist.
Innerhalb der künstlerischen Pläne erscheint „Siegfrieds Tod“ vorerst ‚nur’ neben „noch 2 tragische[n] und 2 komische[n] opernstoffe[n] im kopfe“[5]. Doch ist er entgegen den anderen Ideen als Dichtung in Dresden schon so weit gediehen, dass Wagner einigen Freunden in Zürich „etwas von mir vorlas“, worauf er das Angebot bekam, weitere Vorlesungen für „ein gewähltes kleines Publikum“ zu halten.[6] Diesen frühen Hinweis auf gerichtete Selektion bei den Rezipienten, nicht also allein durch Interesse und Desinteresse, sondern vorherige Bestimmung, quittiert Wagner nur mit dem Verweis auf den zu erwartenden Ertrag.
Nach der Ankunft Minnas in Zürich wird Wagner weit direkter als vorher mit ihrer Forderung konfrontiert, sich in Paris zu etablieren, was Wagner mit einer „innerlichen Abneigung“ gegen derartig „renommistisch[e]“[7] Gesinnung ablehnt. Woher die starke Antipathie gegen das Pariser Kunstleben kommt, muss hier außen vor bleiben.
Im Kontrast dazu stehen seine Versuche, den Text „Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage“ in die verlegerischen Hände von Otto Wigand zu bringen. Dass ihm diese wie auch seine anderen theoretischen Schriften so wichtig sind, erklärt er so:
„Unbedingt nothwendig ist es mir aber diese arbeiten zu machen und in die welt zu schicken ehe ich in meinem unmittelbaren künstlerischen produzieren fortfahre: ich muss mir selbst, und diejenigen, die sich für mein künstlerisches wesen interessiren, müssen mit mir sich einmal zu einer präzisen verständigung herbeilassen, sonst tappen wir alle zusammen ewig in einem widerlichen helldunkel herum [...]“
Was in dem „gewählten kleinen Publikum“ schon angedeutet war, wird hier offensichtlich: Von einer übergreifenden Heranführung an ‚die Welt’ ist hier in keinster Weise gedacht; das Werk und sein Verständnis ist noch vollkommen in die verschworene revolutionäre Gemeinschaft eingebunden. Deutlich wird das auch an dem Vorschlag Wagners, die Veröffentlichung als „subscription unter den radikalen mitgliedern der kapelle [in Dresden] zu veranstalten“[8].
Nach dieser Absicherung ‚seinen Siegfried’ komponieren zu können ersehnt er sich mit tiefster herzensaufrichtigkeit“, nicht zuletzt, um seinen „unfreiwilligen Pariser opernprojecten [...] ausweichen zu können“.[9]
Diese Grundzüge, Ausführung durch theoretische Schriften Interessierten verständlich gemachter Vorgedanken, Absicherung der Lebensgrundlage durch Freunde als Schaffensgrundlage und danach Hinwendung zur einzig ersehnten Tätigkeit bestimmen noch längere Zeit Wagners Äußerungen zu „Siegfrieds Tod“. Ein außerordentlicher Eigenwert des Werkes ist dabei noch nicht erkennbar.
Bei den Überlegungen zur weiteren Finanzierung seines Lebens, erscheint jedoch eine interessante Formulierung:
„So handelt es sich denn darum: wie und woher verschaffe ich mir zu leben? - Ist meine fertige arbeit: Lohengrin, nichts werth? Ist die oper, die es mich jetzt durchaus zu vollenden treibt nichts werth? Allerdings, der gegenwart und ihrer öffentlichkeit, wie sie ist, müssen sie als luxus erscheinen! Wie steht es aber mit den wenigen, die diese arbeiten lieben? Sollten sie dem armen, nothleidenden schöpfer nicht lohn, sondern nur die möglichkeit fortschaffen zu können, darreichen dürfen?“
Insbesondere im weiteren Abschnitt über die Unmöglichkeit, zur Geldbeschaffung zu anderen, als zu „fürstlichen Menschen“ - nämlich fürstlich freigiebigen - zu gehen, taucht wieder der Gedanke einer begrenzten (ausgewählten) Menge an Unterstützern auf, hier sogar als „gnade“ bezeichnet, was vor dem Hintergrund seiner „luxus“-haften Werke verständlich ist. Von großer Wichtigkeit auch für das Verständnis von Wagners Reaktion auf das letztliche Defizit nach den Festspielen ist jedoch festzuhalten, dass Wagner der „öffentlichkeit“ gar keinen Vorwurf für ihr Desinteresse macht, sondern dieses in Hinblick auf das So-Sein der meisten Menschen nicht nur versteht, sondern sogar erwartet.[10] Dass dies noch weiterhin mit der Erwartung eines großen Wandels verbunden ist, zeigt folgende Briefstelle:
„Meine arbeit wird für das, was es mich drängt nach dieser seite hin von mir zu geben, ziemlich erschöpfend [...] aber ich hoffe zuversichtlich, daß das interesse, welches sie verbreiten wird, nicht ein nur vorübergehendes tagesinteresse, sondern ein stoffreiches u. stoffgebendes anhaltenderes hervorrufen soll.“[11]
Doch wie viel vorsichtiger als seine politischen Schriften kurz vorher ist das formuliert!
Juli 1850 bis November 1850 - „Das muß ich sagen: - du bist ein freund!“
Nach den Krankheitsanfällen im Winter 1849/50 und den [12] stürmischen Entwicklungen von März bis Juni 1850 um Jessie Laussot und eine beinahe Trennung von Minna sah sich Wagner im Sommer 1850 von wesentlich freundlicheren Bedingungen umgeben: Die neue Wohnung in Zürich, die finanzielle Unterstützung durch Familie Ritter und vor allem die wiederholten Freundschaftsdienste, die Liszt ihm erwies.
Letztere bestimmten auch wesentlich die Wiederaufnahme der Arbeit an „Siegfrieds Tod“. Nach der Unterbrechung der Arbeit für seine theoretischen Schriften und der letztlich reinigenden Wirkung der zurückliegenden Ereignisse hatte sich die Situation in Hinblick auf ihre Bedeutung stark verändert.
Wagners sonstige Arbeiten, wie etwa die nach März 1850 nicht mehr weiterentwickelte Prosafassung von „Wieland der Schmied“, verschwinden nach und nach aus seinem Kopf, die Begeisterung, die ihn erfasst, seine Vorstellungen für die Zukunft des Musikdramas fokussieren sich zunehmend auf das Werk, das er schon nur noch „Siegfried“ nennt.
Anlass der neuen Schaffenskraft ist ein Juli 1850 geschriebener Brief von Liszt, in dem dieser erneut seine volle Unterstützung für Wagners Vorhaben zusagte. Der Antwortbrief Wagners Ende Juli 1850 ist voller Dankesworte, auch wenn eine undeutliche Distanz verbleibt - die Wagner dem einem Brief an Julie Ritter Ende Juli 1850 auch anspricht:
„Dieser Liszt ist für mich zu rührend: ein gutes stück von mir bleibt ihm fremd und unbegreiflich, und doch bringt ihn seine liebe dahin, mit mir wie mit einem rohen eie umzugehen, sich ganz zu verleugnen, um mich nie auch nur im mindesten unsanft zu berühren. Das ist doch etwas werth!“[13]
Dass sich diese freundschaftliche Geste aber mehr als günstig auf Wagners Elan auswirkte, zeigt der weitere Verlauf des Briefes an Liszt. Nach einem längeren Abschnitt über die zukünftige Genossenschaft in der Kunst und der überragenden Bedeutung des darstellenden Künstlers, sowie der Behauptung, jeglichen Sinn für Ehrgeiz verloren zu haben, spricht Wagner von der Zukunft ‚seines Siegfried’:
„In einer kurzen vorrede[14] erkläre ich mich darüber, daß ich für die aus- und aufführung dieses werkes hoffnungslos sei, und es somit nur als absicht meinen freunden mittheile. [...] Nun bietest Du mir die künstlerische genossenschaft an, die den Siegfried zu tag bringen könnte: - ich fordere darsteller für heroen, wie sie unsre scene noch nicht gesehen hat; wo sollen die herkommen?“[15]
Wird im ersten Satz die Verstärkung des Aspekts der unmöglichen Aufführung sichtbar, der schon vorher im Gedanken des desinteressierten und verständnislosen Publikums lebte, so bietet der zweite zum ersten Mal eine Formulierung, die dem Werk ausschließliche Erstmaligkeit zuspricht.
Im Weiteren spricht Wagner die Überzeugung aus, dass Liszt in Weimar eine dementsprechende Erziehung der Darsteller erreichen könnte und verwirft die Bedeutung des Lohengrin für sein weiteres Wirken außer als Geldquelle - letzteres relativiert sich angesichts der großen Anstrengungen, die Wagner Liszt gegenüber in die künstlerische Vorbereitung einer Aufführung setzt.
Wie dem auch sei, Wagners Begeisterung über Liszt findet sich auch in Briefen an andere Personen wieder, ob an Julie Ritter (etwa 20. / 21. Juli 1850) oder an Theodor Uhlig (27. Juli 1850).
In letzterem Brief spricht Wagner auch mit das erste Mal davon, die Komposition „für die Weimarische Gesellschaft ganz ausdrücklich“[16] zu beendigen. Der Aspekt, das Werk und später den Werkkomplex ‚ausschließlich’ für diese oder jene Person oder Personengruppe zu schreiben, taucht auch später verschiedentlich auf, ebenso die enge Kausalität zwischen Aufführbarkeit und Ausführung, die sich jetzt zeitweise aufbaut.
Letzterer Aspekt wird u.a. im gleichen Brief deutlich, indem Wagner den Grund seiner Wandlung erklärt:
„Ich hatte vor, wieder ein buch zu schreiben: die erlösung des genie’s, das Alles umfassen sollte [...] Was würde ich aber damit anrichten? neue confusion [...] Drum spukte mir immer schon die dichtung des Achilleus durch den kopf [...] Nun theilst Du mir mit, daß Wigand schon den Siegfried nicht drucken will. Gott sei lob! der ist vernünftiger als ich. [!] - Da kommt Liszt, und bestellt den Siegfried zur aufführung in Weimar. Das war das rechte! - bringen sie in Weimar den Siegfried halbweg zum verständnis, so muß mir das wichtiger sein als alles: was man mit händen greift, glaubt man, - und sind’s nicht viele, so sind’s doch mehre, als ich je durch die lectüre gewinnen und überzeugen würde.“[17]
Eine neue Qualität erhalten Wagners Überlegungen mit der Vorstellung eines separaten Theaters, der wohl erstmals (schriftlich) in einem Brief an Ernst Benedikt Kietz im September 1850 auftaucht:
„Ich denke daran, den Siegfried wirklich noch in musik zu setzen, nur bin ich nicht gesonnen, ihn auf’s geradewohl vom ersten besten theater aufführen zu lassen: im gegentheil trage ich mich mit den allerkühnsten plänen, zu deren verwirklichung jedoch nichts geringeres als mindestens die summe von 10,000 Thaler gehört. Dann würde ich nämlich hier, wo ich gerade bin, nach meinem plane aus bretern ein theater errichten lassen, die geeignetsten sänger dazu mir kommen und Alles nöthige für diesen einen besonderen fall mir so herstellen lassen, daß ich einer vortrefflichen Aufführung der oper gewiß sein könnte. Dann würde ich überall hin an diejenigen, die für meine werke sich interessiren, einladungen ausschreiben, für eine tüchtige besetzung der zuschauerräume sorgen und - natürlich gratis - drei vorstellungen in einer woche hintereinander geben, worauf dann das theater abgebrochen wird und die sache ihr ende hat. Nur so etwas kann mich noch reizen.“[18]
In diesem Abschnitt finden sich nicht nur alle Elemente des Wagnerischen Ideals eines Bühnenfestspiels, wenn man von seinen später noch vordergründiger entwickelten nationalistischen und erzieherisch-erleuchtenden Wunschwirkungen absieht, sondern gleichzeitig alle Elemente, die zu seiner Nichterfüllung führen werden bzw. seine generelle Ausführung weit in die Zukunft verschieben.
Vom Scheitern bzw. vom schrittweisen Aufgeben jedes Versuches, die Oper „Siegfrieds Tod“ in Weimar unterzubringen, zeugt der Beginn, verbunden mit einem Hauch von Endzeitstimmung, die zur extrem pessimistischen Grundhaltung des Briefes gehört. Wagner schwankt in seinen Stimmungen zu jener Zeit wieder stark, was sich nicht zuletzt aus der unveränderten Diskrepanz zwischen seiner Vorstellung der Entwicklung der Welt und ihrer realen Entwicklung ergibt. Diese Erwartungshaltung, die Wagner gegenüber der bald erhofften Menschheitsrevolution aufbringt, so etwa auch bei den Pariser Unruhen 1850/51, ist für seine Beziehung zum späteren Nibelungen-Zyklus von fundamentaler Bedeutung. Dies gilt weniger insofern, dass Wagner seinem Werk und seiner Wirkung einen wesentlichen Einfluss auf ebenjene Revolution zuspricht, vielmehr sah er selbst in seinen revolutionärsten Zeiten die Revolution in der Kunst immer als Folge, nicht als Voraussetzung der allgemeinen Menschheitsrevolution. Dementsprechend sieht er natürlich erst dann Chancen für ein Werk, das bereits den Bedingungen eines Zustandes nach der Umstürzung der bisherigen Verhältnisse gehorcht, wenn jene stattgefunden hat.
Das wiederum heißt, dass Wagners Hoffnung auf eine Aufführung entsprechend seiner Hoffnung auf die erwartete Wende sinken müsste, was wiederum heißt, dass angesichts seines späteren gemäßigteren Herangehens an die Welt, in dem er sowohl seine Beteiligung an der Revolution als auch seinen Antisemitismus relativiert zu Gunsten eines stärkeren Nationalismus, die Ausführung einer Siegfried-Oper und erst recht eines Festspiel-Gedankens nie stattgefunden haben müsste. Dass das nicht der Fall ist, wirft ein interessantes Licht auf die Bedeutung von Wagners theoretischen Schriften bzw. Gedanken für sein Handeln.
Dass Wagner kein Wissenschaftler und Rationalist war - zumal auch ein Wissenschaftler nicht gezwungenermaßen rationaler handeln muss, nur weil er sich rationalistischer äußert - und auch kein Kopfmensch, steht außer Frage. Im Falle des Ring-Zyklus aber, der wohl mehr als jedes andere Werk von Wagners politischen Ambitionen geprägt war, stellt sich bei deren Zurückdrängung viel mehr die Frage nach einer darüber hinausreichenden Motivation, die schließlich nicht unerhebliche Schwierigkeiten der Verwirklichung überwand.
Das Fantasiebild, das Ideal, das Wagner beschreibt, muss ihm wohl selbst teils als reine Gedankenspielerei vorgekommen sein, bar jeder Realitätsbindung. Und doch drückt der letzte Satz eine derartige Ausschließlichkeit nicht nur für das Schaffens, sondern - vor allem im Zusammenhang - sogar für den Lebenswillen aus, dass sich der Gedanke aufdrängt, dass sie die eigentliche Voraussetzung des Projektes bildet.
Das würde bedeuten, dass allein die Ausschließlichkeit und damit verbunden auch die übermächtige Großartigkeit des Festspiel-Vorhabens genug Energie freisetzte, um Wagner ‚am Ball zu halten’, mit allen Rücksichtslosigkeiten, die damit verbunden waren. Es wäre der innere Ursprung der Außenordentlichkeit des Werk-Zyklus weniger in den hochtrabenden politischen und kunsttheoretischen Vorstellungen Wagners zu suchen, als in der lebensspendenden Kraft, die aus einem scheinbar unerreichbaren und gleichzeitig strahlend schönem Idealbild geschöpft werden kann - erst recht, wenn er sich selbst als deren Bewältiger vorstellte.
Daraus allgemeinere Schlussfolgerungen für die Ursache des Dranges nach Großartigkeit bei Künstlern oder gar allen Menschen zu ziehen, würde jedoch in diesem Rahmen etwas weit greifen. Daher sei nur das Bild eines Schaffenden entworfen, der sich zum Schaffen motiviert, indem er sich vor Augen führt, nahezu Unerreichbares zu erreichen und gleichzeitig genau daraus erst die Kraft schöpft, dieses nahezu Unerreichbare zu erreichen: ein kreatives Perpetuum mobile.
Für Wagner brachte der Winter jedoch wie immer vorerst Stillstand aller umfangreicherer Tätigkeiten. Über seine großen Pläne hatte er nur bei Uhlig noch einmal ausführlich gesprochen (20. September 1850), während er Liszt gegenüber darüber - verständlicherweise - schweigt; sonst sind es immer nur kurze Bemerkungen.
Es ist auch nunmehr die Arbeit an „Oper und Drama“, die ebenso eine Weiterarbeit an der Oper verschob. Die Motivation dazu beschreibt Wagner z.B. so:
„Ich hatte ein ganzes leben hinter mir aufzuräumen, alles dämmernde in ihm mir zum bewußtsein zu bringen, die nothwendig mir aufgestiegene reflexion durch sie selbst - durch innigstes eingehen auf ihren gegenstand - zu bewältigen, um mich mit klarem heiteren bewußtsein wieder in das schöne unbewußtsein des kunstschaffen’s zu werfen. So räume ich diesen winter noch vollends hinter mir auf: ich will ohne irgend welche last frei und leicht in eine neue welt eintreten, in die ich nichts mit mir bringe, als ein frohes künstlerisches Gewissen.“[19]
Es ist der bedeutende Gedanke der Katharsis vor dem Arbeiten für die Kunst, als ‚reiner Künstler’ in jedem Sinn des Wortes. Die tiefe Weihe, die also das Kunstschaffen voraussetzt, ist ein Bild, das unmittelbar in das Werk mit eindringt und sich bis in die Gestaltung seines Umfeldes, des Festspiels, und die Haltung seiner Besucher hineinträgt.
Damit wird dem Zug der Selbstbewährung vor dem Kunstwerk der von Wagner wesentlich stärker artikulierte des Dienstes an der Kunst hinzugesetzt.
Doch auch nach dieser Reinigung schiebt Wagner das Tätigwerden jeden Monat weiter von sich weg. Beschäftigt mit der Sorge um finanzielle Absicherung, die er einmal mehr zur Vorbedingung des Schaffens macht, bricht sich erst seit dem Mai 1851 die schon im Winter angedachte Idee Bahn, den Opernstoff bis zu seiner letztendlichen Gestalt auszuweiten.[20]
Mai 1851 - „...nie mehr ein allgemeines, abstraktes Publikum vor Augen ...“
Wieder ist es Uhlig, dem Wagner als Erstem von einer Änderung seiner Pläne berichtet. Am 10. Mai 1851 schreibt er, wie ihn den Winter über „eine Idee geplagt“, die mit der alten Geschichte des Burschen zusammenhängt, der auszieht, das Fürchten zu lernen.
„Denke Dir meinen schreck, als ich plötzlich erkenne, daß dieser bursche niemand anders ist, als - der junge Siegfried [...]“. Letzteres gibt dem neuen Teil auch seinen Namen.
Zu dem Schein von Banalität, den die Mitteilung dieser Entscheidung begleitet, kommen fast psychologische Überlegungen zur Funktion eines thematisch leichter gearbeiteten Teiles vor „Siegfrieds Tod“:
„Der ‚junge Siegfried’ hat den ungeheuren Vortheil, daß er den wichtigen Mythos dem publikum im spiel, wie einem kinde ein märchen, beibringt. Alles prägt sich durch scharfe sinnliche Eindrücke plastisch ein, alles wird verstanden, - und kommt dann der ernste „Siegfried’s tod“, so weiß das publikum Alles, was dort vorausgesetzt oder eben nur angedeutet werden mußte - und - mein spiel ist gewonnen, - um so mehr, als sich an meinem, bei weitem populäreren, dem bewußtsein durchaus näher liegenden, minder heroischem als heiteren, jugendlich menschlichen „jungen Siegfried“ praktisch die Darsteller üben und vorbereiten, die gewaltigere Aufgabe von „Siegfrieds tod“ zu lösen. - Beides werden aber an sich zwei ganz selbständige Stücke, die nur zum erstenmale dem publikum in der reihenfolge vorzuführen sind, dann aber ganz für sich - nach Belieben und vermögen - gegeben werden können. Auch habe ich nie mehr ein allgemeines, abstraktes Publikum vor Augen, sondern ein bestimmtes, dem ich mich nach meiner absicht mittheile um von ihm verstanden zu werden.“[21]
Auch hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Völlig anders als zu Beginn festgestellt, scheint dem Stoff und seiner Behandlung keinerlei Verbindung zum Revolutionären mehr innezuwohnen, scheint völlig auf sich selbst verwiesen als „wichtiger Mythos“. Auch sein Zielpublikum ist keines, das nach dem gesellschaftlichen Umsturz gereinigt geschlossen offen wird für eine Botschaft der neuen Zeit, sondern ein völlig normales, wenn auch interessiertes Opernpublikum, dem das Werk nahegebracht werden muss, das behutsam an schwierige Aussagen und Klänge herangeführt wird.
Nahezu „profan“ wirkt die schließliche Feststellung, dass nunmehr die Vermittlung einer Absicht im Vordergrund steht, nicht also das Teilen mit anderen Wissenden, nicht die Darstellung des neuen Menschen per se, sondern eine Geschichte mit wichtigen, aussagekräftigen Elementen, die „unter die Leute“ gebracht werden soll. Dies ist allerdings insofern zu relativieren, dass Wagner nicht nur in den Verhandlungen mit Breitkopf & Härtel über die Drucklegung entweder von Lohengrin oder vom „jungen Siegfried“ darüber spricht, letzteren „sogleich bei seiner Geburt meinen Freunden vollständig vorlegen zu können“[22], sondern auch große Anstrengungen in seine „Mittheilung an meine Freunde“ investiert. Das Gefühl, nur an bestimmte, von vornherein Interessierte heranzukommen, ist vorherrschend.
Ebenso ist die Intention eines pädagogischen Gehalts des „jungen Siegfrieds“ bemerkenswert als mehr oder weniger logische Vorwegnahme des erweiterten Festspielgedankens, der nicht nur das separate Theater, sondern auch die damit verbundene spezielle Sängerschule beinhaltet.
Gerade, was die jetzt entstehende Distanz zu den vorherigen theoretischen Ausführungen und die größere Annäherung an Kunst- und Kunstbetrieb-interne pragmatische Fragen angeht, ist der folgende Brief an Zigesar noch aufschlussreicher:
„Wenn ich mich in Schriften und namentlich auch neuerdings in einem Buche, welches unter dem Titel „Oper und Drama“ erscheinen wird, umständlich über den Gegenstand der Kunst und ihrer Stellung zum Leben ausgelassen habe, so konnte mich dazu nur Eines bestimmen, nämlich die Aufstellung meines Ideales, und zwar eines Ideales, wie ich es für die Menschheit erreichbar halte. Der Künstler, oder der Mensch, der nie dazu gelangt, im Gegensatz zu dem gerade jetzt Bestehenden, sich ein Ideal zu gestalten, in welches er sich die edelste Fähigkeit seines Geistes als Wunsch der Seele setzt, der wird auch nie dazu kommen, nur einen Schritt aus dem Kreise der Gemeinheit heraus zu thun. Nur aus der Kraft dieses Ideales gewinnt er die Macht, sich über das Gewohnte zu erheben, und an dem, was wir Fortschritt und Weiterentwicklung nennen, Theil zu nehmen. Um dieses Ideal in seiner erkenntlichsten Reinheit hinzustellen, muß ich es aus irgend welchem Einflusse des Bestehenden vollkommen befreien: ich muß dieses Bestehende daher zuallernächst verneinen, es in seiner Nichtigkeit darstellen, ehe ich den Boden gewinne, auf dem mein Ideal begriffen werden kann, und zwar so begriffen, daß ich aus der Überzeugung davon die Kraft und den Muth gewinne, schon jetzt das Nächste zur Erreichung meines Ideales thun zu können, d. h. etwas Neues zu schaffen.“[23]
Die Abgeklärtheit und Folgerichtigkeit dieser Passage, sowohl in Bezug auf Wagners Biographie als auch in Bezug auf die dargestellte Verschiebung der Wichtung seines Schaffens, zeugt nicht zuletzt von einer inneren Gesundung, die, wenn auch nicht Frieden, denn noch immer sieht Wagner wenig Chancen für seine Werke, so doch mehr Willen zur freundlichen Auseinandersetzung mit der Welt im Allgemeinen bewirkt. Dass dies nicht heißt, dass Wagner von seinen sozialen Idealen abweicht, sondern lediglich, dass er auf der Suche nach neuen, diplomatischeren Wegen ihrer Erreichung ist, zeigt der folgende Abschnitt:
„Ueberall da, wo ich mich nun im wirklichen Leben unmittelbar mit dem Bestehenden berühre, müßte ich der unfähigste Mensch bleiben, wenn ich diesem nicht auf eine Weise beizukommen suchte, daß ich einen möglichen Erfolg anstrebe und erreiche: hier habe ich das Bestehende nur in dem Sinne zu verneinen, daß ich mich seiner in einer edelsten Absicht bemächtige, in einer Absicht, die ich wiederum nur aus meinem Ideale fassen kann, und die das Bestehende nur dadurch vernichtet, daß sie es veredelt und erhebt.“[24]
So ist auch die darauffolgende Bitte an Zigesar und indirekt an die restliche Welt zu verstehen, seine kritischen Bemerkungen nie als gewollte Kränkung aufzufassen, sondern lediglich als Analyse einer problematischen Position, aus der heraus jedoch in gleicher Weise die Veredelung der Welt möglich sei. In einigen heftigen Momenten, wie in einem Brief an Kietz vom 2. Juli 1851, tritt jedoch der Revolutionär in ihm hervor, zum diesem Zeitpunkt auch angesichts der Unruhen in Paris vor der endgültigen Machtübernahme Napoleon III. Doch für sein Schaffen und sein Verständnis davon hat dies wohl zu diesem Zeitpunkt weniger Bedeutung gehabt.
Die Inschutznahme des Publikums, die in Briefen an Liszt teils sehr heftig geschieht und sich auf die notwendige Unkenntnis des Publikums als Publikum stützt, beleuchtet diese Entwicklung aus einer anderen Richtung, führt aber ebenso zu Wagners Aussagen über die Vermittlung der Absicht.
Darin gliedert sich auch die zunehmende Betonung des Individuums, speziell des künstlerischen Individuums, als Wirkkraft zum Besseren - im Gegensatz zur vorherigen Revolution - wie auch die zu Liszt geäußerten Gedanken an ein „Originaltheater“ ein[25]. Auch in dieser Verlagerung ist ein wesentlicher Schlüssel zum Entschluss Wagners zu sehen, mehr als nur eine Oper[26] oder auch eine ernste Oper mit heiterer Voroper zu schreiben.
Wagners wieder größere Kompromissbereitschaft, was die Aufführung des Werkes angeht, zeigt der Auftrag, eine Oper für Weimar zu schreiben, wofür Wagner Vorschüsse im Juli und Oktober annahm, sie dann aber wieder zurückzahlte. Dieser letzte Ansatz einer ‚normalen’ Aufführung wurde erst nach der letztendlichen Ausweitung auf den Zyklus zu Fall gebracht.[27]
September bis November 1851 - „Mit dem Siegfried noch große Rosinen im kopfe ...“
Nach Abschluss der dichterischen Arbeit am „jungen Siegfried“, begleitet von mehreren Verhandlungen mit Theatern über Aufführungen des Tannhäuser, sowie den dazugehörigen Korrektur- und Kopierarbeiten, begibt sich Wagner vom 15. September bis zum 23. November in die Wasserheilanstalt Albisbrunn bei Hausen. Sein Gedanke ist, „mich vollkommen gesund zu machen, damit ich auch eine recht gesunde Musik schreibe.“[28]
Die heilende Wirkung dieses Ortes wirkt sich deutlich auf Wagners Gedanken aus, wie er selbst formuliert:
„Sonderbar war es, wie mich in den ersten 8 tagen die theorie und abstraktion noch plagte: es war dieß wie eine gehirnkrankheit, ein ewiges kreuzundquerschießen abstrakter kunsttheoretischer gedanken, die ich Dir gern sogleich zu verarbeitung mittheilen wollte, um sie nur los zu werden: dennoch fühlte ich, daß ich sie auch an Dich doch etwas umständlicher hätte qualifiziren müssen, und dieß eben hätte mich immer tiefer wieder hineingebracht. Jetzt schwindet es mir allmälig immer mehr wie graues gewölk aus dem hirne: ein wohlthätige entschleimung durch die nase hat sich eingefunden, und meine sinne befriedigen sich allmälig immer mehr an der gegenwart und dem, was sie unmittelbar wahrnehmen. So denke ich zu einem glücklichen menschen zu gesunden, und meine kunstgedanken, wenn anders etwas nöthiges an ihnen war, theile ich Dir ein andermal mit.“[29]
Ohne die komplizierte Beziehung zu Minna Wagner noch einbeziehen zu wollen, so ist doch an der Ungeduld, mit der Wagner auf die Verzögerungen eines Besuches ihrerseits Anfang Oktober reagiert, zu bemerken, auf wie dünnem Eis er sich trotz seiner sonst so heiteren Briefe bewegte. Das sei nur zur Verdeutlichung der Situation erwähnt; hier muss - wie in Wagners Stimmungsschwankungen sonst auch - u.a. auf seine lebenslange psychosomatische Anfälligkeit und auf die aufreibende Allergie (Wolle) und Hauterkrankungen verwiesen werden.
Wichtig ist nur zu sehen, dass Wagner häufig die Momente seiner Übellaunigkeit als Momente der gedanklichen Klarheit empfindet, in der ihm all die Schlechtigkeit der Welt aufgeht:
„ [...] meine laune ist etwas ernst, und ganz dazu gemacht, mich in täuschungen klar sehen zu lassen.“[30]
Es kann nur gemutmaßt werden, dass viele seiner heftigen Kritiken der Klarheit der Übellaunigkeit entsprungen sind.
Selbst die Abgeschlossenheit der Kur bringt Wagner nicht zu der Ruhe, die er sich erhoffte. Nach einer Phase der Glückseligkeit und Heiterkeit, entwickelt er im Oktober wieder all den Hass auf die „Welt der halbheit“, in der es nur Freude sei, „nach lust und laune einmal ohrfeigen auszutheilen“. Den Bemühungen von Intendanten und Breitkopf & Härtel um seine Werke bescheinigt Wagner in dieser Stimmung nichts als Degoutanz.[31]
Und genau im selben Brief äußert Wagner erstmals die Vorstellung, die zum letztendlichen Ring-Zyklus führt:
„Mit dem Siegfried noch große Rosinen im kopfe: drei Dramen, mit einem dreiaktigen Vorspiele. - Wenn alle deutsche theater zusammenbrechen, schlage ich ein neues am Rheine auf, rufe zusammen und führe das Ganze im laufe einer Woche auf.“[32]
Wagners den Brief abschließende Hoffnungen auf Besserung seines Zustands, denen er absolute Macht über den weiteren Verlauf zuspricht, gehen unmittelbar danach teilweise in Erfüllung, wie ein Brief an Minna zeigt.
Auch der nächste Hinweis auf das Gedeihen der neuen Idee geht an Uhlig:
„Ach, wenn ich den Liszt noch aus seinen hofillusionen herausbekäme, das wäre vortrefflich: es gehört eigentlich noch zu meinen werken. Mein weimarischer Siegfried wird immer problematischer, - nicht aber der Siegfried selbst: denn so viel ist gewiß, ich mache nur noch in der Kunst, in nichts anderem mehr, ausgenommen etwas entschiedenes menschenthum.“[33]
Kurz danach gibt es einen weiteren, vagen Hinweis zu Kietz:
„Wenn ich nun wieder auf dem Zeuge bin, geht es an das Komponiren.“[34]
Ebenso vage bleiben die Hinweise auch in anderen Briefen, wie an von Bülow (30. Oktober), in dem Wagner lediglich mit Verweis auf seine Gesundheit schreibt, dass er zwar viel an Liszt zu schreiben hätte, es aber noch verschieben müsste. Doch verspricht er im gleichen Brief für den Winter eine neue Oper, die „nützet mir, und schadet Euch gewiß nicht. Mein „Vorwort“ wird dafür sorgen.“[35]
An Herwegh heißt es dazu: „Viel Pläne habe ich wieder (leider) gefaßt.“[36]
In diesem Zusammenhang muss die „Mittheilung an meine Freunde“ noch einmal erwähnt werden. Fast noch mehr als um seine vorherigen Opern, kümmert sich Wagner in dieser Zeit um die Drucklegung dieses „Vorworts“, das ihm so sehr als Freifahrtschein zum Verständnis seines neuen Werkes erscheint, dass er es nach den konzeptionellen Veränderungen seiner diesbezüglichen Pläne in großem Umfang erweitert.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Entpolitisierung, die Wagner in dieser Schrift nach Bedenken von Breitkopf & Härtel vornimmt, da er „mit diesem buche nichts weniger als eine, jetzt so unzeitige, politische Demonstration im Sinne hatte“.[37]
Betrachtet man die Formulierung genauer, wird klar, dass Wagner, wie schon angedeutet, nicht seine Hoffnung auf eine revolutionäre Wende aufgegeben oder gar seine politische Einstellung geändert hat, sondern lediglich eine größere Priorität auf sein Wirken in der Kunst legt, die Öffentlichkeit braucht und daher sich um diplomatischeren Umgang mit seiner Umgebung bemüht.
Wagners weiterer Bericht über sein neues Konzept nehmen sich sehr „unaufgeregt“ aus:
„Den Winter werde ich prinzipiell gesundheit faullenzen, und nur entwerfen, wie es grad’ kommt. Ich hab 3 Dramen (wovon die beiden Siegfriede Nr: 2 u. 3 ausmachen) und ein großes Vorspiel vor. Wenn Alles fertig ist gedenke ich’s auch schon auf meine Weise aufzuführen: mit Weimar werde ich daher brechen müssen. (Das bleibt unter uns.)“[38]
Nachdem er dann am 11. November nur kurze Stichworte an Uhlig abgibt („Vorspiel: der raub des Rheingoldes. I. Siegmund und Sieglind: der Walküre bestrafung. II. u. III. weißt Du.“[39] ), folgt am 12. November schließlich ein langer Brief, in dem Wagner endgültig über die neue Konzeption berichtet.
Hier wird nun deutlich, dass sich trotz der Andeutungen einer nach 1852 noch stärker eintretendenden Verlagerung der Bewertung von den Voraussetzungen einer Aufführbarkeit Wagners Gedankenwelt noch immer die große Revolution sieht, die der Aufführung des Ring-Zyklus vorausgehen muss:
„An eine Aufführung kann ich erst nach der Revolution denken: erst die Revolution kann mir die künstler und die Zuhörer zuführen. Die nächste Revolution muß nothwendig unsrer ganzen theaterwirthschaft das Ende bringen: sie müssen und werden alle zusammenbrechen, dies ist unausbleiblich. Aus den trümmern rufe ich mir dann zusammen, was ich brauche: ich werde, was ich bedarf, dann finden. Am Rheine schlge ich dann ein theater auf, und lade zu einem großen dramatischen feste ein: nach einem jahre vorbereitung führe ich dann im laufe von vier tagen mein ganzes werk auf: mit ihm gebe ich den menschen der Revolution dann die bedeutung dieser Revolution, nach ihrem edelsten sinne, zu erkennen. Dieses publikum wird mich verstehen: das jetzige kann es nicht. - So ausschweifend dieser plan ist, so ist er doch der einzige, an den ich noch mein leben, tichten und trachten setze. Erlebe ich seine Ausführung, so habe ich herrlich gelebt; wenn nicht, so starb ich für ‚was schönes. Nur dieß aber kann mich noch erfreuen.“[40]
Da es nicht nur eine wesentliche Erweiterung des Umfangs dieser Arbeit, sondern auch die unbedingte Einbeziehung der theoretischen Schriften erfordern würde, näheren Einblick in die weiteren, inhaltlichen Entwicklungen des Werkes zu geben, soll der Betrachtungszeitraum hiermit abgeschlossen sein.
12. / 20. Nov. 1851 - „...nicht etwa bloß Reflexion, sondern namentlich Begeisterung...“
Verschiedene Aspekte, die sich zu wenig aus den Briefen ergeben, als dass sie genügend hätten [41] einbezogen werden können, wurden vernachlässigt, so bestimmte elementare Bezüge zwischen den zitierten Briefen und ihrer spezifischen Situation. Dazu gehört auch die Spezifizierung nach Empfängern, die jetzt, für die letzten behandelten Briefe doch noch versucht werden soll, um gleichzeitig die in ihnen enthaltene Selbstreflexion Wagners über den Verlauf der konzeptionellen Entwicklung und ihrer Motivationen zu untersuchen.
Es sind in erster Linie Theodor Uhlig und Franz Liszt, die für Wagner Briefpartner in Bezug auf seine Werke waren. Die Anderen, abgesehen von Breitkopf & Härtel und Eduard Avenarius, an denen Wagner vor allem als Verleger seiner Werke, also als Verhandlungsgegner Interesse hatte, lassen sich in ähnliche Bekanntschaftsstrukturen einordnen: Ernst Benedikt Kietz, ein Maler, den Wagner aus Dresden kannte und den er in Paris wiedertraf, wie auch August Röckel als ‚Jugendfreunde’ und Mitrevolutionäre, Wilhelm Fischer, Chordirektor in Dresden, Ferdinand Zigesar, Direktor des Hoftheaters Weimar, und Hans von Bülow als Verbindungen zum Kultursektor in Deutschland.
Ohne die - bei Liszt ohne Zweifel wesentlich kompliziertere - Beziehung Wagners zu den beiden Ersteren ausarbeiten zu können, so entsprechen diese beiden Elemente doch im Großen und Ganzen Wagners Bewertung ihrer Position.
In Wagners Empfindung gegenüber Liszt reinen Utilitarismus zu sehen wäre sicherlich genauso falsch wie hier eine reine Freundschaft zu beobachten. Wagners zögerliche Kontaktaufnahme zu Liszt bzw. ihre völlige Aufgabe zur Zeit seiner Zyklus-Ausarbeitung zeigt, dass Wagner ihn als brauchbare Verbindung zu einem Musiktheater in Deutschland brauchte - anfangs auch als Beschaffer von Geld -, ebenso wie er Liszts Gefühle nach dessen unermüdlichen Bemühungen nicht verletzen wollte - sonst gäbe es die lange, ausschweifende Erklärung vom 20. November 1851 nicht. Nicht zu bezweifeln ist die tiefe Dankbarkeit, die Wagner Liszt gegenüber empfand, und doch blieb die schon erwähnte Distanz erhalten, die Wagner dazu veranlasste, in seinen Umgang große Vorsichtigkeit und teils Unehrlichkeit zu legen, was ‚schlechte Nachrichten’ und Kritik anging.
Um die Unterschiede in Wagners Äußerungen gegenüber Beiden darzustellen, reicht es, die beiden ‚großen Erklärungsbriefe’ vom 12. und 20. November 1851 anzuschauen, zumal für den letztendlichen Entscheidungszeitraum in Albisbrunn nur Briefe an Uhlig vorliegen. Zwischen beiden liegt die Ausarbeitung der Prosaskizze zur „Walküre“.
An Liszt hatte sich Wagner vor dem 20. November am 23. August das letzte Mal gewandt.[42] Wagner entschuldigt sich für sein langes Schweigen zum Einen mit der Wichtigkeit der Dinge, über die er klar zu werden hatte, zum Anderen mit seiner schlechten Gesundheit. Seine tiefe Freude über Liszts Tätigkeiten, so schreibt er, seine Begeisterung über die „Opfer der schönsten Liebe“, die sie beide „zu vollkommener Uebereinstimmung“ brachten und ihm das Ausmaß seiner Wirkung auf Liszts „überreiche künstlerische Empfänglichkeit“ verdeutlichten, habe eine zu große Erregung in ihm erzeugt, als dass er mitten in der Kur hätte schreiben können.
So habe er, fährt Wagner fort, der Öffentlichkeit in der „Mittheilung an meine Freunde“ von Liszts Verdiensten berichtet, seiner Bedeutung für Wagner, überhaupt weiter künstlerisch tätig zu werden. Hierunter zähle er auch den restlichen Kreis, der ihn in Weimar unterstütze. Die Absicht in Bezug auf eine Oper, die er für Weimar zu schreiben beabsichtigte und die er in der „Mittheilung“ erwähnte, würde er als „Zeichen meiner Dankbarkeit für ihre Gesinnung“ belassen, auch wenn sich die diesbezüglichen Pläne geändert hätten. (Wagner hat aber den Schluss letztendlich doch abgeändert, um seine neuen Vorstellungen zu schildern.)
Er beginnt nun die Schilderung der konzeptionellen Entwicklungen des Nibelungen-Zyklus mit den Sätzen:
„Dir, mein lieber Liszt, muß ich jetzt jedoch schon nothgedrungen eröffnen, daß mein Entschluß, eine neue Oper für Weimar zu schreiben, so wesentliche Bestimmungen empfangen hat, daß ich ihn kaum mehr als solchen gelten lassen kann. Erfahre hiermit, der strengsten Wahrheit gemäß, die Geschichte des künstlerischen Vorhabens, in welchem ich jetzt seit längere Zeit begriffen bin, und die Wendung, die dieses nothwendig nehmen mußte.“
In Wagners darauffolgender Darstellung scheint die letztendliche große Anlage schon von vornherein dem Stoff immanent zu sein. Die Formulierungen „vollständiger Mythos“ und „künstlerisches Eigenthum“ kennzeichnen einen Gesamtheitsanspruch der stofflichen Behandlung und Aussagekraft des darauf aufgebauten Werkes, so dass seine Ausarbeitung scheinbar zwangsläufig auf eine ausufernde Form hinauslief, in ihrem Neuheitsanspruch, in vielerlei Hinsicht, sozusagen auch neuartigen Umfang per se forderte.
Die Erkenntnis einer Unmöglichkeit der Beschränkung führte in eine „verzweifelte Stimmung“, die mit „Oper und Drama“ überwunden werden sollte. Doch auch nach der Erweiterung auf den vorbereitenden „jungen Siegfried“, die von Liszts Bemühen um „Lohengrin“ angeregt worden sei, blieb Unsicherheit über das Versenden des dichterischen Ergebnisses an Liszt. Diese Unsicherheit blieb jedoch auch noch in Albisbrunn:
„Sonderbar! immer hielt mich etwas davon ab; immer mußte ich zögern, weil es mir war, als würde das Bekanntwerden mit dieser Dichtung Dich zunächst in eine gewisse Verlegenheit setzen, als müßtest Du nicht recht wissen, was Du daraus machen solltest, ob Hoffnung oder Mistrauen in sie zu setzen sei.“
Denn Wagner will bzw. „muß“ seinen „ganzen Mythos, nach seiner tiefsten und weitesten Bedeutung, in höchster künstlerischer Deutlichkeit mittheilen, um vollständig verstanden zu werden“ als „die von mir erkannte Wahrheit“. Hinzu komme aber auch der „für die Darstellung ungemein ergiebige Stoffe jener Momente selbst“. Daher werde Liszt begreifen, „daß nicht etwa bloß Reflexion, sondern namentlich Begeisterung meinen neuesten Plan mir eingab!“ Dieser Plan nun, mache eine weitere Verpflichtung gegenüber dem unabhängig davon nicht zukunftsreichen Weimar völlig unmöglich.
Der Gedankengang schließt mit einer klaren Verortung seines Werkes:
„Möge Dir nun mein Plan noch so kühn, ungewöhnlich, ja vielleicht phantastisch vorkommen, so sei dennoch überzeugt, daß er nicht aus einer äußerlich kalkulirenden Grille entstanden ist, sondern daß er sich mir als die nothwendige Konsequenz des Wesens und des Inhaltes des Stoffes aufgedrungen hat, der mich nun einmal erfüllt und zu seiner vollständigen Ausführung treibt. Ihn so auszuführen, wie es eben mir als Dichter und Musiker sich erlaubt, ist für jetzt das Einzige, was ich vor mir sehe: alles Weitere darf mich zunächst noch gar nicht kümmern.“
Wagner verwendet in dem gesamten Brief nicht einmal das Wort „Revolution“ und seine diesbezüglichen Gedanken erschöpfen sich in den schwachen Andeutungen „für jetzt das Einzige“, „alles Weitere“ und in seiner Selbstbestimmung „als Dichter und Musiker“, der von den politischen Umständen abhängig, aber nicht dafür mitbestimmend ist.
Im Grunde genommen ist die Positionierung gegenüber Uhlig keine andere, jedoch mit einer völligen Verlagerung der Schwerpunkte (siehe zitierten Abschnitt im vorherigen Kapitel)[43]:
Dieser Schwerpunktverlagerung steht eine erhebliche Parallelität der Gedanken entgegen. Wagner erwähnt den „großartigen zusammenhang[...]“ des Mythos, deren beschränkte Ausführung nur ein Zugeständnis an die rezente Theaterlandschaft wäre. Diese „marter des Halben “ hätte sich aber als unerträglich ergeben, so dass nach der Erweiterung für die Sinne mit dem „jungen Siegfried“ schließlich die große Ausführung notwendig gewesen wäre:
„Mit dieser meiner neuen konzeption trete ich gänzlich aus allem bezug zu unsrem heutigen theater und publikum heraus: ich breche bestimmt und für immer mit der formellen gegenwart.“
Dies, so fügt Wagner noch hinzu, werde drei Jahre in Anspruch nehmen, sofern die finanzielle Unterstützung - durch Julie Ritter - abgesichert sei.
Für die abschließende Betrachtung müssen noch zwei Briefstellen der beiden behandelten zitiert werden, die in ihrer Ähnlichkeit sehr aufschlussreich sind (Hervorhebungen vom Verfasser):
„Jetzt sehe ich, ich muß, um vollkommen von der bühne herab verstanden zu werden, den ganzen Mythos plastisch ausführen. Nicht diese rücksicht allein bewog mich aber zu meinem neuen plane, sondern namentlich auch das hinreißend ergreifende des stoffes, den ich somit für die darstellung gewinne, und der mir einen reichthum für künstlerische bildung zuführt, den es sünde wäre, ungenützt zu lassen. Denke Dir den inhalt der Erzählung der Brünnhilde - in der letzten scene des „jungen Siegfried“ - (das schicksal Siegmund’s und Siegelinds, der kampf Wodans mit seiner neigung und der Sitte (Fricka); der herrliche trotz der Walküre, der tragische zorn Wodan’s mit dem er diesen trotz straft: denke Dir dieß in meinem sinne, mit dem ungeueren reichthum von momenten, in ein bündiges drama zusammengefaßt, so ist eine tragödie von der erschütterndsten wirkung geschaffen, die zugleich alles das zu einem bestimmten sinnlichen eindrucke vorführt, was mein publikum in sich aufgenommen haben muß, um den „jungen Siegfr.“ und den „tod“ - nach ihrer weitesten bedeutung - leicht zu verstehen.“[44]
„Daß mich aber nicht nur die künstlerische Reflexion, sondern namentlich auch der herrliche, und für die Darstellung ungemein ergiebige Stoff jener Momente selbst hierin bestimmt hat, das kannst Du Dir leicht vergegenwärtigen, wenn Du jenen Stoff näher in Augenschein nimmst. Denke Dir die wunderbar unheilvolle Liebe Siegmund’s und Siegelind’s; Wodan in seinem tief geheimnisvollen erhältnisse zu dieser Liebe; dann in seiner Entzweiung mit Fricka, in seiner wüthenden Selbstbezwingung, als er - der Sitte zu lieb - Siegmunds Tod verhängt; endlich die herrliche Walküre, Brünnhilde, wie sie - Wodan’s innersten Gedanken errathend - dem Gotte trotzt, und von ihm bestraft wird: denke Dir diesen Reichthum von Anregung, wie ich ihn in der Scene zwischen dem Wanderer und der Wala, dann aber - breiter - in der erwähnten Erzählung Brünnhilde’s andeute, als Stoff eines Drama’s, welches den beiden Siegfrieden vorangeht, und Du wirst begriefen, daß nicht etwa bloß Reflexion, sondern namentlich Begeisterung meinen neuesten Plan mir eingab!“[45]
Abschließende Betrachtungen
Die beiden Positionierungen, die sich im Wesentlichen ergeben haben, sind nicht weiter überraschend, in Bezug auf die letzteren beiden Briefe sind sie angesichts der Beziehung zum jeweiligen Briefpartner entsprechen sie sogar ziemlich dem, was zu erwarten gewesen war. In der revolutionären Gesinnung ist nicht schwer das zu entdecken, was Wagner bei Liszt als das „gute Stück“ betrachtet, das „ihm fremd und unbegreiflich“ bleibt, und somit kann die Aussparung dieses Aspekts nicht überraschen. Ebensowenig sind Reminiszenzen an die Gespräche über die Revolution gegenüber Kietz und Uhlig nicht ungewöhnlich.
Es ist aber die Fülle an darin eingehenden Aspekten, die die Besonderheit des Ringes ausmacht. Wie bei keinem anderen Werk Wagners sind derart gleichberechtigt sozialrevolutionäre, kunsttheoretische, stoffimmanente, musikpädagogische, rezeptionsorientierte, aufführungspraktische, religiöse, nationalistische, historische und musikalische Aspekte sowohl in Ausführung als auch Betrachtung eingebracht worden.
Erforderlich ist jedoch die Trennung nach verschiedenen Bewertungsebenen. Die Aspekte gliedern sich in drei Betrachtungsgebiete, die nichts weniger als die Gesamtheit ein Werk generell betreffender Aspekte darstellen.
Erstens die soziale Umgebung, die Fragen nach dem Publikum, welche Voraussetzung es mitbringen muss, welche soziale Situation wiederum dafür notwendig ist, was eine erfolgreiche Rezeption erfordert, wer die in den anderen beiden Bereichen skizzierten Rahmenbedingungen organisatorisch, emotionell und finanziell schafft.
Zweitens die Aufführungspraxis, die Frage nach den ausführenden Künstlern, welche Voraussetzung sie mitbringen müssen, welche Vorbildung wiederum dafür notwendig ist, was ein Verstehen der künstlerischen Substanz des Werkes erfordert, welche aufführungspraktischen Bedingungen dem Werk angemessen sind.
Drittens die Ausführung des Werks, die Fragen nach den dichterischen und musikalischen Einzelheiten, den Erfordernissen und immanenten Aspekten des Stoffs, den Bedingungen des künstlerischen Daseins bzw. der Absicherung der dafür erforderlichen Lebensumstände und Materialien sowie nach dem theoretischen Unterbau.
Zu vermuten ist, dass jeder Künstler mit diesen Fragen konfrontiert wird und auch teilweise ihre Beantwortung anstrebt. Inwieweit das beim einzelnen Künstler der Fall ist, und was das qualitativ aussagt, ist an dieser Stelle zweitrangig. Entscheidend ist, dass jeder dieser Aspekte in Wagners Briefen, selbst in der frühen Schaffenszeit am Nibelungen-Ring, wo in erster Linie konzeptionelle Fragen auftauchten, vertreten sind bzw. in Verbindung mit seinen theoretischen Schriften behandelt werden.
Die Parallelität der beiden letztbehandelten Briefe (12. / 20. November 1851), deren Unterschiedlichkeit so eng mit den spezifischen Adressaten verbunden ist, lässt die Annahme zu, dass auch in Wagners Kopf eine solche Trennung stattgefunden hat, so dass er zwar unterscheidet, zu wem er von welchem gedanklichen Komplex schreibt, die Kohärenz innerhalb eines Komplexes jedoch erheblich ist.
Eine Untersuchung der das Werk begleitenden Motivationen kann also, insofern es Wagners Äußerungen angeht, im besten Fall an keinem dieser Aspekte vorbei. Die Außerordentlichkeit des Nibelungen-Rings liegt also weniger - ohne zu behaupten, dass überhaupt nicht - in seinem inneren Gehalt, als seiner komplexen Einbettung in verschiedenste gesellschaftliche, kunsttheoretische und künstlerische Aspekte, die Wagner selbst vorgenommen hat.
Hierin kann durchaus einer der Hauptgründe gesehen werden, warum in der Auseinandersetzung mit diesem Opernzyklus in weit höherem Maße als bei anderen Opern Wagners und auch einem Großteil weiterer Werke generell alles andere als die künstlerische Substanz eine Rolle gespielt hat und weiterhin spielt.
[...]
[1] Kloss, Erich (Hrsg.): Richard Wagner an seine Künstler. Zweiter Band der „Bayreuther Briefe“ 1872-1883, (Richard Wagners Briefe in Originalausgaben, Zweite Folge, XIV.), Leipzig: Breitkopf & Härtel, ³1912 (1910), 84.
[2] BA III, 82 (an Liszt, 18. Juni 1849)
[3] BA III, 82 (an Liszt, 18. Juni 1849)
[4] BA III, 82 (an Liszt, 18. Juni 1849)
[5] BA III, 109 (an Uhlig, 9. August 1849)
[6] BA III, 117 (an Minna, 11. August 1849)
[7] BA III, 124 (an Uhlig, 16. September 1849)
[8] BA III, 123 (an Uhlig, 16. September 1849)
[9] BA III, 124 (an Uhlig, 16. September 1849)
[10] BA III, 137 (an Liszt, 14. Oktober 1849)
[11] BA III, 141 (an Uhlig, 25. Oktober 1849)
[12] BA III, 353 (an Liszt, etwa 20. Juli 1850)
[13] BA III, 359f (an Julie Ritter, 20. oder 21. Juli 1850)
[14] Im Mai 1850 im Zuge einer versuchten Drucklegung von „Siegfrieds Tod“, diese scheiterte, das Vorwort wurde erst 1910 in „Die Musik“ abgedruckt.
[15] BA III, 356 (an Liszt, etwa 20. Juli 1850)
[16] BA III, 362 (an Uhlig, 27. Juli 1850)
[17] BA III, 364f (an Uhlig, 27. Juli 1850)
[18] BA III, 404f (an Kietz, Poststempel 14. September 1850)
[19] BA III, 467 (an Liszt, 25. November 1850)
[20] BA IV, 44 (an Uhlig, 10. Mai 1851)
[21] BA IV, 44 (an Uhlig, 10. Mai 1851)
[22] BA IV, 90 (an Breitkopf & Härtel, 23. August 1851)
[23] BA IV, 45f (an Zigesar, 10. Mai 1851)
[24] BA IV, 46 (an Zigesar, 10. Mai 1851)
[25] Wagner schreibt im April 1851 dazu „Ein Theater in Zürich“.
[26] Auf die schwierige Erörterung der begrifflichen Unterscheidungen Wagners zwischen Oper, Musikdrama, Gesamtkunstwerk usw. muss hier verzichtet werden, daher wird lediglich „Oper“ verwendet.
[27] BA IV, 131 (an Uhlig, etwa 7.-11. Oktober)
[28] BA IV, 106 (an Fischer, etwa 8. September 1851)
[29] BA IV, 122 (an Uhlig, 30. September 1851)
[30] BA IV, 128 (an Uhlig, etwa 7.-11. Oktober 1851)
[31] BA IV, 129 (an Uhlig, etwa 7.-11. Oktober 1851)
[32] BA IV, 131f (an Uhlig, etwa 7.-11. Oktober)
[33] BA IV, 141 (an Uhlig, 21. Oktober 1851)
[34] BA IV, 147 (an Kietz, 24. Oktober 1851)
[35] BA IV, 154 (an von Bülow, 30. Oktober 1851)
[36] BA IV, 155 (an Herwegh, 30. Oktober 1851)
[37] BA IV, 156 (an Avenarius, 31. Oktober 1851)
[38] BA IV, 162f (an Uhlig, 3. November 1851)
[39] BA IV, 172 (an Uhlig, 11. November 1851)
[40] BA IV, 176 (an Uhlig, 12. November 1851)
[41] BA IV, 187 (an Liszt, 20. November 1851)
[42] im Folgenden: BA IV, 183-193 (an Liszt, 20. November 1851)
[43] Im Folgenden BA IV, 173-176 (an Uhlig, 12. November 1851)
[44] BA IV, 175 (an Uhlig, 12. November 1851)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument über Richard Wagners "Ring des Nibelungen"?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert die Entwicklung von Thema und Methodik von Richard Wagners Werk "Der Ring des Nibelungen" anhand seiner Briefe und Schriften aus den Jahren 1849 bis 1851. Der Fokus liegt auf der Veränderung seiner Perspektive bezüglich der Aufführbarkeit und der Bedeutung des Werkes im Kontext seiner politischen und künstlerischen Vorstellungen.
Welche Quellen werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse stützt sich hauptsächlich auf Primärquellen, insbesondere Richard Wagners Briefe aus den Jahren 1849 bis 1852, die in den Bänden III und IV von "Richard Wagner. Sämtliche Briefe" (herausgegeben von Gertrud Strobel und Werner Wolf) veröffentlicht wurden. Theoretische Schriften und andere Sekundärquellen werden nur ergänzend herangezogen.
Welche zentralen Themen werden im Dokument behandelt?
Zentrale Themen sind die Entwicklung von Wagners Thema und Methodik in Bezug auf den "Ring des Nibelungen", seine biographische Übersicht, sowie detaillierte Betrachtungen seiner Briefe aus den Zeiträumen Juni 1849 bis Oktober 1849, Juli 1850 bis November 1850, Mai 1851 und September bis November 1851. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, wie Wagner die Einordnung des "Ringes" als außergewöhnliches Werk in verschiedener Intensität und in Gegenüberstellung zu den dazugehörigen Rahmenbedingungen wahrnahm.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse?
Die Analyse zeigt, dass Wagners anfängliche Beziehung zum "Ring des Nibelungen" eng mit seinem weltumstürzlerischen Geist und dem Fortschreiten der Arbeit an "Siegfrieds Tod" verbunden war. Im Laufe der Zeit veränderte sich seine Perspektive, und das Werk wurde zunehmend als "wichtiger Mythos" betrachtet, dessen Vermittlung im Vordergrund stand. Wagners politische Ambitionen traten in den Hintergrund, und er bemühte sich um einen diplomatischeren Umgang mit seiner Umgebung, um die Aufführung seines Werkes zu ermöglichen. Die Analyse betont die Bedeutung der komplexen Einbettung des "Ringes" in verschiedenste gesellschaftliche, kunsttheoretische und künstlerische Aspekte.
Welche Bedeutung hat die Bekanntschaft von Franz Liszt für Wagner?
Franz Liszt spielte eine wesentliche Rolle bei der Wiederaufnahme der Arbeit an „Siegfrieds Tod“. Liszts Freundschaft und Unterstützung, sowie die Aussicht auf eine mögliche Aufführung in Weimar, beflügelten Wagners Kreativität und lenkten seinen Fokus auf dieses Werk. Wagner empfand tiefe Dankbarkeit gegenüber Liszt, obwohl er ihm gegenüber auch eine gewisse Distanz wahrnahm.
Wie entwickelte sich Wagners Idee eines Festspielhauses?
Die Idee eines separaten Theaters, in dem "Siegfrieds Tod" aufgeführt werden könnte, tauchte erstmals in einem Brief an Ernst Benedikt Kietz im September 1850 auf. Diese Vorstellung enthielt bereits alle wesentlichen Elemente des späteren Wagnerischen Ideals eines Bühnenfestspiels, einschließlich eines eigenen Theaters und einer dazugehörigen Sängerschule. Allerdings offenbarte dieser Plan auch alle Elemente, die zu seiner Nichterfüllung führen würden.
Wie beeinflussten Wagners politische Überzeugungen sein Schaffen?
Wagners politische Überzeugungen hatten einen erheblichen Einfluss auf sein Schaffen. In seinen revolutionärsten Zeiten sah er die Revolution in der Kunst als Folge, nicht als Voraussetzung der allgemeinen Menschheitsrevolution. Dementsprechend verband er die Chancen für ein Werk wie den "Ring des Nibelungen" mit dem Eintreten der erwarteten gesellschaftlichen Umwälzungen. Mit seinem späteren gemäßigteren Herangehen an die Welt relativierte er seine Beteiligung an der Revolution und seinen Antisemitismus zugunsten eines stärkeren Nationalismus.
Welche Rolle spielte die "Mittheilung an meine Freunde" für Wagner?
Die "Mittheilung an meine Freunde" war für Wagner von großer Bedeutung, da er sie als Freifahrtschein zum Verständnis seines neuen Werkes betrachtete. Er kümmerte sich intensiv um die Drucklegung dieses Vorworts und erweiterte es nach den konzeptionellen Veränderungen seiner Pläne in großem Umfang. Um die Veröffentlichung nicht zu gefährden, nahm er eine Entpolitisierung der Schrift vor, da er mit diesem Buch keine politische Demonstration im Sinne hatte.
Welche Bedeutung hat die Wasserheilanstalt Albisbrunn für die Entstehung des Ring-Zyklus?
Wagner verbrachte im September und November 1851 einige Zeit in der Wasserheilanstalt Albisbrunn. Dort reifte seine Idee für den letztendlichen Ring-Zyklus. In dieser Zeit äußerte er erstmals die Vorstellung von drei Dramen mit einem dreiaktigen Vorspiel.
- Arbeit zitieren
- Enrico Ille (Autor:in), 2004, Von der Oper zum Ring-Zyklus. Motivationen aus Briefen Richard Wagners (Juni 1849 - November 1851), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111504