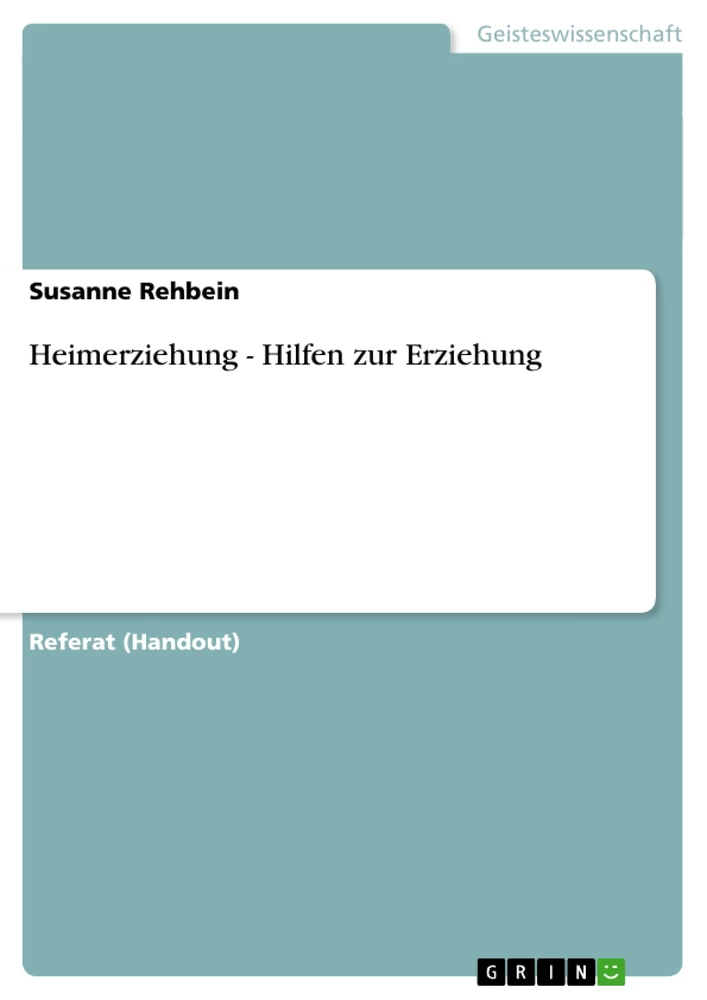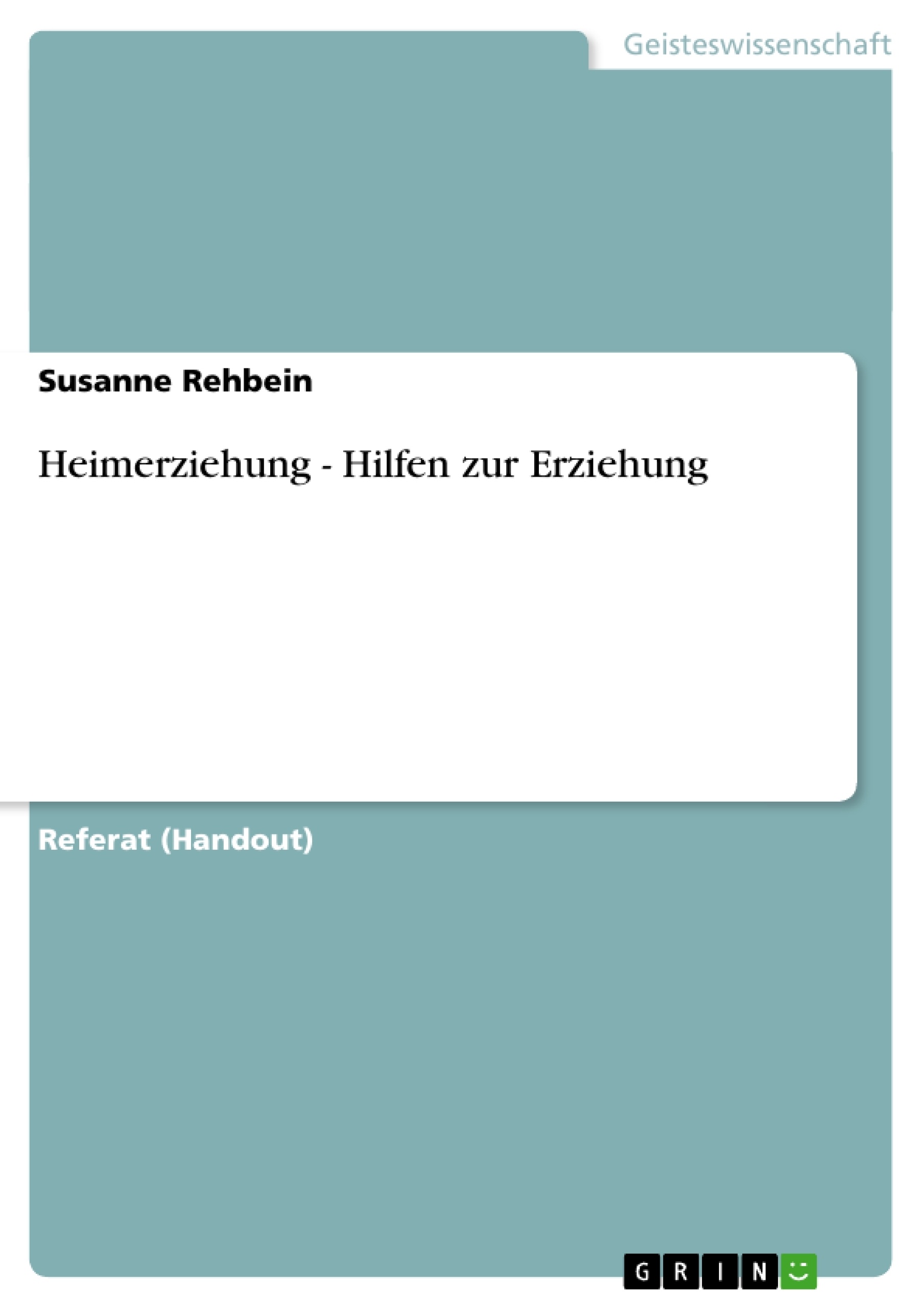Vergessene Kinder, verlorene Jugend? Tauchen Sie ein in die bewegende und oft beschämende Geschichte der Heimerziehung in Deutschland, von den düsteren Anfängen in mittelalterlichen Findelhäusern bis zu den Reformen der Nachkriegszeit. Dieses Buch enthüllt die verborgenen Realitäten hinter den Mauern von Kinderheimen, Jugendwohnungen und betreuten Wohngruppen, und beleuchtet die Schicksale derer, die durch das soziale Netz fielen. Erfahren Sie, wie sich die Heimerziehung im Laufe der Zeit wandelte, geprägt von ideologischen Zwängen des Dritten Reichs, den humanitären Bestrebungen der Kinderdörfer und den Protesten der Heimkampagne. Eine kritische Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grundlagen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) und den verschiedenen Angebotsformen der stationären Erziehungshilfe ermöglicht ein tiefes Verständnis für die komplexen Herausforderungen, mit denen Fachkräfte und Betroffene konfrontiert sind. Wer sind die Kinder und Jugendlichen, die in Heimerziehung leben? Welche Gründe führen zu einer Heimeinweisung, und welche Perspektiven bieten diese Einrichtungen für eine positive Entwicklung? Von Verhaltensauffälligkeiten über Schulprobleme bis hin zu familiären Belastungen – dieses Buch analysiert die vielfältigen Ursachen und beleuchtet die oft schwierigen Lebenswege junger Menschen. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Pädagogen, Sozialarbeiter, Politiker und alle, die sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft engagieren. Eine schonungslose Analyse, die zum Nachdenken anregt und den Blick für die Bedürfnisse der Schwächsten schärft. Entdecken Sie die Reformen, die darauf abzielen, die Lebensqualität und Zukunftschancen junger Menschen in stationären Einrichtungen zu verbessern, und verstehen Sie die Bedeutung von Partizipation, individueller Förderung und einem liebevollen Umfeld. Ein Appell für eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Heimerziehung, die den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen wirklich gerecht wird und ihnen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Die soziale Arbeit steht vor der dringenden Aufgabe, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen Halt und Orientierung zu geben.
Definition:
„Heimerziehung bedeutet eine erwünschtermaßen – und gesetzlich festgelegte – zeitlich begrenzte stationäre, meist heilpädagogisch-psychologisch ausgerichtete Erziehung außerhalb des ursprünglichen und natürlichen familiären Lebensfeldes durch pädagogische Fachkräfte, wobei die betroffenen Kinder und Jugendlichen in der Regel in alters- und geschlechtsgemischten Gruppen in einer Art Lebensgemeinschaft zusammengeschlossen sind.“ (Schauder, S. 7)
1. historische Entwicklung
- Wurzeln: Mittelalter (Findel- und Waisenhäuser, Klosterschulen, Hospitäler und Armenhäuser) ➔ geringer pädagogischer Anspruch, sondern vorrangig Sicherung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Wohnraum, medizinische Versorgung etc.), Erziehung zur „Arbeitsamkeit, Gottesfurcht und Demut“ (Günder 2003, S. 12)
- Drittes Reich: ideologisch ausgerichtete Erziehungsziele; Unterteilung der Kinder in 3 Kategorien: „gute Elemente“ = erbgesund, normalbegabt, rassisch wertvoll, erziehungsfähig und -würdig und eingliederungsfähig ➔ Unterbringung in Jugendheimstätten; „halbgute Elemente“ ➔ Fürsorgeerziehung; „bösen Elemente“ = schwersterziehbare ➔ ab 1940 in polizeilichen Jugendschutzlagern untergebracht, bei Volljährigkeit Überführung in Arbeitshäuser oder Konzentrationslager
- Nachkriegsentwicklung in BRD:
- zunächst „Beherbergung und Versorgung entwurzelter, […] elternloser Kinder und Jugendlicher“ (Bürger, S. 633), teilweise durch unqualifiziertes Personal wie ehemalige Soldaten (vgl. Günder 2003, S. 19)
- angewandte Disziplinierungsmaßnahmen: Strafisolation in Einzelzellen, Haarescheren, militärischer Drill und Arbeitszwang
- aber auch humanitäre, sozialpädagogisch orientierte Konzepte, z.B. Kinderdörfer (Gründung in 40er Jahren) ➔ Zielsetzung: dauerhafte Beheimatung elternloser unversorgter Kinder in familiärem Rahmen mit „unqualifizierten“ Kinderdorfmüttern
- Ende der 60er Jahre: Heimkampagne ➔ Studentenbewegung machte auf unhaltbare Zustände aufmerksam; vor allem in Hessischen Heimen Aktionen, z.B. Massenentweichungen, die auf autoritären Erziehungsstil, Missachtung grundgesetzlich verankerter Rechte, unzureichende Bildungs- und Ausbildungschancen, unzureichende Entlohnung, unzureichend ausgebildetes Personal und Isolation abgelegener Heime aufmerksam machten
- Forderung nach Demokratie und Mitgestaltungsrechten der „Insassen“
- Verringerung der Gruppengröße
- tarifgerechte Entlohnung sowie Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten für Erzieher(innen)
- Abschaffung von Stigmatisierungsmerkmalen, etwa Anstaltskleidung, Heime in abgelegener Lage etc.
- Abschaffung zum Teil langer Heimaufenthalte bei gleichzeitigem Fehlen einer Erziehungsplanung
- Abkehr von willkürlichen Einweisungskriterien wie „Verwahrlosung“
- Abkehr von geschlossener Unterbringung in Heimen
- Mitte der 70er Jahre: Entstehung von Kleinstheimen und Kinderhäusern
- gravierende Veränderungen der Gruppengrößen ➔ 60er Jahre: 25+ Plätze ➔ variable Gruppengrößen 5-10 Plätze
- Verbesserung der räumlichen Rahmenbedingungen ➔ individualisierte Raumprogramme, häufig mit Einzelzimmern
- Verbesserung der personellen Ausstattung ➔ höhere Betreuungsdichte, verbesserte pädagogische Qualifikation der Mitarbeiter
- veränderte Beurteilung der Problemlagen betreuter junger Menschen
- Heimerziehung in der DDR und Entwicklungen nach dem Beitritt zur BRD:
- 1947: Jugendhilfe auf sowjetischen Befehl aus Sozialwesen ausgegliedert und Volkswesen zugeordnet
- 50er Jahre: Sozialisation innerhalb der Kleinfamilie = oberste Priorität ➔ Kleinfamilie = „Grundkollektiv der sozialistischen Gesellschaft“ (Bürger, S. 640)
- „Handlungsbedarf zur Einweisung von Kindern und Jugendlichen in Heime […] wenn Eltern sozialistische Erziehung ihrer Kinder aus objektiven oder subjektiven Gründen nicht gewährleisten konnten“ (Bürger, S. 640) ➔ Heimeinweisung nach gescheiterter Republikflucht
- häufige Einweisungsgründe: Schulbummelei / Arbeitsbummelei und Jugendkriminalität
- räumliche Bedingungen: Nutzung von nicht mehr benötigten Gebäuden ➔ geringe Eignung durch Standort, Größe und Raumkonzept
- ab 70er Jahre: Neubauten für Heime ➔ bis zu 250 Plätze!
- hohe Mitarbeiterfluktuation + ungünstige personelle Bedingungen ➔ 2,8 Stellen auf 16-20 Kinder
- weitere Strukturprobleme: starre Regelkonzepte, mangelnde Beachtung individueller Problemlagen der Kinder/Jugendlichen, „militaristische“ Spezialheime, permanenter Personalmangel
2. rechtliche Grundlagen & Finanzierung
- § 34 KJHG: Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform ➔ Formulierung verweist auf alternative Institutionen
- ergänzend:
- § 5 KJHG ➔ Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten (Eltern) hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe (Einrichtung, Träger etc.)
- § 8 KJHG ➔ Partizipationsrecht der Kinder/Jugendlichen entsprechend dem Entwicklungsstand
- § 36 KJHG ➔ Personensorgeberechtigte und Kind/Jugendlicher müssen vor Inanspruchnahme beraten werden bezüglich Folgen für die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen
- § 37 KJHG: Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie
- § 38 KJHG: Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge
- § 39 KJHG: Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen
- § 40 KJHG: Krankenhilfe
- § 80 KJHG: Jugendhilfeplanung ➔ Kontakte zu Familie und sozialem Umfeld müssen möglich sein ➔ Einrichtung in erreichbarer Nähe
- §§ 91ff KJHG: Heranziehung zu den Kosten
- § 1666 BGB ➔ Hilfe zur Erziehung gegen der Wunsch/Willen der Eltern = keine Jugendhilfeleistung sondern „hoheitlicher Eingriff in die Elternrechte zum Schutz des Kindes“ (Bürger, S. 645)
- Kind/Jugendlicher und Eltern werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen ➔ §§ 92, 93 KJHG
- Höhe: häusliche Ersparnis ➔ § 94 Abs. 2 KJHG ➔ Durchschnitt ca. 300 DM, max. 600-800 DM (vgl. Bürger, S. 655)
- Heranziehung nur im Rahmen der Bundessozialhilfebestimmungen
- „Restkosten“ tragen örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt)
3. Angebotsformen
Kinderheime
- meist kleine überschaubare Gruppen ➔ Folge der Heimkampagne
- Gruppen = ähnlich wie Familien (kochen, essen, spielen, lernen etc.)
- Ein- bis Zweibettzimmer
- Betreuung im Schichtdienst
Außenwohngruppen und Wohngruppen
- Entstehung zu Beginn der 70er Jahre
- kleinere Heimgruppen (5-8 Kinder/Jugendliche) wohnen in Einfamilienhäusern oder in einer Etagenwohnung
- Zielgruppe meist Jugendliche ➔ erfordert und fördert Selbständigkeit
- Betreuung im Schichtdienst
- Bedarf größer als Angebot
Betreutes Wohnen
- vorrangig für Jugendliche/junge Volljährige ➔ meist Jugendliche/junge Volljährige die in Heim oder Wohngruppe Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit unter Beweis stellen konnten ➔ wohnen allein oder mit anderen Jugendlichen/jungen Volljährigen (ohne ständige Anwesenheit von Personal)
3. Zielgruppe
- „Familien, in denen sich Kinder auf Grund der familiären oder anderer Lebensbedingungen momentan oder auf längere Sicht nicht ausreichend entwickeln können“ (Günder 2000, S. 45)
- mögliche Gründe für Heimaufenthalt: Verhaltensstörungen, Schulprobleme, psychische Störungen, Umhertreiben und Weglaufen, Neigung zu Straftaten, Auffälligkeiten im sexuellen Bereich etc.
- häufig Alkoholprobleme oder andere Suchterkrankungen in der Familie, Scheidungswaisen, Partnerschaftskonflikte, psychische Störungen der Eltern, unterprivilegierte Bevölkerungsschichten[1], gescheiterte Pflegeverhältnisse, Überforderungen der Eltern,
- Heimeinweisung selten bei Erstkontakt mit Jugendamt ➔ Jugendhilfekarriere
- vorrangig 16- bis 18jährige in Institutionen; kleine Kinder vorwiegend in Pflegefamilien untergebracht
Literatur:
- Bürger, U.: Heimerziehung. In: Birtsch, V., Münstermann, K., Trede, W. (Hrsg.) 2001: Handbuch Erziehungshilfen. Leitfaden für Ausbildung, Praxis und Forschung. Münster, S. 632-663
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1998: Leistungen und Grenzen von Heimerziehung. Bonn
- Chassé, K. A.: Heimerziehung. In: Chassé, K. A., Wensierski, H.-J. von (Hrsg.) 2002: Praxisfelder der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim, München, S. 161-171
- Günder, R. 2000: Erziehungshilfen. Wissenswertes für Eltern. Freiburg im Breisgau
- Günder, R. 2003: Praxis und Methoden der Heimerziehung. Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe. Freiburg im Breisgau
- Hansbauer, P. 1999: Traditionsbrüche in der Heimerziehung. Analysen zur Durchsetzung der ambulanten Einzelbetreuung. Münster
- Münder, J. u.a. 2003: Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe. Weinheim, Berlin, Basel
- Schauder, T. 2003: Heimkinderschicksale. Falldarstellungen und Anregungen für Eltern und Erzieher problematischer Kinder. Weinheim, Basel, Berlin
- Wiesner, R. u.a. 2000: SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe. München
- http://129.217.205.15/akj/komdat/pdf/komdat12.pdf [03.01.2006, 13:00]
- http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2005/p3590082.htm [03.01.06, 16:10]
- http://www.klinge-seckach.de/download/kosten_nutzen_analyse.pdf [03.01.2006, 13:08]
- http://www.planger.de/hist02.htm [02.01.06, 15:29]
- http://www.vpk.de/mitteilungen/studien/jule.html [02.01.06, 17:25]
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist Heimerziehung laut Definition?
Heimerziehung ist eine zeitlich begrenzte, stationäre Erziehung außerhalb des familiären Lebensfeldes durch pädagogische Fachkräfte, meist heilpädagogisch-psychologisch ausgerichtet. Kinder und Jugendliche leben in alters- und geschlechtsgemischten Gruppen in einer Art Lebensgemeinschaft.
Wie hat sich die Heimerziehung historisch entwickelt?
Die Wurzeln liegen im Mittelalter (Findel- und Waisenhäuser). Im Dritten Reich gab es ideologisch ausgerichtete Erziehungsziele und eine Unterteilung der Kinder in Kategorien. Nach dem Krieg standen zunächst die Versorgung und Beherbergung entwurzelter Kinder im Vordergrund, aber es gab auch humanitäre Konzepte wie Kinderdörfer. Die Heimkampagne Ende der 60er Jahre deckte unhaltbare Zustände auf und führte zu Veränderungen wie kleineren Gruppen und besserer Ausbildung des Personals. In der DDR wurde die Jugendhilfe aus dem Sozialwesen ausgegliedert und der Sozialisation in der Kleinfamilie oberste Priorität eingeräumt. Es gab jedoch Strukturprobleme wie starre Regelkonzepte und Personalmangel.
Welche rechtlichen Grundlagen und Finanzierungsgrundlagen gibt es für die Heimerziehung?
§ 34 KJHG regelt die Heimerziehung. Ergänzend gelten § 5 (Wunsch- und Wahlrecht), § 8 (Partizipationsrecht), § 36 (Beratung), §§ 37-40 (Zusammenarbeit, Personensorge, Unterhalt, Krankenhilfe) und § 80 (Jugendhilfeplanung) KJHG sowie §§ 91ff KJHG (Kosten). § 1666 BGB regelt den Eingriff in die Elternrechte. Kind/Jugendliche und Eltern werden zu den Kosten herangezogen, wobei die Höhe der häuslichen Ersparnis entspricht. Die Restkosten tragen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Welche Angebotsformen der Heimerziehung gibt es?
Es gibt Kinderheime (kleine Gruppen, familienähnlich), Außenwohngruppen und Wohngruppen (kleinere Heimgruppen in Häusern oder Wohnungen) und Betreutes Wohnen (für Jugendliche/junge Volljährige, die Selbständigkeit bewiesen haben).
Wer ist die Zielgruppe der Heimerziehung?
Familien, in denen sich Kinder aufgrund familiärer oder anderer Lebensbedingungen nicht ausreichend entwickeln können. Mögliche Gründe sind Verhaltensstörungen, Schulprobleme, psychische Störungen, Suchterkrankungen in der Familie, Scheidungswaisen, Partnerschaftskonflikte, Überforderungen der Eltern. Heimeinweisungen erfolgen selten beim Erstkontakt mit dem Jugendamt.
Wo finde ich weiterführende Literatur zum Thema Heimerziehung?
Eine Auswahl an Literatur findet sich im Abschnitt "Literatur" des Dokuments, darunter Werke von Bürger, Chassé, Günder, Hansbauer, Münder, Schauder und Wiesner sowie verschiedene Online-Quellen.
- Quote paper
- Susanne Rehbein (Author), 2006, Heimerziehung - Hilfen zur Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109889