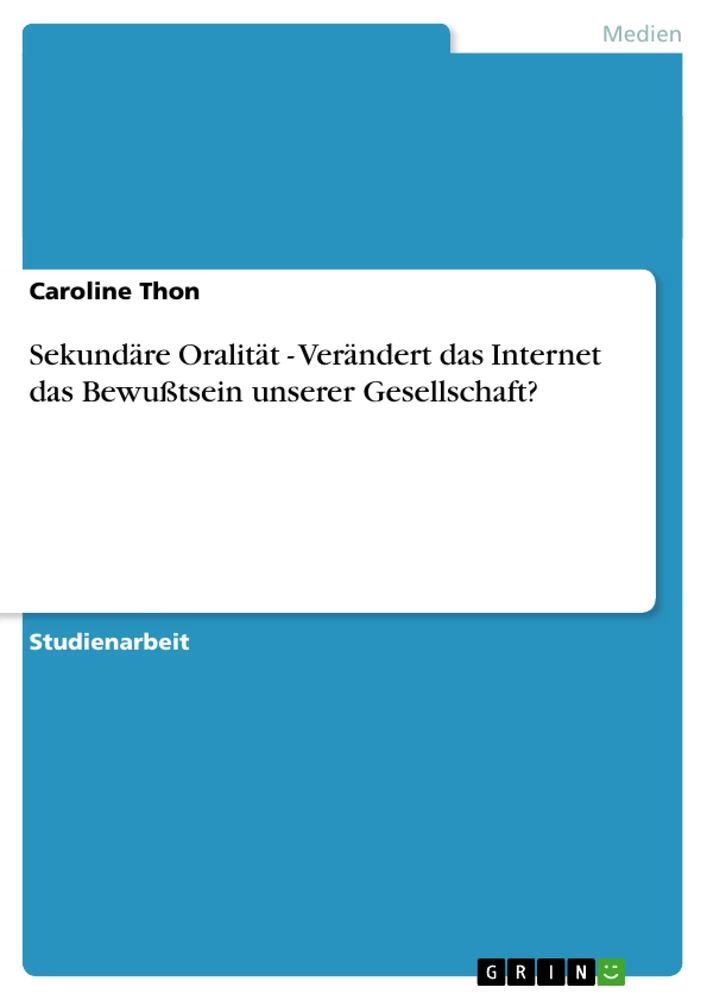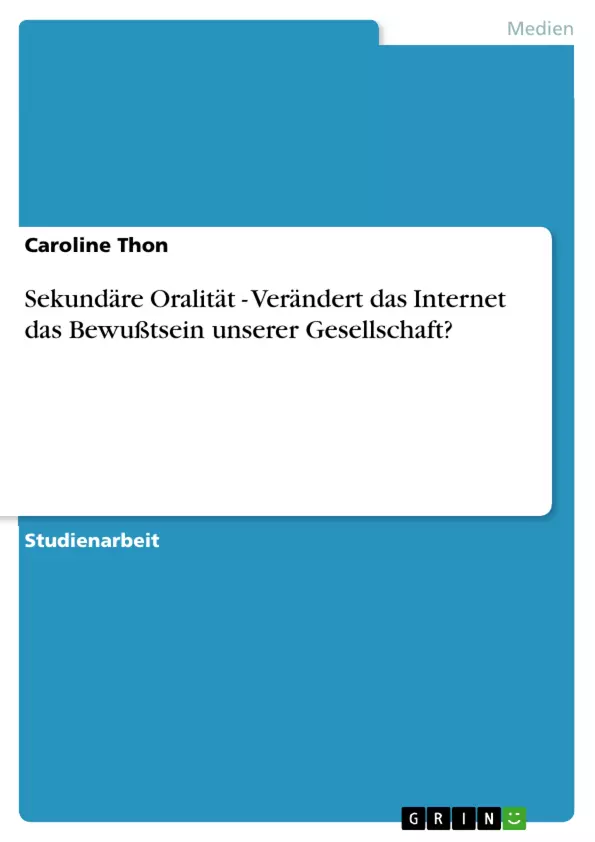Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das geschriebene Wort an Bedeutung verliert und die mündliche Überlieferung wieder die Oberhand gewinnt. Eine Welt, in der das Internet nicht nur ein Medium des Informationsaustauschs, sondern ein Katalysator für eine tiefgreifende kulturelle Verschiebung ist. Diese Abhandlung untersucht die faszinierende These der sekundären Oralität im Kontext des World Wide Web und analysiert, inwieweit das Netz unsere literale Kultur verändert oder gar zu einer Wiederbelebung oraler Traditionen führt. Ausgehend von den bahnbrechenden Arbeiten von Walter J. Ong und Eric A. Havelock, die die fundamentalen Unterschiede zwischen oralen und literalen Gesellschaften herausarbeiteten, widmet sich diese Untersuchung der Frage, ob das Internet als ein sekundär-orales Massenmedium betrachtet werden kann. Dabei werden die spezifischen Eigenschaften des Hypertextes, die Struktur des Netzes und die Rolle des Nutzers in den Blick genommen. Kathrine Kveims Dissertation "The World Wide Web – an instance of Walter Ong`s Secondary Orality?" dient als wichtiger Bezugspunkt, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Literalität und Oralität im digitalen Zeitalter zu beleuchten. Ergänzend dazu wird Neal Stephensons Science-Fiction-Roman "Snow Crash" herangezogen, um eine dystopische Vision einer re-oralisierten Gesellschaft zu entwerfen. Dieser Roman dient als Gedankenexperiment, um die potenziellen Konsequenzen einer solchen Entwicklung zu veranschaulichen und die Frage aufzuwerfen, ob die Rückkehr zur Oralität tatsächlich eine Bedrohung für unsere rationale Denkfähigkeit und unsere gesellschaftliche Ordnung darstellen könnte. Die Untersuchung geht der Frage nach, ob das Internet tatsächlich die Kraft besitzt, unser Bewusstsein zu verändern und uns in eine neue Ära der Kommunikation und des Wissensaustauschs zu führen. Es wird analysiert, ob die vermeintliche Demokratisierung des Internets und die einfache Möglichkeit der Teilhabe tatsächlich zu einer Stärkung der Gemeinschaft führen oder ob sie vielmehr die Gefahr der Manipulation und des Kontrollverlusts bergen. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Vision einer re-oralisierten Gesellschaft lediglich eine Science-Fiction-Fantasie ist oder ob sie uns einen Spiegel vorhält und uns auf mögliche Gefahren und Chancen der digitalen Revolution aufmerksam macht. Diese Arbeit lädt den Leser ein, sich auf eine spannende Reise durch die Welt der Medien, der Kultur und des Bewusstseins zu begeben und die tiefgreifenden Veränderungen zu hinterfragen, die das Internet in unserer Gesellschaft bewirkt.
Gliederung
1. Einleitung
2. Oralität und Literalität
2.1.Oralität – ein nicht nur “antikes“ Phänomen
3. Die These der Sekundären Oralität und das Netz
3.1. Das WWW als sekundär-orales Massenmedium?
3.2. Die re-oralisierte Gesellschaft – bloß eine Science Fiction-Vision?
4. Resümee
5. Literaturliste
1. Einleitung
Die eigentliche Entdeckung des Phänomens der Oralität durch die Wissenschaft datiert Eric A. Havelock auf die Jahre 1962 und 63. Damals erschienen vollkommen unabhängig voneinander fünf entscheidende Werke: La Pensée Sauvage von Claude Lévi-Strauss, „The Consequences of Literacy“ , ein Artikel von Jack Goody und Ian Watt, The Gutenberg Galaxy von Marshall McLuhan, Animal Species and Evolution von Mayr und Preface to Plato von Eric A. Havelock. Sie sind insofern thematisch miteinander verwandt, als daß sich alle diese Werke, mehr oder weniger intensiv und aus verschiedenen Ansätzen heraus, mit der Bedeutung von Oralität und Literalität für die menschliche Kultur befassen. Eric A. Havelock entwickelte seinen Oralitäts-Begriff anhand der griechischen Antike. Er hatte in seinen Studien zum platonischen Staat erkannt, daß die griechische Gesellschaft zu Platos Zeiten oral war und ihr gesamtes Wissen in Form von Epen und Dramen, also oraler Poetry, von Generation zu Generation weitervermittelte. Neben der Einsicht, daß Homers Ilias eine orale „encyclopedia“ ( Havelock 1963: 27) der griechischen Gesellschaft darstellte, entdeckte Havelock, wie Oralität die Strukturen einer Gesellschaft beeinflußt. Aufgrund seiner Erkenntnisse stellte er die These auf, daß das Bewußtsein durch das in der Gesellschaft vorherrschende Medium bestimmt werde.
Diese These wurde in der 1982 veröffentlichten Monographie Orality and Literacy. The Technologizing of the Word von Walter J. Ong weiterverfolgt. Im Gegensatz zu Havelock, welcher Oralität als eine Art evolutionäres Stadium behandelte, sah Ong Oralität als einen von solchen Prozessen unabhängigen Bewußtseinszustand an. Unter anderem erkannte er in den neuen Medien seiner Zeit eine neue Synthese von Oralität und Literalität, weshalb er den Begriff der „Sekundären Oralität“ prägte.
Die Bedeutung seines Buches wurde anscheinend erst in den Neunziger Jahren entdeckt, in denen insgesamt neun neue Auflagen erschienen. Der Grund war das Auftauchen eines neuen Massenmediums, welches Züge Ongs sekundärer Oralität aufzuweisen scheint – das Internet. Die Frage, welche nun gestellt werden kann, lautet: Wenn das Internet ein sekundär-orales Medium ist ergo orale Züge aufweist, wie verändert dies unsere literale Kultur bzw. unser literales Bewusstsein?
Um diesen Punkt zu diskutieren, werde ich mich mit der Dissertation von Kathrine Kveim The World Wide Web – an instance of Walter Ong`s Secondary Orality? befassen sowie dem Science-Fiction Roman Snow Crash von Neal Stephenson, welcher eine Vision einer, anhand der elektronischen Medien re-oralisierten Gesellschaft liefert.
2. Primäre Oralität und Literalität
Da der Umfang dieser Arbeit kaum ausreicht, um dem übergeordneten Thema in irgendeiner Weise gerecht zu werden, werde ich hier nur das uns fremde Phänomen „Primäre Oralität“ und seine Wirkung auf das menschliche Bewußtsein vorstellen und eine Darstellung der Literalität auf Implikationen bzw. die Schlüsse beschränken, welche sich aus den gezeigten Eigenschaften der primären Oralität für die Literalität ergeben. Eines möchte ich jedoch noch anführen: die Unterscheidung von Manuskript-Kultur und Print-Kultur werde ich nicht immer berücksichtigen können. Diese Unterscheidung ist zwar meiner Meinung nach, essentiell, kann in dem Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht konsequent gemacht werden.
2.1. Primäre Oralität – ein nicht nur “antikes“ Phänomen
Der Begriff „Primäre Oralität“[1] läßt sich auf Gesellschaften[2] anwenden, welche keine Form der phonetischen Schrift benutzen (Havelock 1986, S. 65)[3]. Orale Gesellschaften sind also vollkommen auf das akkustische Medium der mündlichen Sprache angewiesen. Töne sind flüchtig, sie lassen sich nicht ( außer natürlich man besitzt ein Tonaufnahmegerät ) nicht konservieren (vgl. Ong 1982, S. 31-33). Wie kann sich eine solche Gesellschaft organisieren? Aus dem literalen Blickwinkel gesehen ist Oralität eine schier unvorstellbare Situation, wo doch die Ordnung in unserer Gesellschaft vollkommen von der Möglichkeit der schriftlichen Kommunikation und Dokumentation abhängig ist. Was unsere Gesellschaft ausmacht ist schriftlich niedergelegt: in Archiven nachschlagbar, durch Bücher erlernbar und durch Unterschriften bezeugt. Orale Gesellschaften können diese Funktionen der schriftlichen Dokumentation durch das akkustische Medium der Sprache, wie wir es anhand Havelocks Forschung zur homerischen Dichtung sehen können, teilweise kompensieren. Jedoch muss man sich bewußt werden, daß die orale Welt weder durch Begriffe unserer literalen Welt erklärbar (vgl. Havelock 1986, S. 4), noch in irgendeiner Weise an unserer literalen Realität meßbar ist (vgl. Ong 1982, S. 56).
Wie unterscheidet sich also orale Kultur von literaler? Der Unterschied manifestiert sich offensichtlich im unterschiedlichen Gebrauch von Sprache. Was sind also die sprachlichen Charakteristika von Oralität?
„A simply oral dialect will commonly have resources of only a few thousand words[...]“ (Ong 1982: 8)
Die Vielfalt der benutzbaren Worte ist in einer oralen Kultur also bei weitem geringer als in einer Sprache, welche auch als Schrift existiert ( Ong schätzt den Wortschatz des Standard-Englisch auf 1,5 Millionen), da die Speicherkapazität des menschlichen Gedächtnisses Grenzen setzt. Dies ist, wie ich denke, ein wichtiger Aspekt der bestimmte Eigenschaften der oralen Sprache bedingt, wie Ong sie des weiteren aufzeigt. Außerdem wird Sprache in oralen Gesellschaften dem Kriterium der Memorierbarkeit unterworfen (Havelock zitiert in Ong 1982: 34), da eine Äußerung, kann sie nicht erinnert werden, sinnlos ist (ibid. S. 35).Die Poesie ist die Form, welche sich aus diesen „[m]nemonic needs“ wie Havelock sie nennt (ibid. S. 34), entwickelt hat.
Ihre Charakteristika finden sich teilweise auch unter folgenden wieder, welche, laut Ong, Oralität auszeichnen (siehe dazu ibid. S. 34 ff.):
1. stark rhythmisch
Rhythmus hilft zu erinnern. Er scheint außerdem ein natürlicher und wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens zu sein, findet er sich doch in allen biologischen Freuden – allen natürlichen, inklusive Sex wieder (Havelock 1986 S. 72).
2. eher additiv als subordinierend
Bezüglich der Syntax neigen orale Menschen zu additiven Verbindungen („und“), statt zu solchen wie „damit“, „dann“, „deshalb“, welche hierarchische Strukturen entstehen lassen.
3. eher aggregativ als analytisch
Wörter werden zu mehr oder weniger festen Formeln zusammengefügt (z.B. die schöne Prinzessin, der tapfere Soldat ).
4. redundant oder nachahmend
Wiederholungen und Ausschweifungen bieten dem Sprecher Zeit zur gedanklichen Weiterentwicklung der Rede und vermindern akkustische Verständnisprobleme des Zuhörers.
5. konservativ oder traditionalistisch
Das Konservieren von gewonnenem Wissen beansprucht in oralen Kulturen sehr viel Energie und Zeit. Intellektuelles Experimentieren riskiert den Verlust solchen Wissens.
6. nah am menschlichen Leben
Wissen wird in Bezug zur menschlichen Lebenswelt gewonnen und verbalisiert, indem die fremde, objektive Welt in das unmittelbare, bekannte Miteinander überführt wird.
7. kämpferischer Ton
In oralen Kulturen wird Sprache oft für verbale, intellektuelle Kämpfe eingesetzt.
8. eher einfühlend und teilnehmend als objektiv-distanziert
Lernen und Wissen bedeutet für eine orale Kultur, eine nahe, einfühlende gemeinsame Identifikation mit dem Wissensstoff (Havelock zitiert in Ong 1982, S. 45).
9. homöostatisch
Orale Gesellschaften sind insofern homöostatisch, alsdaß sie irrelevant gewordenes Wissen abwerfen, um ihr Gleichgewicht zu erhalten.
10. eher situativ als abstrakt
Begriffe oder Objekte etc. erhalten in der oralen Welt ihre konkrete Bedeutung erst in der Situation ihrer Anwendung in der Lebenswelt.
Wie sich die Konzeption der Sprache auf das Bewußtsein der Menschen, auf ihr Selbstverständnis und ihren Blick auf ihre Umwelt auswirkt, demonstriert Ong anhand
A.R. Lurias[4] Feldforschung an illiteralen Personen in Usbekistan und Kirgistan in den Jahren 1931-32 (siehe dazu Ong 1982 S. 50-57). Die Tests, welche Luria durchführte – sie entsprachen Intelligenztests, wie sie in literalen Gesellschaften gebräuchlich sind – legten folgendes über das orale Bewußtsein offen: Logik, wie sie in literalen Gesellschaften verstanden und angewandt wird, ist in oralen Kulturen nicht existent. Zwar verstehen orale Menschen den Zusammenhang von Ursache und Wirkung ( Ong 1982, S. 57), das logische Verknüpfen von Gedanken ist ihnen, wie ich es im Folgenden zeigen werde, aufgrund ihrer intellektuellen Voraussetzungen jedoch nicht möglich.
Abstrakte Sachverhalte, fremde Objekte, welche außerhalb ihrer ( der oralen Personen) Lebens- und Erfahrenswelt existieren, sind, so wie Ong sagt, uninteressant (ibid. S. 52 ff.). Solche Sachverhalte oder Objekte erhalten in oralen Kulturen erst in der Situation der Anwendung eine Bedeutung, das heißt: wenn sie eine konkrete Rolle in der Realität der oralen Person übernehmen. Ong nennt dies „situational“ bzw. „operational thinking“ (ibid. S. 49). So benannten illiterale Testpersonen geometrische Figuren, welche in keinem Zusammenhang mit ihrem alltäglichen Leben standen, nach Objekten, welche dieses taten. Übernimmt ein Gegenstand eine bestimmte Funktion im Leben eines oralen Menschen, so wird er nur durch diese definiert. Die oralen Testpersonen teilten somit, wenn sie im Test verschiedene Objekte präsentiert bekamen, die Objekte nicht in übergeordnete Kategorien ein,welches ein gewisses Maß an Abstraktionsvermögen voraussetzt , sondern sahen die Objekte in einem praktischen Zusammenhang, wie er in ihrer Erfahrungswelt existierte (ibid. S. 51). Auch Syllogismen, also logisches Schlußfolgern aufgrund von zwei gegebenen Bedingungen, sind oralen Menschen fremd. Die Bedingungen sind für das orale Denken zu sehr von der Erfahrungswelt isoliert (ibid. S. 53). Orale Menschen verlassen sich nicht auf die Ergebnisse abstrakter Gedankenspiele (welche sie wahrscheinlich auch nicht durchführen könnten), sondern sie arbeiteten mit dem Material, welches ihnen ihre sinnlichen Erfahrungen liefern. Lurias Tests zeigen weiterhin, daß diese konkrete Denkweise dem oralen Menschen es nicht ermöglicht, Definitionen zu erstellen oder auch Selbsteinschätzungen zu artikulieren (siehe Ong 1982, S. 54-55). Bei letzterem fehlt ihm die Fähigkeit sein Selbst zu isolieren, sei es von den Zusammenhängen operativer Abläufe oder aus der menschlichen Gemeinschaft, die ihn umgibt (ibid. S. 54-55). Er spiegelt sich allein in seiner Lebenssituation (z.B. seinem Familienstand und seinem Besitz (vgl. S. 54))und in den Reaktionen seiner Mitmenschen: „`We behave well - if we were bad people, no one would respect us´“ ( Luria zitiert in Ong 1982, S. 55).
Dies ist nur eine Facette oraler Denkweise. Sie zeigt jedoch schon, wie sehr Oralität den Menschen und sein Bewußtsein in die Grenzen eines Mikrokosmos`, der allein aus seiner Lebens- und Erfahrungswelt besteht, weist. Das Denken oraler Personen kann sich nur auf diesen Raum beziehen, wobei es auch noch emotional stark mit diesem verknüpft ist. Bestehendes Wissen wird ihnen durch Poetry vermittelt, welche möglichst memorierbar gestaltet ist und (zumindest zu Platos Zeiten) die Teile des menschlichen Bewußtseins anspricht, welche nicht-rationale und pathologische Gefühle beherbergen (vgl. Havelock 1963, S. 25). Rationales und objektives Denken wird also durch die Indoktrination mit altem, emotionalisiertem Gedankengut unmöglich gemacht. Neues Wissen läßt sich nur durch Empirie, durch Beobachtung der Umwelt oder Zufälle gewinnen. Es muß immer aus einer Kohärenz schon bestehender Dinge oder Erfahrungen erwachsen. Literalität dagegen erlaubt es dem Menschen ihr Denken von diesen Vorgaben zu lösen, “Ideen“ zu formen, praktische Erfahrung durch Gedankenspiele zu ersetzen und somit Entwicklungsstufen zu überspringen. Wie schon erwähnt, haben orale Personen Schwierigkeiten sich aus dem Kontext ihrer Umwelt zu isolieren und ihr Selbst gesondert zu betrachten. Mehr als der literalisierte Mensch scheinen sie sich als Teil dieser Umwelt anstatt als Individuum zu sehen.
Wie schon erwähnt, ist die Poesie die sprachliche Form, in der orale Kulturen ihr Wissen konservieren. Was diese Art der Konservierung für die Denkweise der Menschen bedeutet, möchte ich kurz anhand von Platos Kritik an der oralen Poetry des antiken Griechenlands umreissen.
Laut Plato zielt orale Poetry durch ihre poetische Sprache und ihren Rhythmus auf den Teil unseres Bewußtseins, welches irrationale und pathologische Gefühle beherbergt (Havelock 1963, S. 25). Wissen wird in in oralen Kulturen also schon beim Übertragungsvorgang direkt mit Irrationalität und Emotionalität verknüpft, es wird indoktriniert (ibid. S. 27). Orale Poetry also macht eigenes, logisches und auch kritisches Denken, wie wir es kennen und wie wir es für ein grundlegendes Merkmal des menschlichen Bewußtseins halten, unmöglich.
3. Die These der Sekundären Oralität und das Netz
In seinem Buch Orality and Literacy verwendet Ong ein kleines Unterkapitel (S. 135-38), um den Begriff der Sekundären Oralität einzuführen:
[...] the age of `secondary orality´. This new orality has striking resemblances to the old in its participatory mystique, its fostering of a communal sense, its concentration on the present moment, and even its use of formulas[...]. (Ong 1982: 136)
Er bezieht sich hier jedoch nicht auf das Medium Internet, welches zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der heutigen Form, das heißt, als Massenmedium, existierte. Stattdessen nennt er die Medien seiner Zeit: „[...] telephone, radio, television, various kinds of sound tape, electronic technology[...]“(ibid. 136). Man bekommt den Eindruck, daß Ong das Phänomen Sekundäre Oralität in diesen elektronischen Geräten aufgrund ihres (weitgehend) akkustischen Charakters feststellt. Dies ist ihre entscheidende Eigenschaft, welche sie der “schweigenden“ Literatur entgegensetzen, die Eigenschaft, weshalb sie oral wirken können:
„Like primary Orality, secondary orality has generated a strong group sense, for listening to spoken words forms hearers into a group, a true audience [...]“ (ibid. 136) Ong fügt aber auch hinzu, daß es sich hierbei um eine Art freiwillige und bewußte Oralität handelt, eine die wir gewählt haben ( im Gegensatz zu primärer Oralität, welche alternativlos ist). Außerdem sind diese neuen „sekundär-oralen“ Medien abhängig von der bestehenden literalen Kultur, da sie ein Produkt literaler Wissenschaft sind (ibid. 136).
Ongs Ausführungen zur sekundären Oralität bleiben gewollt skizzenhaft. Er selbst erkennt, daß er mit diesem Begriff ein “weites Feld“ betritt.
3.1. Das WWW als sekundär-orales Massenmedium?
Inwiefern kann man das Internet nun als sekundär-oral bezeichnen? Ong sieht, so wie ich es verstehe, den ausschlaggebenden oralen bzw. oralisierenden Charakter der neuen Kommunikations-mittel in ihrer Akustik.
Der Ansatz muß beim Internet also ein anderer sein. Kathrine Kveim hat dies in ihrer Dissertation The WWW – an instance of Walter Ong`s Secondary Orality? erkannt. Sie untersuchte die oralen Züge des Netzes anhand der Konzeption seines “Herzstücks“, dem Hypertext. Mit ihrer Argumentation möchte ich im weiteren Text beschäftigen.
Der Hypertext als Fundament des WWW fordert das literale Verständnis der heutigen Zeit auf verschiedene Weise heraus. Er spiegelt eine vollkommen andere Auffassung von Text wider, als die, die uns durch unsere Schrift- bzw. Printkultur vertraut ist. Während wir von Texten gewohnt sind, das ihr Inhalt einer logischen, für uns nachvollziehbaren Struktur, einer Linearität unterworfen ist, hebt der Hypertext diese Gesetze auf (Kveim). Im Falle des WWW besteht der Textkörper sozusagen aus der Gesamtheit aller „nodes“(ibid.), das heißt, allerTextstücke, welche durch links miteinanderverknüpft sind[5]. Eine Seite im Web stellt somit nur ein Fragment des Ganzen dar. Das einzelne Hypertext-Dokument steht also zwangsweise in einem übergeordneten Zusammenhang, ganz im Gegenteil zur Isoliertheit, der Abgeschlossenheit des Texts unserer literalen Kultur (Ong zitiert von Kveim). Kathrine Kveim vergleicht Hypertext daraufhin mit der homerischen Poesie, welche zwar einer bestimmten Themenvorlage folgte, jedoch keinen als solchen definierten Anfang und auch keinen Schluß kannte, da der Poet spontan die einzelnen Stücke auf immer wieder unterschiedliche Weise “zusammenflickte“. Der Internet-Nutzer wird, wie auch das orale griechische Publikum, in medias res entlassen, er landet inmitten eines gigantischen „docuverse“ (Kveims Begriff), durch welches er sich seinen eigenen und wahrscheinlich einzigartigen Weg bahnen muß (ibid.)[6].
Hierarchische Strukturen, wie wir sie aus unserer Gesellschaft kennen und wie wir sie inzwischen brauchen, um uns in dieser Welt zurechtzufinden, bietet das Netzwerk des Hypertextes per se nicht:
„In ideal hypertext, no node has any more primacy than another[...].[...]The hyperlink connects two documents by reference, not in itself saying anything about the quality of their relation.“(Kveim).
Die links eines solchen Netzwerks sind also additiven Charakters. Wenn das Netz hierarchische Strukturen (in Form von hotlists,Suchmaschinen, sitemaps, Web-Indices etc.) aufweist, dann deshalb, weil sie ihm auferlegt wurden (vgl. Kveim). Wie ich schon erwähnte, haben wir uns an Hierarchien gewöhnt, sie machen uns das Leben in den Größenverhältnissen, wie unsere Gesellschaft sie aufweist, wahrscheinlich erst möglich (die Raum-Metapher werde ich später gesondert darstellen). Werden wir also mit solchen labyrinthartigen, gigantischen Räumen, wie es das Internet einer ist, konfrontiert, sind wir orientierungslos. Kathrine Kveim vermutet, so wie ich selbst es bisher auch dargestellt habe, daß das Bedürfnis nach Hierarchien an unser literales Bewußtsein gekoppelt ist (Kveim). Jedoch ist in diesem Fall (das schließt weitere Fälle allerdings nicht aus) das Netz als Hybrid anzusehen. Der Mikrokosmos der Oralität bedarf keiner Hierarchien, ganz im Gegensatz zum Makrokosmos, welchen die Literalität sich nutzbar gemacht hat. Gerade die Fähigkeit hierarchische Strukturen aufzubauen, hat, so denke ich, den literalen Kulturen erst ermöglicht mit solchen Dimensionen umzugehen. Orale Personen würden sich im Internet, so wie es sich darstellt, nicht besser zurechtfinden.
Hier synthetisiert sich aus Literalität und Oralität eine Form, welche mit diesen Vokabeln nicht mehr fassbar ist. Dies wird auch bei Kveims „Card-Index“-Metapher deutlich. Hier vergleicht sie, das „Dokuversum“ als multi-lineares Gebilde aus Texten mit einem Karteikarten-Index. Letzterer ist ebenfalls darauf ausgelegt, die Linearität von Print-Texten zu durchbrechen, um so Argumentations-strukturen, Begriffe etc.des Textes freizulegen und überprüfbar zu machen (Kveim). Der, laut Ong, unangreifbare, in sich abgeschlossene Text (1982, S. 132) wird zerstückelt, willkürlich neu zusammengesetzt und somit auf eine Ebene gehoben, welche ihn dem kritischen Auge des Lesers aussetzt (Kveim). Kveim behauptet, daß Hypertext durch seine Form die gleiche Möglichkeit der Textanalyse bietet. Hypertext zwingt also den an sich „literalen“, linearen Text in die Form der „oralen“ Multilinearität, woraus sich ein Texthybrid mit ganz neuen Qualitäten ergibt.
Des weiteren soll die Raum-Metapher erläutert werden, wie sie von Kathrine Kveim zur Beschreibung des WWW benutzt wird. Wie Kveim anhand von Harold Innis[7] feststellt, ist die moderne, literale Welt auf die Expansion im Raum (Navigation, Mobilität, Verbindungen über große Distanzen) ausgerichtet, während sich orale Kulturen auf den Faktor „Zeit“ (Permanenz, Kontinuität, Geschichte etc.) konzentrieren, was sie an einen bestimmten Ort bindet. Das Konzept des WWW als expandierendes, grenzenloses, erforschbares „docuverse“ entspricht also dem modernen, literalen Bewußtsein. Trotzdem besteht die Tendenz, kleine Plätze in den Weiten des Netzes abzustecken, eine Art Inseln innerhalb des “oceans of information“(Kveim) auftauchen zu lassen, wo sich Internet-benutzer treffen und die Anonymität des Raumes verdrängen können (z.B. in Chaträumen bzw. -cafés, “Marktplätzen“(AOL), etc.). Auch die Bezeichnung “home“-page und andere Begriffe aus der heimeligen, konkreten Welt sollen eine intime, familiäre Atmosphäre schaffen (Kveim). Der Mensch versucht sich im abstrakten, gesichtslosen Gebilde des Netzes einen wärmenden, “oralen“ Mikrokosmos einzurichten: „[...]“modern“, literate culture has of course similar traits or needs for “oral“ situatedness and community.“(Kveim). Dabei ähnelt die Art, wie hier unbekannte, abstrakte Dinge durch die Benennung mit vertrauten Namen in die konkrete Lebenswelt überführt werden, dem Verhalten oraler Kulturen.
Auch die Flüchtigkeit der Dokumente ist dem literalen Menschen fremd. Gedruckte Texte existieren dauerhaft in der Realität, da sie stofflich sind. Die Existenz virtueller Texte dagegen ist instabil. Kveim zitiert Vannevar Bush[8], als er bezüglich des menschlichen Gehirns feststellt: „ trails that are not frequently followed are prone to fade, items are not fully permanent, memory is transitory“.Kveim zieht hier die Parallele zum Web, welches ähnlich funktioniert, indem veraltete Informationen verändert, gelöscht oder von den Hotlists verdrängt werden, um der Aktualität Platz zu schaffen (Kveim). Das Web ist, wie man sieht, kein Archiv, wie wir es in unserer Print-Kultur kennen. Eher geht es, so wie ich es verstehe, mit seinem Körper rationalisierend um, indem es sich von überflüssigem, irrelevant gewordenem Datenballast befreit. Ob man diese Eigenschaft als homöostatisch, wie Ong sie in oralen Kulturen erkannte(Ong 1982: 46-48), bezeichnen kann, kann ich nicht beurteilen[9] ..
Kveim sieht die Instabiltität des Netzes, die Tatsache, daß das Netz ein Machwerk eines Autors, sondern das von „thousands of collaborative authors“, nach deren Laune Teile des Webs auftauchen oder verschwinden, vielmehrals Parallele zur „manuscript culture, which according to Ong, is greatly oral“ (Kveim). Wie Hypertext-Dokumente, standen Manuskripte in einem Dialog mit ihrer Umwelt, weshalb sie empfänglich für ihre Einflüsse ergo Textänderungen waren (Kveim).
Die Instabilität, welche durch Web –Indices und Suchmaschinen nicht zu bändigen ist, ist, laut Kveim, sozusagen der Preis für die einfache Art und Weise, in der das Web aktualisiert werden kann. Aber auch der Preis dafür, daß praktisch jeder an der Gestaltung des Web teilnehmen kann. Kehrt hier im WWW, ganz im Sinne Ongs sekundärer Oralität, eine Mystik der Partizipation (1982, S. 136) zurück? Havelock beschreibt in Preface to Plato, wie sich die Reaktion der Griechen auf Vorführungen oraler Poetry geradezu pathologisch darstellte (1963, S. 27). Diese Emotionalität des Publikums beeinflußte Poeten, insofern, als daß er seine Verse auf die Gefühlslage der Zuhörer abstimmte (S. 27 ff.). Das Publikum bestimmte also den Verlauf der Geschichte mit.
Inwiefern können Internetnutzer den Inhalt des Netzes beeinflußen? Abgesehen von der Möglichkeit ohne großen Aufwand eine eigene Webseite ins Netz zu stellen und somit das „docuverse“ direkt zu verändern, kann der Internetnutzer auch indirekt Einfluß darauf nehmen, indem er beispielsweise eine Webseite besucht oder nicht. Eine seltene Frequentierung seiner Seite veranlaßt den Ersteller ( wenn er ein Interesse an zahlreichen Besuchern hat), die Seite, sei es graphisch oder auf inhaltlich, den Präferenzen des allgemeinen Internetnutzers anzupassen. Dies ist zwar eine generelle Tendenz, wenn es um die Vermarktung eines Produktes geht, doch ist die Reaktionsschnelligkeit im WWW potentiell sehr viel höher[10]. Auch Kveim stellt die Frage , inwiefern die Internet Fläche für interaktives Handeln des Nutzers bietet. Sie stützt sich dabei auf die Begriffe des „ exploratory hypertext “ sowie des „ constructive hypertext “ von Michael Joyce[11]. Ersterer ähnelt, wie Kveim es ausdrückt, dem Fernsehzappen. Der Internetnutzer ist nur insofern konstruktiv, als daß er durch die Auswahl der links und ihren dazugehörigen nodes, welche ihm im „ exploratory hypertext“ vorliegen, ein einzigartiges, persönliches Dokument “zusammenpuzzelt“ (Kveim). „ Constructive Hypertext“, sagt Kveim, läßt dagegen direkte Manipulation am Dokument durch den Internetbesucher zu ( z.B. IRC-Chats, MUDs etc.). Auch die Qualität des Internets als “pull“-Technologie[12] verlangt dem Internetnutzer ein gewisses Maß an Interaktivität ab (Kveim):
Während das Fernsehen (aber auch Radio, Zeitung etc.) seine Zuschauer mit seinen Inhalten “berieselt“, also auf Knopfdruck seine Sendungen in das Wohnzimmer “pusht“, beruht das Internet auf der Idee, daß sich der Internetnutzer das im Web vorhandene Material selbständig aussucht und auf seinen Rechner “zieht“ (Kveim).
Als letzten Punkt möchte ich noch einen wichtigen Aspekt des WWW kurz anführen: die Rolle des Autors. Unsere Print-Gesellschaft vertritt die Auffassung, daß ein Text das Eigentum seines Autors ist und sie hat mit dem Urheberschutzgesetz einen rechtlichen Rahmen dafür geschaffen. Ganz im Gegensatz zur oralen bzw. der Manuskript-Kultur, sagt Kveim: „The copying and dissemination of manuscripts was indeed a tribute to the originator [...]“. Nun ist es eher unwahrscheinlich, daß letzteres das Motiv der Internetnutzer darstellt, welche das Copyright mißachten. Dies ist auch eigentlich nebensächlich. Festgestellt werden kann jedoch, daß das Internet als schier unkontrollierbares, da unübersichtliches Gebilde, ideale Bedingungen zur Untergrabung des Urheberrechts bietet. Momentan mögen die Verfechter des Urheberrechts in solchen Fällen rein rechtlich gesehen noch im Vorteil sein. Es ist jedoch zu erwarten, daß sich, über kurz oder lang, die literale Gesellschaft mit dem Aufweichung und schliesslich der Abschaffung der Autorenrechte abfinden muß.
Natürlich ist das Thema an dieser Stelle noch nicht annähernd erschöpft. Es wird Kveims Dissertation nicht gerecht, hier die Diskussion abzubrechen, da sie noch mit vielen spannenden 0Aspekten aufwartet. Der Umfang dieser Arbeit kann eine Darstellung dieser allerdings nicht leisten. Deshalb komme ich nun zur abschließenden Frage dieses Abschnittes:
Kann man das Internet also als ein sekundär-orales Medium bezeichnen?
Kveim sagt hierzu:
„To scale the whole thing down, the Web is developed on the basis of so many previous media, in a society that in itself has both oral and literate traits, that a general statement of its character is extremely hard to make.“ (Kveim)
Das Internet trägt also orale Züge. Ob diese oralen Eigenschaften nun über die literalen dominieren, kann man, meiner Meinung nach, nicht sagen. Hypertext synthetisiert Literalität und Oralität. Man kann, meiner Ansicht nach, die oralen Eigenschaften nicht von den literalen isoliert sehen, da sie zusammenwirken. So ergeben sich vollkommen neue Formen von Texten, von Kommunikation etc., welche nur noch schwerlich mit den gewohnten und bekannten Begriffen zu beschreiben sind. Ebenso ist es daher fraglich, ob das Internet einen oralisierenden Effekt auf die Gesellschaft des Zeitalters der neuen Medien haben könnte. Dies möchte ich im folgenden Abschnitt anhand des Romans Snow Crash diskutieren.
3.2. Die re-oralisierte Gesellschaft – bloß eine Science Fiction-Vision?
Während Havelock in seinem Buch The Muse learns to write (1986) behauptet:
„The electronic media to which we have attended ever since World War I have not, however, returned us to that primary orality and they never could.“(Havelock 1986: 32), kontert Neal Stephenson in seinem Roman Snow Crash mit einer Skizze einer Gesellschaft, welche in die Oralität zurückgestossen wird. Ausgangspunkt ist eine futuristische Welt, welche sich in die Realität und das „Metaverse“ (Stephenson 1992, S.19) geteilt hat. Letzteres stellt sich in Form eines riesigen Chatraums dar, welcher graphisch sowie von der Bedienung der menschlichen Lebenswelt nachempfunden ist. Wie in der Realität basiert die Kommunikation innerhalb des „Metaverse“ auf akustischer und körperlicher Sprache (S.19 ff.). Die literalen Komponenten sind in Stephensons Zukunftsgesellschaft auf ein Minimum reduziert. Der Gebrauch von Papier ist unerwünscht und wird durch Computerbildschirme ersetzt (S. 263), Bibliotheken sind nur noch in Form von Computerdatenbanken vorhanden (siehe S. 21) und „Hypercards“ , welche Informationen in multimedialer Form speichern (siehe S. 14 ff.), haben schriftliche Dokumente verdrängt. Die Zersplitterung der ehemaligen Nationalstaaten in Stadtstaaten, deren gesamte Institutionen durch verschiedene Wirtschaftskonzerne verkörpert werden (siehe S. 41 ff.), liefert weiterhin gute Bedingungen zur Aufweichung der literalen Gesellschaft. Schließlich dienen immense Leuchtreklame-Tunnel, sogenannten „Loglos“ (S. 7), dem Zweck, die Bevölkerung konsequent mit Werbung sprich „oralen“ Botschaften zu infiltrieren. Weiterhin bietet das „Metaverse“ den Wohlhabenden und der gebildeten Elite eine orale “Zweitwelt“, während die weitgehend illiterate „workforce“ das Fernsehprogramm konsumiert, welches Stephenson als oral bezeichnet (vgl. S. 379 ff.). Die hacker stellen in dem Roman die einzige gesellschaftliche Gruppe dar, welche durch den kreativen Umgang mit Computersprachen noch auf eine „literale“ Denkweise angewiesen sind.
Die Oralität fällt in Form eines linguistischen sowie biologischen Virus in diese Gesellschaft ein. Stephenson charakterisiert den linguistischen Virus anhand seiner Fähigkeit, manipulierend in einem Bereich des menschlichen Gehirns zu wirken, welcher außerhalb der rationalen Kontrolle des Menschen liegt. Das literale Bewußtsein der infizierten Menschen wird auf ein primär-orales “umgepolt“, was zu dem Verlust ihrer Fähigkeit des rationalen, literalen Denkens führt. Leichte Opfer dieses linguistischen Virus` (hier in Form der Glossolalie bzw. post-rationaler Religion) stellen in Stephensons Roman die Masse der Menschen dar, welche ihre rationale Denkkraft durch den ständigen und unreflektierten Konsum der Produkte der weitgehend „oralen“ Medien wie das Fernsehen etc. geschwächt haben (S. 379). Lediglich die hacker reagieren auf diese Art des Virus`immun, da sie durch ihre Arbeit ihre „Literalität“ bewahrt haben, und somit die Fähigkeit besitzen, rational gegen das irrationale Gedankengut zu argumentieren (vgl. S. 379). Stephenson illustriert die Konsequenzen einer flächendeckenden Re-oralisierung anhand der primär-oralen Gesellschaft Sumers[13]. Die Organisation der sumerischen Gesellschaft aber auch das Überleben des einzelnen Gesellschaftsmitglieds beruhte auf der Existenz und mündlichen Verbreitung der Me, welche eine Art verbaler Regelkanon für politisches, soziales, technisches und religiöses Verhalten der Sumerer darstellte (siehe dazu S. 235 ff.). Ähnlich wie die griechische Poesie machten die durch Keilschrift konservierten Me jeder oralen Person lebensnotwendiges Wissen zugänglich, welches durch lange empirische Beobachtung und Erfahrung gewonnen worden war . Auf die Art, wie die Me die mangelnde Wissenschaftlichkeit und Innovativität des oralen Geistes kompensierte, verhinderten sie auch den Übergang des oralen Bewußtseins in ein literales (vgl. S. 235 ff.). Der Rückfall in die primäre Oralität würde also, laut Stephenson, für die Gesellschaft einen abrupten Stopp jeglicher Weiterentwicklung bedeuten. Das Schicksal würde, wie es in dem Roman anhand der fiktiven Person L. Bob Rife demonstriert wird, in der Hand des Menschen bzw. der Menschen liegen, welche in der Lage sind Me zu konstruieren und somit die oralisierten Massen zu leiten. Stephenson meint also, daß eine umfassende Re-oralisierung der Gesellschaft die geistige Abhängigkeit der Massen von einem Diktator bzw. einer kleinen Führerelite zur Konsequenz hätte (siehe S. 379).
4. Resümee
Sekundäre Oralität – Verändert das Internet das Bewußtsein unserer Gesellschaft?
Sicherlich beeinflußt dieses Medium die Entwicklung unseres Bewußtseins. Schließlich kann man den (weitgehend) literalen Zustand, in dem wir uns befinden, nicht als den finiten sehen. Die Frage ist jedoch, in welcher Weise dies geschehen wird. Stephensons Vision einer Re-oralisierung ist für die Realität , meiner Meinung nach nicht unbedingt auszuschließen. Zwar existierten in „modernen“, literalen Gesellschaft wie der unseren immer orale Bedürfnisse und Strömungen, die neuen Technologien bieten ihnen allerdings durch ihre globale Reichweite und, wie ich meine, auch durch ihr Basieren auf akustischer statt schriftlicher Sprache, eine enorme Plattform.
Stephensons gigantischer, realitätsgetreuer “Chatraum Metaverse“ ist eine konsequente Weiterführung der Entwicklungen in den heutigen Medien, welche das starke Bedürfnis nach oraler, nämlich emotionaler face-to-face- Kommunikation des Großteils der Bevölkerung entdeckt haben (siehe die Entwicklung von Talk-Shows und Sendeformaten wie beispielsweise „Big Brother“).
Wenn das Internet also der Oralität ein Forum bietet, dann geschieht dies, so denke ich, dadurch, daß der Mensch dem Netz orale Strukturen auferlegt. Die eigentliche Konzeption des Hypertext bevorteilt orale Strukturen, meiner Meinung nach, nicht. Eher synthetisiert er häufig „literale“ und „orale“ Eigenschaften, woraus zum Beispiel neue Möglichkeiten im Umgang mit Texten entstehen (siehe Kveims „card index-metaphor“).
Allerdings, und dies meint auch Kathrine Kveim, sollte man das positive Potential des Hypertext nicht überschätzen. Schließlich unterliegt der Inhalt des Internets in der Wirklichkeit der Willkür unzähligerAutoren, welche mit ihren Beiträgen auch bestimmte Ziele verfolgen, weshalb es eigentlich weder neutrale links noch objektive Information geben kann. Das WWW stellt also, so Kveim, keinesfalls eine allumfassende Bibliothek menschlichen Wissens dar, welches unreflektiert übernommen werden kann. Daß das Internet den Ruf einer Enzyklopedie genießt, läßt sich allein anhand der steigenden Zahl der Internetanschlüsse in Schulen und Universitäten erkennen. Die Gefahr liegt also nicht im Medium „Internet“ an sich, sondern in seinen Rezipienten. Die Art und Weise, wie wir mit dem Internet umgehen, bestimmt, inwiefern unser Bewußtsein von ihm manipukiert werden kann.
5. Literaturliste
Havelock , Eric A. Preface to Plato. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1963
Havelock, Eric A. The muse learns to write. Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present. Binghamton, N.Y.: Vail Ballou Press, 1986
Kveim, Kathrine The World Wide Web – an instance of Walter Ong`s Secondary Orality?.
Diss. (o.J.) (WWW: http://www.angelfire.com/oh/kathrine/dissertation.html )
Ong, Walter J. Orality and Literacy.The Technologizing of the Word. London: Methuen, 1982
Stephenson, Neal Snow Crash . Great Britain: Roc, 1993
[...]
[1] Wenn ich mich im Folgenden auf „Oralität“ beziehe, meine ich damit die „primäre Oralität“.
[2] Laut Havelock kann eine Theorie über Oralität nur auf eine Gesellschaft bezogen aufgestellt werden und nicht auf die private Transaktion zwischen zwei Individuen (Havelock 1986, S. 68).
[3] Mit “phonetischer Schrift“ meint Havelock eine Schrift, die aus Zeichen besteht, welche die einzelnen Laute einer Sprache repräsentieren (Havelock 1986, S 65).
[4] Luria, A. R. Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations (1976)
[5] Vannevar Bush behauptete bezüglich seiner Idee des memex ( memory extension, eines Geräts welches in seiner Konzeption dem menschlichen Nervensystem nachempfunden war ), daß das menschliche Denken anhand von Assoziation arbeitet (Kveim). Hypertext bietet durch seine Verknüpfungen die Möglichkeit assoziativ zu lesen bzw. denken. Nach Bush müßte dem Menschen die Arbeit mit einer solchen Struktur also leichtfallen.
[6] Je nachdem, in welchen Textzusammenhang die einzelne node durch denVerlauf der “Reise“ im „docuverse “eingebettet wird, erhält sie für den Leser eine individuelle Bedeutung. Ihre Interpretation ist also situationsabhängig.
[7] in Carey, James W . Communication as Culture (1992)
[8] Bush, Vannevar As We May Think (1945)
[9] An einer anderen Stelleihrer Dissertation, auf einen anderen Aspekt bezogen, bestreitet Kveim, daß man orale Kulturen als homöostatischbezeichnen könne, da sie in ihrer Entwicklung dynamisch seien. Allerdings meine ich, daß Homöostase Dynamik keineswegs ausschließt. Gerade indem orale Kultur veraltete Daten abwirft, ist sie entwicklungsfähig, da sie dadurch wieder an Speicherkapazität und gedanklichen Freiraum für die Entwicklung neuer Gedanken zurückgewinnt.
[10] Außerdem gestaltet sich das Internet als praktisch rechtsfreier Raum, was auch bedenkliche “killer applications“ zum Fang von Internetbesuchern möglich macht.
[11] Joyce, Michael: Siren Shapes: Exploratory and Constructive Hypertexts (1988)
[12] Das Internet weist auch “push“-Eigenschaften auf, wie beispielsweise News Ticker etc. (Kveim), welche jedoch nicht dominieren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ausgangspunkt dieser Arbeit?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob das Internet als ein sekundär-orales Medium betrachtet werden kann und welche Auswirkungen dies auf unsere literale Kultur bzw. unser literales Bewusstsein hat. Sie untersucht die Thesen von Walter J. Ong zur sekundären Oralität und deren Anwendbarkeit auf das World Wide Web.
Was ist primäre Oralität und wie unterscheidet sie sich von Literalität?
Primäre Oralität bezieht sich auf Gesellschaften ohne phonetische Schrift. In oralen Kulturen ist die mündliche Sprache das zentrale Medium zur Wissensvermittlung. Im Gegensatz dazu basiert Literalität auf der Schrift und ermöglicht eine schriftliche Dokumentation und Kommunikation. Orale Sprachen sind oft weniger vielfältig, stark rhythmisch, additiv, redundant, konservativ, nah am menschlichen Leben, kämpferisch, einfühlend und situativ.
Wie beeinflusst Oralität das Bewusstsein und Denken?
A.R. Lurrias Feldforschung zeigt, dass orales Bewusstsein sich von dem in literalen Gesellschaften unterscheidet. Logisches Denken im literalen Sinne ist in oralen Kulturen weniger ausgeprägt. Abstraktionen sind schwierig, und Wissen wird stark situationsbezogen und emotional vermittelt. Menschen in oralen Kulturen identifizieren sich stärker mit ihrer Lebenswelt und Gemeinschaft als mit ihrem individuellen Selbst.
Was ist sekundäre Oralität nach Walter J. Ong?
Ong prägte den Begriff der sekundären Oralität, um eine neue Synthese von Oralität und Literalität in den neuen Medien seiner Zeit (Telefon, Radio, Fernsehen) zu beschreiben. Diese Medien haben Ähnlichkeiten mit primärer Oralität in Bezug auf Partizipation, Gemeinschaftsgefühl und Konzentration auf den gegenwärtigen Moment. Im Gegensatz zur primären Oralität ist sekundäre Oralität eine bewusste und freiwillige Wahl und basiert auf literaler Wissenschaft.
Inwiefern kann das WWW als sekundär-oral bezeichnet werden?
Kathrine Kveim untersucht die oralen Züge des Internets anhand des Hypertexts. Hypertext fordert das lineare Textverständnis heraus und spiegelt eine andere Auffassung von Text wider. Das WWW kann als ein gigantisches "docuverse" betrachtet werden, in dem der Nutzer seinen eigenen Weg bahnen muss. Es bietet keine inhärenten hierarchischen Strukturen, sondern wurde mit solchen Strukturen überlagert. Allerdings synthetisiert das Internet Oralität und Literalität, was zu neuen Formen von Texten und Kommunikation führt. Die Raummetapher (als expansionierendes Dokuversum) und die Instabilität der Inhalte (da Texte sich verändern oder verschwinden können) sind weitere Aspekte, welche in der Dissertation diskutiert werden.
Was ist die Rolle der Interaktivität im WWW?
Das Internet als "Pull"-Technologie erfordert Interaktivität. Der Nutzer wählt selbstständig die Inhalte aus und "zieht" sie auf seinen Rechner. Dies unterscheidet sich von "Push"-Medien wie dem Fernsehen. Auch die Möglichkeit der direkten Manipulation am Dokument (z.B. in Chats) sowie die Beeinflussung des Web-Inhalts durch Webseiten-Besuche oder deren Unterlassung spielen eine wichtige Rolle.
Wie steht es um das Urheberrecht im WWW?
Das Internet untergräbt aufgrund seiner Unübersichtlichkeit und Unkontrollierbarkeit das Urheberrecht. Es ist wahrscheinlich, dass sich die literale Gesellschaft langfristig mit der Aufweichung oder Abschaffung der Autorenrechte abfinden muss.
Wie sieht Neal Stephenson die Re-Oralisierung in "Snow Crash"?
In "Snow Crash" entwirft Stephenson eine futuristische Gesellschaft, die durch einen linguistischen Virus in die Oralität zurückgestossen wird. Der Virus manipuliert das Gehirn und führt zum Verlust des rationalen Denkens. Hacker (mit ihrem "literalen" Denken) sind immun. Die Re-Oralisierung führt zu einer Gesellschaft, die von der Konstruktion und Verbreitung von "Me" abhängig ist und in der die Massen von einer Führerelite geleitet werden.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Internet beeinflusst die Entwicklung unseres Bewusstseins, aber in welcher Weise, ist schwer zu sagen. Stephensons Vision einer Re-Oralisierung ist nicht auszuschließen. Das Internet bietet der Oralität ein Forum. Die eigentliche Konzeption des Hypertexts bevorteilt orale Strukturen jedoch nicht zwingend, sondern synthetisiert oft literale und orale Eigenschaften. Das positive Potenzial des Hypertexts sollte nicht überschätzt werden. Die Art und Weise, wie wir mit dem Internet umgehen, bestimmt, inwiefern unser Bewusstsein von ihm manipuliert werden kann.
- Citar trabajo
- Caroline Thon (Autor), 2001, Sekundäre Oralität - Verändert das Internet das Bewußtsein unserer Gesellschaft?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109601