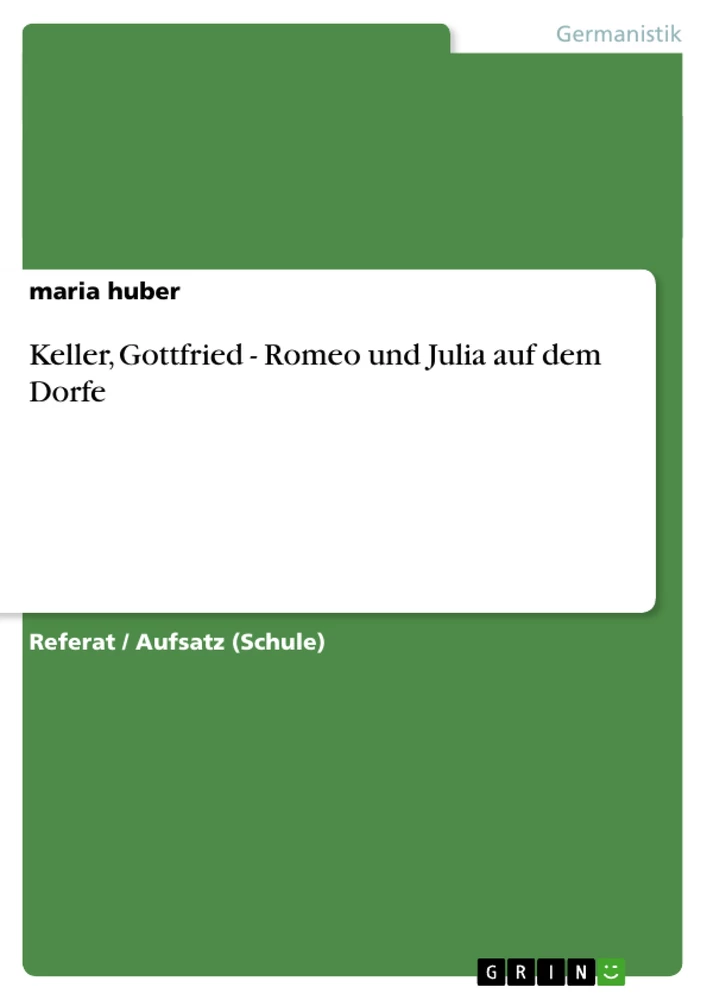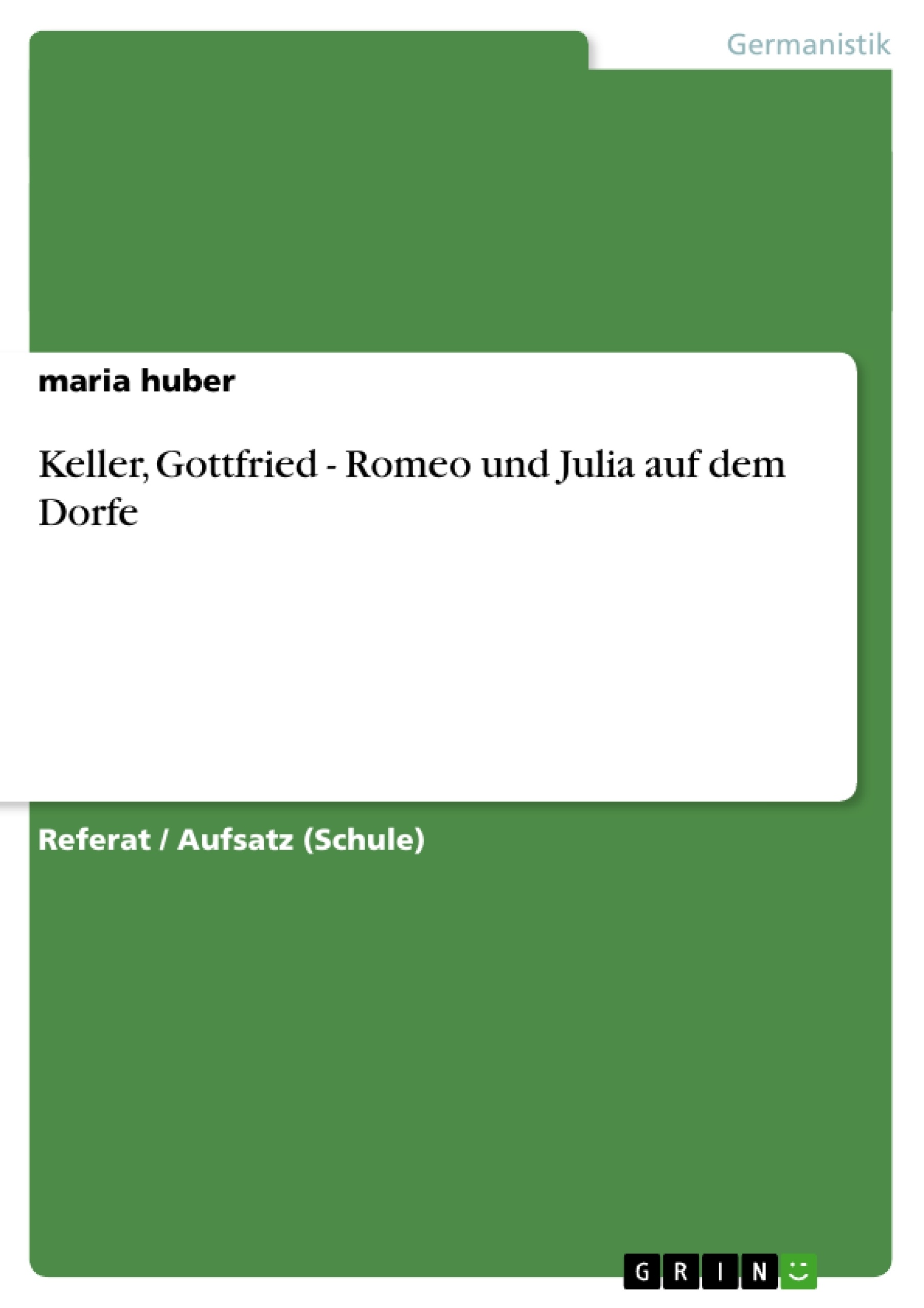Gottfried Keller: „Romeo und Julia auf dem Dorfe“
Einleitung (S.3-9)
- zwei Bauern, Manz und Marti, deren Austauschbarkeit betont wird (Personalpronomen und Bezeichnungen wie Bauer, Nachbar, Meister)
- das Spiel der Kinder: als Vorrausdeutung auf kommendes Geschehen: Untergang, Zerstörung, Tod
- der schwarze Geiger: ausgegrenzt, verachtet, auf der sozialen Stufenleiter ganz unten, nicht zur dörflichen Gemeinschaft gehörend
legt auch keinen Wert darauf: falls ihm der Acker gehört
- erzählte Zeit ca. 1 Tag
- Rückblende: Konflikt (=Ackerstreifen) wird angesprochen Welche Auswirkungen hat der Streit der Bauern auf das Verhältnis der beiden Kinder?
- können sich durch Streit nicht mehr sehen Väter werden böse wenn sie miteinander spielen/sprechen
als Manz sein ersteigertes Stück Feld in Ordnung bringt, helfen viele Leute mit (auch Vrenchen)
als Marti kommt bekommt Vr. Eine Ohrfeige, weil sie bei Sali ist
Entwicklung der beiden Bauern
- streiten sich über kleines Dreieck Feld
- der ein wollte mehr Geld haben als der andere
wurden immer ärmer und hatten große Schulden (durch Gerichtskosten, Rechtsanwälte, Spekulanten)
- vernachlässigten ihre Felder
- Manz zog in die Stadt und machte dort eine Kneipe auf
am Anfang kam noch Kundschaft doch später wurden es immer weniger
- seine Frau macht sich lächerlich
- geht mit seinem Sohn fischen um etwas zu essen zu haben
- Marti geht auch fischen
hat sein Haus auch vernachlässigt, Frau ist gestorben, Vr. Muss auch mit zum fischen
Bild der Gesellschaft
- Mitmenschen machen sich nur lustig und helfen nicht
- versuchen sich an deren Armut /Unglück zu bereichern
- Stadtbevölkerung ist eingebildet, arrogant
- Entfremdung zwischen den Menschen
- unterschiedlich im Ansehen (S.17)
Erster Höhe- und Wendepunkt
- Väter sehen sich am gegenüberliegenden Ufer
- beschimpfen sich und rennen am Ufer entlang
- treffen auf einer Brücke zusammen und beginnen sich zu prügeln
- Kinder unterstützen ihre Väter versuchen dann aber die Väter zu trennen (sehen sich das erste mal wieder und entwickeln Sympathien füreinander)
Häufig gestellte Fragen zu Gottfried Keller: „Romeo und Julia auf dem Dorfe“
Was sind die zentralen Themen in der Einleitung?
Die Einleitung betont die Austauschbarkeit der beiden Bauern Manz und Marti, die Vorrausdeutung des Untergangs und des Todes durch das Spiel der Kinder sowie die Ausgrenzung und Verachtung des schwarzen Geigers.
Wie wird der Konflikt zwischen den Bauern eingeführt?
Der Konflikt wird durch eine Rückblende angesprochen, die den Streit um einen Ackerstreifen thematisiert.
Welche Auswirkungen hat der Streit der Bauern auf Sali und Vrenchen?
Der Streit verhindert, dass sich Sali und Vrenchen sehen können. Ihre Väter werden zornig, wenn sie miteinander spielen oder sprechen.
Welche Ereignisse geschehen beim Instandsetzen des ersteigerten Feldes von Manz?
Viele Leute, einschließlich Vrenchen, helfen Manz beim Instandsetzen seines ersteigerten Feldes. Als Marti erscheint, gibt er Vrenchen eine Ohrfeige, weil sie bei Sali ist.
Wie entwickeln sich die beiden Bauern im Laufe der Geschichte?
Sie streiten sich um ein kleines Dreieck Feld und wollten beide mehr Geld als der andere. Sie verarmen durch Gerichtskosten und Spekulanten, vernachlässigen ihre Felder. Manz zieht in die Stadt und eröffnet eine Kneipe, während Marti sein Haus vernachlässigt und seine Frau stirbt.
Wie wird das Bild der Gesellschaft dargestellt?
Die Mitmenschen machen sich über die Armut und das Unglück der Bauern lustig und versuchen, sich daran zu bereichern. Die Stadtbevölkerung wird als eingebildet und arrogant dargestellt. Es herrscht Entfremdung zwischen den Menschen und es gibt unterschiedliches Ansehen.
Was ist der erste Höhe- und Wendepunkt in der Geschichte?
Die Väter sehen sich am gegenüberliegenden Ufer und beschimpfen sich. Sie treffen sich auf einer Brücke und prügeln sich. Die Kinder unterstützen zunächst ihre Väter, versuchen sie dann aber zu trennen, entwickeln Sympathien füreinander und schämen sich für ihre Väter.
- Quote paper
- maria huber (Author), 2005, Keller, Gottfried - Romeo und Julia auf dem Dorfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109234