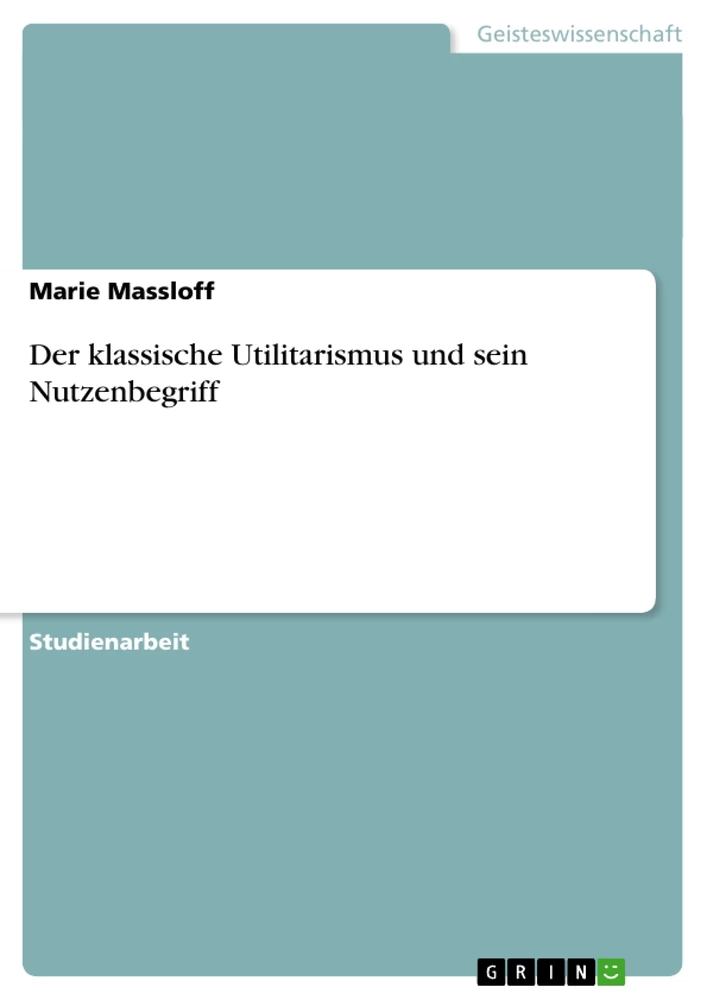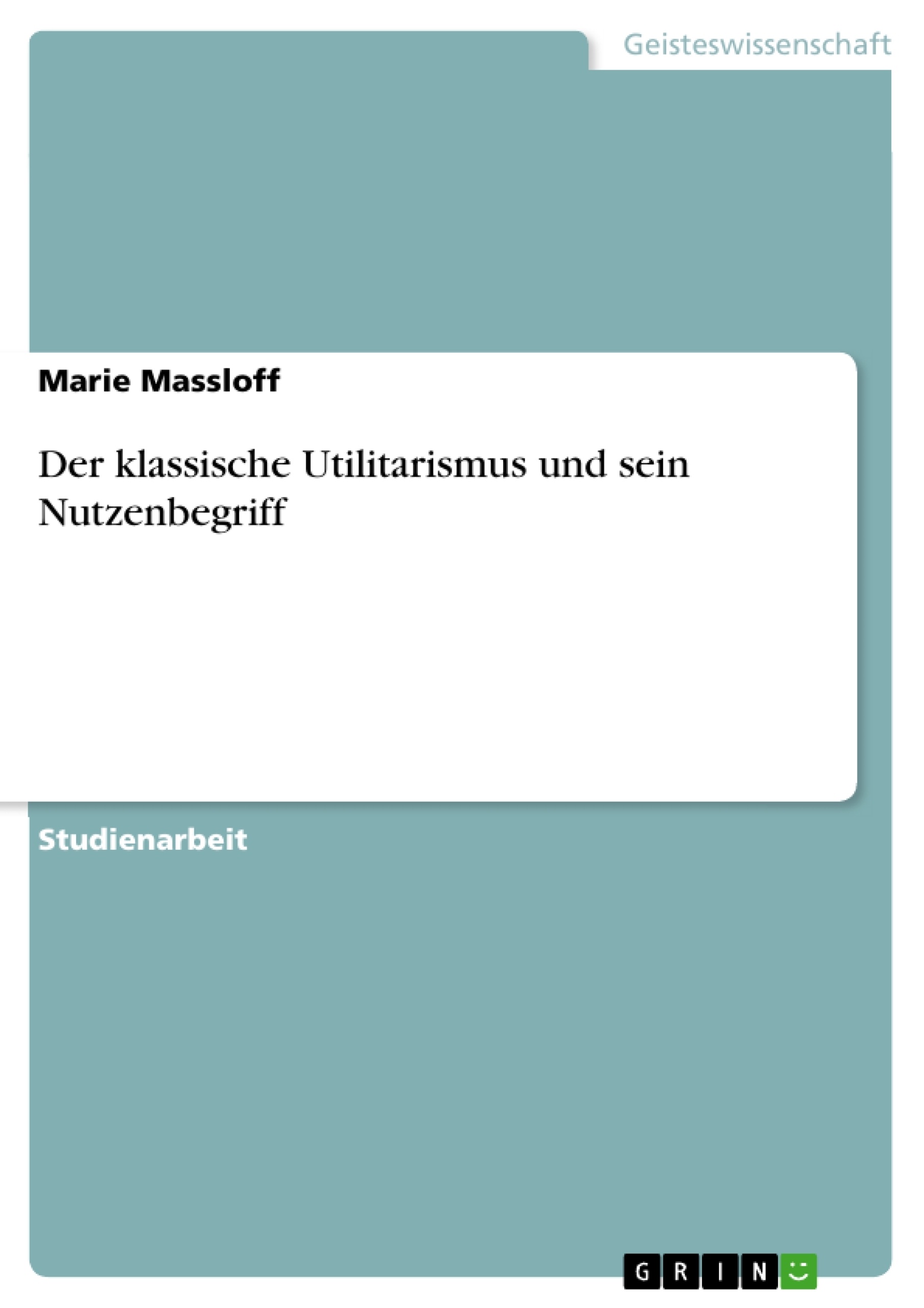Der Utilitarismus ist eine ethische Theorie, die eine Handlung danach beurteilt, ob sie im Vergleich zu anderen Handlungsalternativen eine möglichst große Zahl positiver Werte hervorbringt. Der ethische Wert hängt davon ab, ob bzw. inwiefern diese Handlung die Anzahl der positiven Werte nichtmoralischer Art, wie Glück, Reichtum und Gesundheit, zu vermehren vermag. Vereinfacht ausgedrückt, hängt der Wert einer Handlung von deren Nutzen ab. Das Interesse und die Aufregung um die utilitaristische Ethik - eigentlich eine Familie von Theorien mit gleicher Kernthese - ist allen Anfeindungen und Kritiken zum Trotz nie zum Erliegen gekommen. Worin liegt das Geheimnis dieses Erfolges? Es liegt zu einem nicht unbedeutendem Teil in der Uminterpretierung des zentralen Begriffes: des Nutzenbegriffes. Diese Uminterpretierung ist dabei durchaus keine Errungenschaft des Utilitarismus; er hat sich lediglich zunutzen gemacht, was zur Verteidigung empirischer Thesen bereits erprobt worden war.
Die Kernthese, die vereinfacht ausgedrückt aussagt, dass "das größte Glück der größten Zahl"7 zu erreichen das Ziel menschlichen Handelns ist, wird durch eine umfangreiche Menge an Hilfshypothesen und genaueren Aussagen umhüllt, unterstützt und verteidigt. Diese Hülle ist sozusagen der Schutzgürtel, der alle Angriffe auf den Kern abfängt und dabei selber ständiger Veränderung unterworfen ist. Diese Veränderungen sind notwendig, weil im Verlauf der Zeit ständig neue Erkenntnisse hinzugewonnen werden, die die ursprünglichen Ansichten aus einem stets neuen Blickwinkel betrachten. Will sich eine Theorie nicht als statisch und somit früher oder später als nicht mehr zeitgemäß erweisen, so muss sie wiederholt modifiziert werden. Der Utilitarismus hat sich hierin als überaus hartnäckig erwiesen. Offenbar hat sich die Kernthese als etwas erwiesen, dass Wert ist, seit über zweihundert Jahren erhalten und verteidigt zu werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Der Utilitarismus und seine hauptsächlichen Kritiken
2. Hedonistisches Gedankengut
3. Jeremy Bentham
4. John Stuart Mill
5. Henry Sidgwick
Schlussbetrachtungen
Bibliographie
Quellenverzeichnis
1. Der Utilitarismus und seine hauptsächlichen Kritiken
Der Utilitarismus ist eine ethische Theorie, die eine Handlung danach beurteilt, ob sie im Vergleich zu anderen Handlungsalternativen eine möglichst große Zahl positiver Werte hervorbringt. Der ethische Wert hängt davon ab, ob bzw. inwiefern diese Handlung die Anzahl der positiven Werte nichtmoralischer Art, wie Glück, Reichtum und Gesundheit, zu vermehren vermag. Vereinfacht ausgedrückt, hängt der Wert einer Handlung von deren Nutzen ab. Das Interesse und die Aufregung um die utilitaristische Ethik - eigentlich eine Familie von Theorien mit gleicher Kernthese - ist allen Anfeindungen und Kritiken zum Trotz nie zum Erliegen gekommen. Worin liegt das Geheimnis dieses Erfolges? Es liegt zu einem nicht unbedeutendem Teil in der Uminterpretierung des zentralen Begriffes: des Nutzenbegriffes. Diese Uminterpretierung ist dabei durchaus keine Errungenschaft des Utilitarismus; er hat sich lediglich zunutzen gemacht, was zur Verteidigung empirischer Thesen bereits erprobt worden war.
Der Beginn der Uminterpretierung erfolgte noch während der Blütezeit des klassischen Utilitarismus am Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts durch John Stuart Mill und Henry Sidgwick, um zwei der wichtigsten Vertreter zu nennen. Die Gründe für diese Uminterpretierung sind zum einen in den schon früh lautwerdenden Kritiken zu finden und zum anderen sind veränderte Sichtweisen der Autoren selber Auslöser für eine Modifizierung der utilitaristischen Ethik. Die hauptsächlichen Kritikpunkte werden auch heute noch unweigerlich aufgeworfen, wenn man sich näher mit der utilitaristischen Ethik beschäftigt.
Einer dieser Punkte ist zum Beispiel der Vorwurf an die Utilitaristen, dass sie keine Vorschläge zur distributiven Gerechtigkeit machen. So wird zwar die Maximierung des Gesamtnutzens angestrebt, aber kein Hinweis zu dessen anschließender Aufteilung gegeben. Nun, auch wenn die klassischen Utilitaristen sich sehr stark für eine erhebliche Ausweitung der Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mittelklasse gegen den Willen der Aristokratie einsetzten, so darf man nicht davon ausgehen, dass ähnliches auch für die Unterschicht ins Auge gefasst wurde. Es war Mill, der meinte, "[...] der gebildete Mittelstand würde besser wissen, was dem Volk nottäte, als das Volk selbst, und er würde auch, ungleich dem Adel, selbstlos handeln."1 und es war Bentham, der sich ohne weiteres Zögern eher zur Sicherung des Eigentums als zu dessen Gleichverteilung bekannte. Auch wenn man eine klare Trennlinie zwischen Utilitarismus und Liberalismus ziehen sollte, so lässt sich doch nicht leugnen, dass liberales Gedankengut im Heimatland John Lockes tief verwurzelt war und Einflüsse auf andere Verfasser und deren Theorie wohl eher die Regel als die Ausnahme waren.
Einen weiteren wesentlichen Kritikpunkt bildete die future-generations debate. Diese bemängelte, dass die Interessen zukünftiger Generationen nicht beachtet würden. So sei zum Beispiel keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage nach einer Eindämmung des Bevölkerungswachstums gegeben. Laut utilitaristischer Ethik ist diese auch nicht möglich, da die Konsequenzen einer Handlung einzig und allein nach "[...] den Wertmassstäben der von ihnen betroffenen Individuen zu beurteilen sind"2. Das ist eine fragwürdige Behauptung; auch wenn sich nicht im Einzelnen voraussagen lässt, was kommende Generationen einmal für Ansichten besitzen werden, so kann man dennoch davon ausgehen, dass einige grundlegende Dinge eben nicht grundlegend anders gesehen werden. Schmerz wird für die meisten immer eine unangenehme Erfahrung sein und die Gefahren einer Überbevölkerung wird die meisten mit zumindest Unbehagen erfüllen. Was die Auswirkungen einer solchen Überbevölkerung angeht, so ist wohl zu befürchten, dass die Maximierung des Gesamtnutzens dann aufgrund sich allgemein verschlechternder Lebensqualität kaum noch in ausreichendem Masse möglich sein wird. Benthams Ansicht, dass stetig wachsende Bevölkerungszahlen doch erfreulich seien, da "[...] es die Möglichkeiten menschlicher 'happiness' vergrößere [...]"3, muss schon zu seiner Zeit schlicht naiv geklungen haben. Mit dem Fortschreiten der Industriellen Revolution hatte man auch sehr schnell Schwierigkeiten, die unangenehmen Folgen zu bekämpfen: Migration, Pauperismus, Nahrungsmittelengpässe. Durch die technischen Neuerungen und medizinischen Fortschritte erfolgte zuerst eine ungeahnte Bevölkerungsexplosion, die jedoch aller Freude über ausreichende Arbeitskräfte zum Trotz, eben jene Errungenschaften in Frage stellte. Der englische Pfarrer und Bevölkerungstheoretiker Thomas Malthus brachte es in seiner Schrift Essay on the Principle of Population auf den Punkt: er entwickelte die Theorie, dass durch medizinischen Progress und Armenunterstützung immer mehr Menschen überleben würden, ohne das für diese - trotz aller Neuerungen - ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung stünden. Also müsse man die Bevölkerungszunahme eindämmen. Doch einmal abgesehen vom Problem der Nahrungsmittelherstellung - Bentham war der unumstößlichen Meinung, dass ein unveränderlicher Urtrieb des Menschen, den zu ändern er für unmöglich gehalten hatte, der Egoismus sei. Dieser musste akzeptiert und durch Gesetze erfasst und so gesteuert werden, dass er letztlich den Gemeinnutzen vermehrte. "Es galt ein System zu schaffen, das die selbstsüchtigen Triebe des Menschen zur Maximierung der "happiness" bei der größten Anzahl führen würde."4 Doch kann man ohne weiteres behaupten, dass dieses Unterfangen umso schwieriger würde, je mehr Egoisten lebten. Hinzu kommt, dass mit wachsender Bevölkerungszahl unweigerlich der Verwaltungsaufwand steigt und eine Kontrolle problematischer wird. Man kann einfach nicht außer acht lassen, dass der Grundstein vieler Probleme künftiger Generationen immer in der Gegenwart gelegt wird und es nach einer Ausrede aussieht, zu sagen, man wüsste doch nicht, was für Wertmassstäbe in der Zukunft angelegt würden.
Einen weiteren, heftig diskutierten Kritikpunkt bildet die utility and rights debate. Die Frage, ob die Bestrafung eines Unschuldigen akzeptierbar sei, wenn sie der Gemeinschaft von Nutzen sein würde, hätte wohl bereits Iphigenie mit einem scharfen "Nein" beantwortet. Bei der Suche nach einer endgültigen Antwort auf dieses Problem, gerät man allerdings sehr schnell auf unsicheren Boden. Es ist nicht ganz klar, ob die Utilitaristen eine solche Praktik wirklich befürworten oder ob es nicht ganz einfach eine ihnen untergeschobene Behauptung ist, weil man meinte, dass sie sich ohne weiteres in die utilitaristische Ethik einfügen würde, da sie doch ohnehin von Anfang an angeblich grundlegenden gesellschafts- und rechtsphilosophischen Überzeugungen gegenüberstand. Trotz der aufgeführten, doch recht schwerwiegenden Kritikpunkte am Utilitarismus, hat dieser es geschafft, sich über die Zeit hinweg aufrecht zu erhalten. Behauptungen wie: "Utilitarianism is destroyed and no part of it left standing"5 konnten nicht verhindern, dass noch Jahrzehnte später gesagt wurde: "The day cannot be too far off in which we hear no more of it"6, ein anscheinend doch vergeblicher Wunsch.
Wie bereits erwähnt, spielt eine wesentliche Rolle hierbei die Bedeutungsverschiebung des Nutzenbegriffes, der die zentrale These - auch Kern genannt - ausmacht. Diese Kernthese, die vereinfacht ausgedrückt aussagt, dass "das größte Glück der größten Zahl"7 zu erreichen das Ziel menschlichen Handelns ist, wird durch eine umfangreiche Menge an Hilfshypothesen und genaueren Aussagen umhüllt, unterstützt und verteidigt. Diese Hülle ist sozusagen der Schutzgürtel, der alle Angriffe auf den Kern abfängt und dabei selber ständiger Veränderung unterworfen ist. Diese Veränderungen sind notwendig, weil im Verlauf der Zeit ständig neue Erkenntnisse hinzugewonnen werden, die die ursprünglichen Ansichten aus einem stets neuen Blickwinkel betrachten. Will sich eine Theorie nicht als statisch und somit früher oder später als nicht mehr zeitgemäß erweisen, so muss sie wiederholt modifiziert werden. Der Utilitarismus hat sich hierin als überaus hartnäckig erwiesen. Offenbar hat sich die Kernthese als etwas erwiesen, dass wert ist, seit über zweihundert Jahren erhalten und verteidigt zu werden.
2. Hedonistisches Gedankengut
Wenn man Jeremy Bentham als Verfechter des hedonistischen Utilitarismus bezeichnet, kann es nur von Nutzen sein, kurz zu umreißen, was Hedonismus bedeutet. Die Bezeichnung Hedonist ist über eine langen Zeitraum durchaus nicht schmeichelhaft gewesen; genaugenommen wurde Hedonismus im gesamten Mittelalter hindurch bis in die neue Zeit verketzert und dabei doch kaum wirklich gekannt. Selbst heute wird Hedonismus teilweise mit Genusssucht gleichgesetzt - Epikur wäre wohl hellauf entsetzt. Gerade er hatte doch ein durchaus musterhaftes Leben in Genügsamkeit und Mäßigkeit geführt. Ein wahrhaft weiser Mensch konnte seiner Meinung nach seine Begierden beherrschen. Die Freundschaft wurde von den Epikureern genauso hochgehalten wie die Ungestörtheit; nach Möglichkeit sollte man sich sogar dem nervenaufreibenden politischen Leben fernhalten.
Ähnlichkeiten zwischen Hedonismus und Utilitarismus sind in der Tatsache zu finden, dass ersterer den Menschen dahingehend definiert, dass er ein nach Glück strebendes Wesen ist, das Schmerz zu vermeiden sucht. Jedoch ist nicht jede Form von Glück erstrebenswert und nicht jeder Schmerz zu vermeiden, v.a. wenn letzterer ein größeres Maß an Glück nach sich ziehen würde. Weiterhin ist die geistige Lust der des Fleisches vorzuziehen. Diesem Aspekt sollte v.a. John Stuart Mill später eine wichtige Rolle zubilligen, während er bei Bentham zugegebener Maßen keine Beachtung fand.
In ihrem Glücksstreben und ihrer Verrufenheit sind sich beide Philosophien erstaunlich gleich; auch wenn dem Hedonismus seit Petrus Gassendi (1592-1655) wieder mehr Gerechtigkeit widerfahren ist, kämpft der Utilitarismus noch mit dem Image, den Egoismus zu rechtfertigen, worauf an anderer Stelle noch etwas genauer eingegangen wird. Vielleicht wird auch er eines Tages weniger negativ betrachtet werden.
3. Jeremy Bentham (1748-1832)
Jeremy Bentham wurde 1748 in London als Sohn eines erfolgreichen Anwalts geboren. Nach einem Studium in London und Oxford übte er selber den Anwaltsberuf nur für kurze Zeit aus. Lieber beschäftigte er sich mit Angelegenheiten der Politik und der Jurisprudenz, bis ihm 1768 zufällig eine Kopie von Joseph Priestleys Essay on Government in die Hände fiel. Dort sollte er zum ersten Mal etwas über die spätere Kernthese des Utilitarismus lesen. Priestley (1733-1804) war Prediger und einer der wichtigsten Verteidiger des theologischen Utilitarismus. Bentham war von der Vorstellung "des größten Glücks der größten Zahl"8 so begeistert, dass ihn diese Idee nie mehr loslassen sollte. Diese Begeisterung sollte in der Tat dazu führen, dass Bentham sich als der wichtigste Verfechter der utilitaristischen Ethik einen Namen machen würde. Mitunter wird er sogar irrtümlicherweise der Begründer der utilitaristischen Kernthese genannt. Auch wenn diese Ehre dem im Vergleich unbekannteren schottischen Philosophen Francis Hutcheson (1694-1746) gebührt, so ist es unzweifelhaft Benthams Verdienst, diese These der breiten Öffentlichkeit in Großbritannien bekannt gemacht zu haben.
Benthams Hauptwerk An Introduction to the Principles of Morals and Legislation aus dem Jahre 1789 legte eine Moralphilosophie offen, welche die Basis für gesellschaftliche Reformen bilden sollte. Er selber war bedeutend als derjenige, der die utilitaristische Ethik systematisierte und veröffentlichte. Er wurde unter anderem als "glücklich, hart arbeitend, mildtätig, phantasielos und unverheiratet mit einer leichten Zuneigung für Musik, Tiere und Freunde"9 beschrieben. Besonders bemerkenswert ist hierbei der vierte Punkt. Des weiteren wurde ihm nachgesagt, dass er jedes Gesetz und jede Institution mit den Worten: "Was ist dein Nutzen?"10 hinterfragte. Seine Theorien wurden von ihm in der Hoffnung entwickelt, das öffentliche Wohl in positiver Weise beeinflussen zu können - also eine Philosophie, die auf ihre Umsetzung zielte. Sicherlich trug dieser kühne Anspruch zu den zahlreichen Kritiken an der utilitaristischen Ethik bei.
Bentham vertrat in seinen utilitaristischen Ansichten eine hedonistisch orientierte Interpretation des Glückbegriffes. Der Mensch ist also ein von seiner Suche nach Vergnügen gesteuertes Wesen, das danach trachtet, Schmerz und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Demnach war die Zweckmäßigkeit jeder Handlungskonsequenz in einer sogenannten "Gefühlsbilanz"11 zu suchen - der Menge an durch eine Handlungskonsequenz hervorgerufenen Vergnügens minus der erzeugten Menge an Schmerz. Bentham wagte sogar den Versuch, das Lust- und Schmerzempfinden zu bestimmen. Dazu stellte er eine Liste von Faktoren auf, mit deren Hilfe man die Nutzwerte einer Handlung abschätzen können sollte. Diese Auflistung umfasst die Dauer und Intensität einer Empfindung, die Gewissheit ihres Eintreffens, ihre zeitliche Nähe, die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Vergnügen weiteres erwächst (Fruchtbarkeit), Ihre Reinheit - also ob sie mit weiteren Empfindungen wie Schmerz vermischt ist - und schließlich die Anzahl der Personen, die von ihr betroffen sind. Um die genannten Faktoren auch richtig bewerten zu können, stellte Bentham zwei Verfahren vor. Das introspektive Verfahren besagt, dass das Individuum die Intensität seiner Empfindungen selber abschätzen soll - durch Selbstbetrachtung eben. Denn schließlich müsste jeder selbst am besten beurteilen können, was er empfindet. Das behavioristische Verfahren geht davon aus, dass aus dem Entscheidungsverhalten einer Person auf die Empfindungsbilanz rückgeschlossen werden kann. Dabei muss man jedoch wissen, dass für Bentham das Maß der Empfindung gleich der Motivationskraft ist. Das Beispiel, das er zur Verdeutlichung angibt, ist nicht unproblematisch. So sagt er, dass ein Individuum deutlich macht, wie viel Lustgewinn es sich von einer Sache verspricht, indem es dafür einen bestimmten Geldbetrag auszugeben bereit ist. Je höher dieser Betrag ist, umso mehr verspricht es sich davon. Das Problem hierbei ist folgendes: es können durchaus zwei sozial völlig unterschiedlich gestellte Individuen bereit sein, für ein und dieselben Sache gleich viel Geld auszugeben. Der Bessergestellte kann dies jedoch ohne weiteres Überlegen, aus einer Laune z. B., tun; der andere musste allerdings eine ganze Zeit lang sparen, um sich diese Sache leisten zu können. Beide sind bereit, gleich viel auszugeben; man wird aber kaum Zweifel daran haben, wer sich in diesem Falle mehr darüber freut. Dies ist durchaus nicht die einzige Schwierigkeit, welche die Verfahren aufweisen. So wurde bei ersterem u.a. kritisiert, dass man doch erst einmal wissen müsste, wie die Faktoren zur Bestimmung der Nutzwerte eigentlich selber bestimmt werden.
Ein Standpunkt Benthams, der für sehr viel mehr Aufregung sorgte, ist unter dem Schlagwort "Anomalie der utilitaristischen Ethik"12 bekannt. Bentham geht in seinen Betrachtungen davon aus, dass allein quantitativ fassbare Aspekte einer Empfindung von Relevanz sind. Lustmaximierung durch jedwede Tätigkeit, möchte man sagen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Tätigkeit ausgeübt wird. Das führt dazu, dass vollkommen unterschiedliche Handlungen miteinander verglichen werden können , um festzustellen, welche mehr Vergnügen bereitet und somit die nützlichere ist. Vor allem die Anhänger der Common-Sense-Theorie reagierten mit empörter Ablehnung auf diesen Versuch des Vergleiches. Der engagierte britische Schriftsteller Thomas Carlyle gab dem Utilitarismus die wenig schmeichelnde Bezeichnung "pig philosophy"13 und kritisierte unermüdlich den "auf Eigennutz gerichteten Utilitarismus"14 des Viktorianischen Zeitalters. Es scheint tatsächlich in einigen Punkten so zu sein, dass der vielgescholtenen Utilitarismus die ungünstige Eigenschaft des Egoismus unterstützt. Schließlich richtete sich doch alles auf die Befriedigung des eigenen Vergnügens. Doch Bentham hatte hierfür eine einfache Lösung zu bieten: er ging zwar davon aus, dass das Individuum egoistisch sei, aber auch vernunftbegabt und durch kluge Gesetzgebung angeleitet. Und ein vernunftbegabtes Wesen erkennt, dass gute Taten einem anderen gegenüber nicht selten gute Taten für einen selbst bedeuten: "Menschen, die in einer Gesellschaft leben, brauchen die Unterstützung anderer, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen [...]."15 Ein Zusammenleben zum gegenseitigen Nutzen sozusagen. Außerdem ist Bentham durchaus willig, den Individuen ein gewisses Maß an Altruismus zuzugestehen, der sich darin ausdrückt, dass sie Vergnügen dabei empfinden, anderen zu helfen.
Trotz dieser positiven Aspekte ließ es sich nicht vermeiden, dass die Angriffe auf den Utilitarismus sehr rasch so schwerwiegend und hartnäckig wurden, dass einigen der kommenden Verfechter dieser Ethik sich dazu aufgefordert fühlten, die von Bentham dargelegten Ansichten zu überdenken und, wo nötig, so neu zu formulieren, dass sie den Kritiken am wirksamsten begegnen konnten. Benthams Werk sollte sich als einflussreicher erweisen, als man anfänglich hätte annehmen können; es sollte die kommenden Generationen von Philosophen in nicht geringem Ausmaß beschäftigen und die Gemüter in eifrigen Diskussionen für oder wider diese Theorie erhitzen.
4. John Stuart Mill (1806-73)
Der Sohn des engsten Freundes Jeremy Benthams wurde 1806 in London geboren. Von seinem Vater wurde er zu einer "Benthamschen Denkmaschine"16 ausgebildet. Den Unterricht seines Sohnes übernahm James Mill selber, um wohlmöglich schädigender Einflüsse eines Schul- und Universitätsbesuches zuvorzukommen. Im Alter von drei Jahren begann John Stuart Mill unter der strengen Aufsicht seines Vaters bereits Griechisch und Arithmetik zu lernen, fünf Jahre später kamen Latein, Algebra und Geometrie hinzu und mit zwölf Jahren begann er Logik und Psychologie zu lernen. Als krönenden Abschluss seiner Studien las Mill Benthams An Introduction to the Principles and Morals of Legislation. Solcherart gedrillt, verfasste er bereits im zarten Alter von achtzehn Jahren bedeutende Aufsätze und machte sich schnell als Verteidiger der utilitaristischen Ethik einen Namen. Der Glaube an die Richtigkeit der Ethik hielt bis zu seiner persönlichen Krise 1826 an. Während dieser verlor er die Überzeugung von der "pursuit of happiness".17 Zweifellos versuchte Mill sich in dieser Zeit darüber klar zu werden, ob wirklich er selbst dem Utilitarismus anhing oder seine Überzeugung lediglich von einem überaus dominanten Vater aufgezwungen worden war. Die Lektüre von romantischen Gedichten half ihm, bis dahin unterdrückte Gefühle als Bestandteile seines Lebens und Werkes zu verstehen. Es gelang ihm, den anerzogenen väterlichen Dogmatismus zu modifizieren und eine objektivere Stellung zum Utilitarismus einzunehmen. Sein Werk Utilitarianism - erst 1865 erschienen - sollte dem Rechnung tragen.
In seinem utilitaristischen Essay unternimmt John Stuart Mill den Versuch einer Vermeidung der utilitaristischen Anomalie, während er weiterhin damit übereinstimmt, dass das Hauptziel des Menschen die Suche nach Glück sei [...] dass Lust und das Freisein von Unlust die einzigen Dinge sind, die als Endzweck wünschenswert sind [...].“18 Mill zielt daraufhin ab, die Kernthese des Utilitarismus als zutreffend zu verteidigen, indem er zu einer Modifizierung der Hülle ansetzt. Die entscheidende Veränderung, die Mill gegenüber Bentham einnimmt, ist, dass er eine Unterscheidung zwischen moralisch minderwertigen und wertvollen Arten von Vergnügen macht, womit er im Grunde ein Stückchen mehr Hedonist ist als Bentham. Diese Unterscheidung ist seiner Überzeugung nach dem utilitaristischen Prinzip dabei nicht nur nicht entgegengesetzt, sondern er sagt sogar: "dass der Wert einer Freude ausschließlich von der Quantität abhängen sollte, wo doch in der Wertbestimmung aller anderen Dinge neben der Quantität auch die Qualität Berücksichtigung findet."19 Er empfindet die Qualität als nunmehr essentiellen Bestandteil. Die Menge von erreichbarem Glück ist also sowohl von Quantität als auch von Qualität gleich stark abhängig. Mill geht davon aus, dass mit zunehmendem Grad der Bildung die Individuen ein Einsehen dahingehend haben, dass es mitunter besser ist, auf ein minderwertigeres Vergnügen zugunsten eines zwar quantitativ geringeren aber moralisch wertvolleren Vergnügens zu verzichten. Diese Freiwilligkeit erklärt er mit den Worten:
"Ein höher begabtes Wesen verlangt mehr zu seinem Glück, ist wohl auch größeren Leidens fähig und ihm sicherlich in höherem Masse ausgesetzt als ein niedrigeres Wesen; aber trotz dieser Gefährdung wird es niemals in jene Daseinsweise absinken wollen, die es als niedriger empfindet."20
Dieses Bewusstsein nennt Mill auch "Würde".21 Auch wenn die oben aufgestellte Behauptung durchaus nachvollziehbar ist und von den meisten Menschen vielleicht sogar für selbstverständlich gehalten wird, so ist doch zweifelhaft, ob die Individuen wirklich jemals diesen Ansprüchen gerecht geworden sind. Es ist weiterhin fragwürdig, ob auf den gesellschaftlichen Anlässen, die zu Mills Zeiten gegeben worden sind, Weltpolitik, Philosophie, Literatur oder ähnlich wichtige und interessante Dinge beredet wurden. Es war wohl doch eher der neueste Klatsch der feinen Gesellschaft - oberflächlich und nicht selten boshaft. Eine Erziehung in Eton oder Oxford garantierte nicht für eine wirklich tiefe Bildung des Geistes. Auch wenn die Damen und Herren nicht mit Cockney-Akzent sprachen und durchaus über zierliche Manieren und allerlei Fertigkeiten verfügten, so vergeudeten viele doch ihre Zeit mit Müßiggang und gaben sich Jagd, Wein und dem Schmieden von Intrigen hin. Sofern Mill nicht völlig weltfremd gewesen ist, wird ihm dieser unschöne Charakterzug seiner Mitmenschen nicht entgangen sein können. Wie viel Wahrheit im zweiten Kapitel seines Utilitarianism auch sein mag, menschlicher Schwäche trägt es keine Rechnung.
Auch wenn Mill mit der oben beschriebenen Modifikation des Nutzenbegriffes der Anomalie vorbeugen kann, so tritt dennoch das auch bei Bentham bestehende Inkommensurabilitätsproblem auf. Es besteht die Frage, wie man Quantität und Qualität unterschiedlicher Empfindungen von Schmerz und Vergnügen abschätzen kann und wie man beide Aspekte in die Nutzenbilanz einer Handlung einfügen kann. Der Versuch einer Lösung des Problems bleibt ein Versuch. Mill stellt ebenfalls einen Maßstab für den Nutzwert einer Handlung auf. So soll das Entscheidungsverhalten besonders urteilsfähiger Testpersonen in passend geschaffenen Situationen aufgelistet werden. Diese Testpersonen müssen über einen bestimmten Intellekt sowie idealerweise über ein möglichst hohes Maß an Erfahrung verfügen. Was allerdings die geeigneten Situationen anbelangt, so fragt man sich, ob eine Person in einer künstlich geschaffenen Situation wirklich genauso reagiert, wie sie es auch sonst tun würde, oder ob nicht doch die Gefahr besteht, dass das Wissen um das Getestetwerden, eher dazu führt, dass sie auch nur künstlich reagiert. Was also das Inkommensurabilitätsproblem angeht, so kann Mill trotz seines Versuches keine zufriedenstellende Lösung bieten.
Jedoch war er nicht der erste und letzte, der sich mit der Uminterpretierung des Nutzenbegriffes beschäftigt hat; seinen Spuren sollte Henry Sidgwick folgen, der freilich seinen Gedankengang weiterverfolgte als auch einer Kritik unterzog.
5. Henry Sidgwick (1838-1900)
Henry Sidgwick wurde 1838 in Skipton, Yorkshire geboren. Er genoss eine hervorragende Ausbildung in Rugby und später Cambridge, wo er auch mit John Stuart Mills Utilitarianism erstmals in Kontakt kam. Besonders interessierte ihn Mills rationale und wissenschaftliche Art, ethische Dinge zu betrachten. Inspiriert durch den Utilitarismus, erschien 1847 sein Hauptwerk Methods of Ethics. In ihm untersucht er den ethischen Intuitionismus, den Utilitarismus und den Egoismus, wobei man wissen sollte, dass er den zweiten für "die beste und fortschrittlichste Ethik" hält und ihn mit dem Intuitionismus vereinbar hält. Dennoch hielt er eine erweiterte Neuinterpretation trotz Mills vorangegangener für notwendig. Interessanterweise wird dieses Werk sowohl als "beste Abhandlung über Moralphilosophie, die je geschrieben wurde" 22 bezeichnet, als auch als langweilig und "unverdaulich".23 Im Gegensatz zu Bentham glaubt Sidgwick nicht, dass die Stärke einer Empfindung mit der Motivationskraft übereinstimmt. So gibt er zu bedenken, dass vergleichsweise schwache Empfindungen zu Handlungskonsequenzen führen können, während es bei stärkeren Empfindungen durchaus nicht zu solchen kommen muss. Was er allerdings zugibt ist, dass allein die Vermutung, eine Erfahrung sei angenehm, sie für ein Individuum äußerst erstrebenswert machen kann. Jegliche weitere Verbindung zwischen Empfindungsmaß und Motivationskraft verneint er jedoch. Das Ergebnis dessen ist, dass die Motivationskraft von Lust- oder Schmerzempfindungen bestimmbar ist, dagegen ist der Rückschluss auf das Maß der Empfindung unmöglich. Das von Bentham vorgestellte behavioristische Verfahren zur Nutzenbestimmung kann Sidgwick also nicht mehr anwenden, zumal er sich noch auf die hedonistischen Interpretation des Nutzenbegriffes stützt.
Nach Sidgwicks Annahme muss die Quantität von Schmerz- und Lustempfinden genau abgeschätzt und sowohl zwischen verschiedenen Individuen, als auch innerpersonell verglichen werden können, um dem hedonistischen Kalkül Rechnung zu tragen. Die Vorraussetzung für dieses Verfahren besteht darin, dass die Empfindung von Lust und Schmerz kommensurabel ist und das ein Zustand der absoluten Balance zwischen beiden bestehen kann – auch “hedonistischer Nullpunkt“24 genannt. Sidgwick unterzieht das übriggebliebene introspektive Verfahren einer gründlichen Analyse, was zu einer viel vorsichtigeren Bewertung desselben führt. So kam er nicht umhin, einige gewichtige Schwachstellen des Verfahrens aufzulisten. Was dabei am offensichtlichsten erscheint, ist die Tatsache, dass die durch das hedonistische Kalkül geforderte interpersonelle Summation von Empfindungsbilanzen schwer möglich ist. Schließlich sind die Empfindungen anderer für Außenstehende nicht wirklich abzuschätzen. So mag sich zum Beispiel Freude bei dem einen in lautstarkem Jubel äußern, bei einem andersgearteten Menschen jedoch nur in zufriedenem Lächeln; beide werden sich immer sich ihren Wesensarten angemessen freuen. Wie soll man dies aber messen, wenn man die Wesensart des Individuums nicht kennt? Von den Fähigkeiten der Verstellung einmal ganz abgesehen. Laut Sidgwick es ist sogar schon ein echtes Problem, einzeln auftretende eigene Empfindungen richtig einzuschätzen. Um bei dem Beispiel der Freude zu bleiben: was sollte man auch auf die Frage, wie sehr man sich freut, antworten? Sehr, mittel, ein wenig? Wie sehr ist mittel? Die Frage nach Schmerz ist nicht weniger schwierig. Ein kleines Kind, das hinfällt oder sich stößt, fängt mit guter Wahrscheinlichkeit an zu weinen; ein Erwachsener wird sich den Schmerz vielleicht verbeißen oder nur einen kurzen Laut von sich geben. Aber empfindet das Kind wirklich mehr Schmerzen oder hat es sich nicht eher erschreckt? Da schon diese scheinbar einfache Aufgabe nicht recht lösbar ist, kann man sich vorstellen, dass der Vergleich mehrerer Empfindungen nicht einfacher wird. Mehrere gleichzeitig auftretende Empfindungen können sich überlagern, so dass man kaum weiß, welche momentan die stärkere ist. Möchte man aus bestimmte Gründen eine momentane mit einer nicht-aktualen Empfindung vergleichen, kommt noch erschwerend hinzu, dass man letztere so genau wie möglich rekonstruieren muss, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ungenauigkeiten führt, v.a. wenn der Zeitraum zwischen beiden größer ist. Als letzten Schwachpunkt führt Sidgwick noch das "Paradox des egoistischen Hedonismus"25 an, das sich darin ausdrückt, dass das ständige, bewusste Streben nach dem größtmöglichen Glück in Unzufriedenheit endet oder doch zumindest die Lustempfindung abschwächt. Das klingt zwar recht einleuchtend, wenn dies Sache von dem Standpunkt betrachtet, dass man sich bei oder nach Erreichen einer Lustempfindung fragt, ob diese denn auch wirklich die ultimative gewesen ist, oder ob noch etwas Besseres kommt. "Wenn irgendwo, dann gilt hier, dass das Bessere der Feind des Guten ist"26, wie noch in den 90igern festgestellt wird. Aber Sidgwick gibt selber die Antwort, dass der rationale Egoist klug genug ist, dieses Dilemma zu vermeiden und seine Motive und Leidenschaften unter Kontrolle zu halten. Also auch ein Schritt mehr Richtung des ideal-vernünftigen Menschen.
Das Resümee, das Sidgwick aus seiner Analyse zieht, räumt dem introspektiven Verfahren im Gegensatz zu Bentham lediglich "ein bestimmtes Maß an praktischer Anleitung"27 ein, was in Anbetracht der aufgezählten Unsicherheiten auch realistischer ist. Ein weiteres Ergebnis seiner Untersuchung besteht darin, dass Sidgwick ungewollt eine Strategie offen legt, die den Begriff des Nutzens an den der Motivationskraft auf Kosten des Empfindungsmaßes angliedert. Letzteres kann damit aufgrund der oben erwähnten Schwierigkeiten etwas vernachlässigt werden, zumal die Bestimmung der Motivationskraft, trotz einiger zum Teil bereits besprochener Tücken, vergleichsweise einfacher gesehen wird.
Schlussbetrachtungen
Die Uminterpretierung des Nutzenbegriffes während des klassischen Utilitarismus war, wie bereits erwähnt, sowohl Notwendigkeit als auch Wunsch. Jeremy Bentham gab als erster eine umfassende Theorie über den Utilitarismus, der prompt die Gemüter erhitzte. John Stuart Mill trat zwar als Verfechter der utilitaristischen Ethik in Benthams Fußstapfen, empfand diese jedoch als in einigen Punkten verbesserungswürdig, eine Meinung, die Henry Sidgwick teilte. Er suchte dabei natürlich nicht nur Benthams Ansichten zu analysieren sondern auch Mills. Erstaunlich genug, dass er Mills Errungenschaft der qualitativen Unterscheidung zwischen Abstufungen von Schmerz und Glück seinerseits wiederum für kritikwürdig hielt. Es wird einmal mehr deutlich, dass die Neuinterpretierung keineswegs einheitlich verlaufen ist; vielmehr suchte jeder Autor seinen eigenen Weg, der sich nicht unbedingt an denen der anderen orientierte bzw. den der anderen nur als Anregung sah. Es ist jedoch beeindruckend zu sehen, wie hartnäckig dieses Ziel verfolgt wurde. Nicht minder beeindruckend ist, dass die Debatte um die utilitaristische Ethik bis heute nicht erloschen ist. Die Diskussion wurde im Verlauf der Zeit im Gegenteil um so viele Gesichtspunkte erweitert, dass es gar nicht einfach ist, sich einen Überblick zu verschaffen. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Fakt zur Umstrittenheit beigetragen hat. Interessant wäre zweifellos auch die Beantwortung der Frage, ob die Schöpfer des Utilitarismus nicht sehr erstaunt über diese Auswirkungen wären. Den Wandel des Nutzenbegriffes im klassischen Utilitarismus kann man als unumgänglich bezeichnen; ob alle Neuinterpretationen und Kritiken der folgenden Jahrzehnte genauso nützlich waren, bleibt der persönlichen Auffassung vorbehalten. Allerdings sollte man wohl ab einem gewissen Punkt einfach zur Kenntnis nehmen, dass eine Ethik niemals auf alle Fragen eine zufriedenstellende Antwort geben kann. Es wird immer eine Grenze erreicht werden. Schließlich: "Wenn gut immer nur das unter dem Gesichtspunkt der Folgen Bestmögliche ist, kommen wir vor lauter Überlegen nicht mehr zum Handeln".28
Literaturverzeichnis
- Fabian, Bernhard: Die englische Literatur, Deutscher Taschenbuchverlag, 1997
- Gähde, Ulrich und Schrader, Wolfgang: Der klassische Utilitarismus – Einflüsse –Entwicklungen – Folgen, Akademie Verlag, 1992
- Glover, Jonathan: Utilitarismus and its Critics, New College, Oxford University Press, 1990
- Häyry, Matti: Liberal Utilitarianism and Applied Ethics, Routlege, London and New York, 1994
- Hügli, Anton und Lübcke Poul: Philosophielexikon, rowohlts enzyklopädie, 1998
- Mill, John Stuart: Utilitarismus, Reclam 1997
- Quinton, Anthony: Utilitarianistic Ethics, Open Court, La salle, Illinois, 1989
- Scarre, Geoffrey: Utilitarianism, Routledge, London and New York, 1996
- Smart, J.J.C. und Williams, Bernard: Utilitarianism for and against, Cambridge University Press, 1993
- Spaemann, Robert: Die schlechte Lehre vom guten Zweck, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. Oktober 1999
- Störig, Hans Joachim: Kleine Weltgeschichte der Philosphie, Fischer Taschenbuch Verlag, 1999
Quellenverzeichnis
[...]
1. Gähde, Ulrich und Schrader, Wolfgang: Der klassische Utilitarismus – Einflüsse – Entwicklungen – Folgen, akademie Verlag, 1992, Seite 16
2. Ebenda Seite 84
3. Ebd. Seite 22
4. Ebd.Seite 20
5. Scarre, Geoffrey: Utilitarianism, Routledge, London and New York, 1996, Seite 2
6. Ebd. Seite2
7. Ebd. Seite 53
8. Ebd. Seite 72
9. Ebd.
10. Ebd.
11. Der klassische Utilitarismus, Seite 92
12. Ebd. Seite 97
13. Ebd. Seite 97-98
14. Fabian, Bernhard: Die englische Literatur, Deutscher Taschenbuchverlag, 1997, Seite 77
15. Scarre: Utilitarianism, Seite 77
16. Mill, John Stuart: Utilitarismus, Reclam 1997, Seite 118
17. Ebd.
18. Ebd. Seite 13
19. Ebd. Seite 15
20. Ebd. Seite 17
21. Ebd.
22. Der klassische Utilitarismus, Seite 111
23. Ebd.
24. Ebd. Seite 106
25. Ebd. Seite 121
26. Spaemann, Robert: „ Die schlechte Lehre vom guten Zweck“, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. Oktober 1999
27. Der klassische Utilitarismus, Seite 107
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes über Utilitarismus?
Der Text behandelt den Utilitarismus, eine ethische Theorie, die Handlungen danach beurteilt, ob sie das größte Glück für die größte Zahl hervorbringen. Er untersucht die Hauptkritikpunkte am Utilitarismus und die Weiterentwicklungen der Theorie durch verschiedene Philosophen.
Welche Kritikpunkte am Utilitarismus werden im Text erwähnt?
Der Text nennt mehrere Kritikpunkte, darunter: das Fehlen von Vorschlägen zur distributiven Gerechtigkeit, die Nichtbeachtung der Interessen zukünftiger Generationen (future-generations debate), und die Frage, ob die Bestrafung eines Unschuldigen akzeptabel sei, wenn sie der Gemeinschaft nützt (utility and rights debate).
Wer sind die Hauptvertreter des Utilitarismus, die im Text diskutiert werden?
Die Hauptvertreter des Utilitarismus, die im Text diskutiert werden, sind Jeremy Bentham, John Stuart Mill und Henry Sidgwick. Der Text beleuchtet ihre unterschiedlichen Ansichten und Beiträge zur Weiterentwicklung des Utilitarismus.
Was ist Hedonismus und welche Rolle spielt er im Utilitarismus?
Hedonismus ist die philosophische Lehre, dass Glück oder Vergnügen das höchste Gut ist und das Ziel menschlichen Handelns sein sollte. Der Text erklärt, dass Bentham einen hedonistisch orientierten Utilitarismus vertrat, bei dem die Maximierung von Lust und die Vermeidung von Schmerz im Vordergrund stehen. Mill modifizierte dies, indem er zwischen qualitativ unterschiedlichen Arten von Vergnügen unterschied.
Was ist die utilitaristische Anomalie und wie versuchte John Stuart Mill, sie zu vermeiden?
Die utilitaristische Anomalie bezieht sich auf die Vorstellung, dass der Utilitarismus die Maximierung von Lust durch jedwede Tätigkeit befürwortet, ohne auf die Qualität oder den moralischen Wert der Tätigkeit zu achten. John Stuart Mill versuchte, diese Anomalie zu vermeiden, indem er eine Unterscheidung zwischen moralisch minderwertigen und wertvollen Arten von Vergnügen einführte.
Was ist das Inkommensurabilitätsproblem im Utilitarismus?
Das Inkommensurabilitätsproblem bezieht sich auf die Schwierigkeit, Quantität und Qualität unterschiedlicher Empfindungen von Schmerz und Vergnügen zu messen und in eine Nutzenbilanz einzubeziehen. Der Text erklärt, dass weder Bentham noch Mill eine zufriedenstellende Lösung für dieses Problem bieten konnten.
Was sind Henry Sidgwicks Kritikpunkte an Bentham und Mill?
Sidgwick kritisiert Bentham dafür, dass er die Stärke einer Empfindung mit der Motivationskraft gleichsetzt. Er argumentiert, dass schwache Empfindungen zu Handlungen führen können, während stärkere Empfindungen dies nicht unbedingt tun. Außerdem kritisiert er, dass eine interpersonelle Summation von Empfindungsbilanzen schwierig ist. Er kritisiert Mill dafür dass er dessen Errungenschaft der qualitativen Unterscheidung zwischen Abstufungen von Schmerz und Glück für kritikwürdig hielt.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text bezüglich der Uminterpretierung des Nutzenbegriffs im klassischen Utilitarismus?
Der Text schließt, dass die Uminterpretierung des Nutzenbegriffs notwendig war, um den Kritikpunkten am Utilitarismus zu begegnen. Jeder Autor (Bentham, Mill, Sidgwick) suchte seinen eigenen Weg, der sich nicht unbedingt an denen der anderen orientierte bzw. den der anderen nur als Anregung sah. Dennoch wird festgehalten, dass eine Ethik niemals auf alle Fragen eine zufriedenstellende Antwort geben kann.
- Quote paper
- Marie Massloff (Author), 1999, Der klassische Utilitarismus und sein Nutzenbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108581