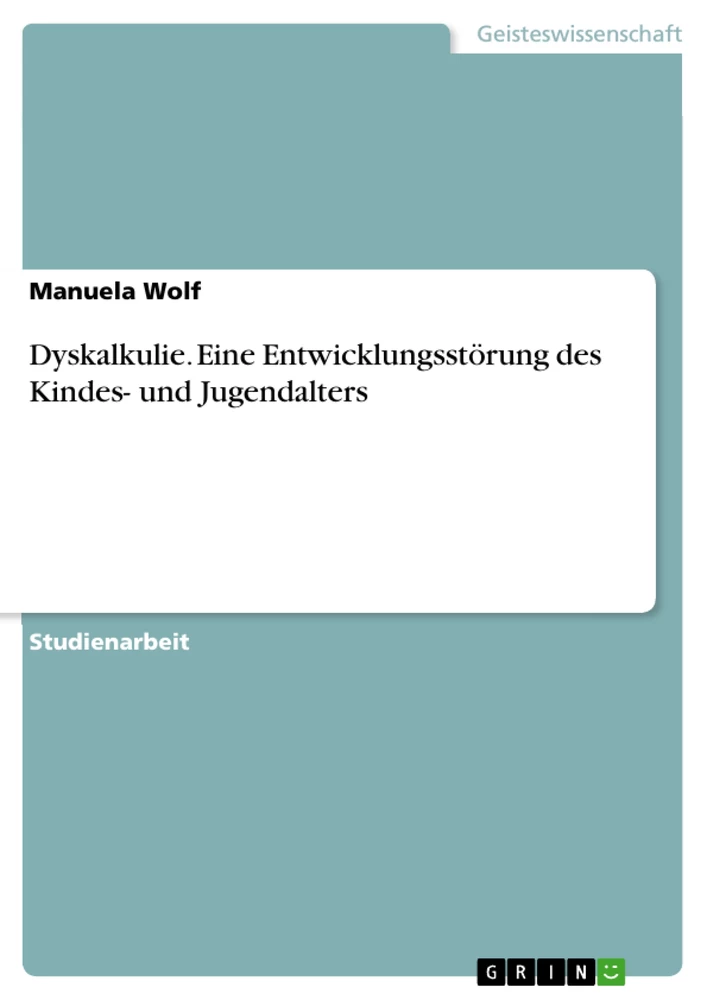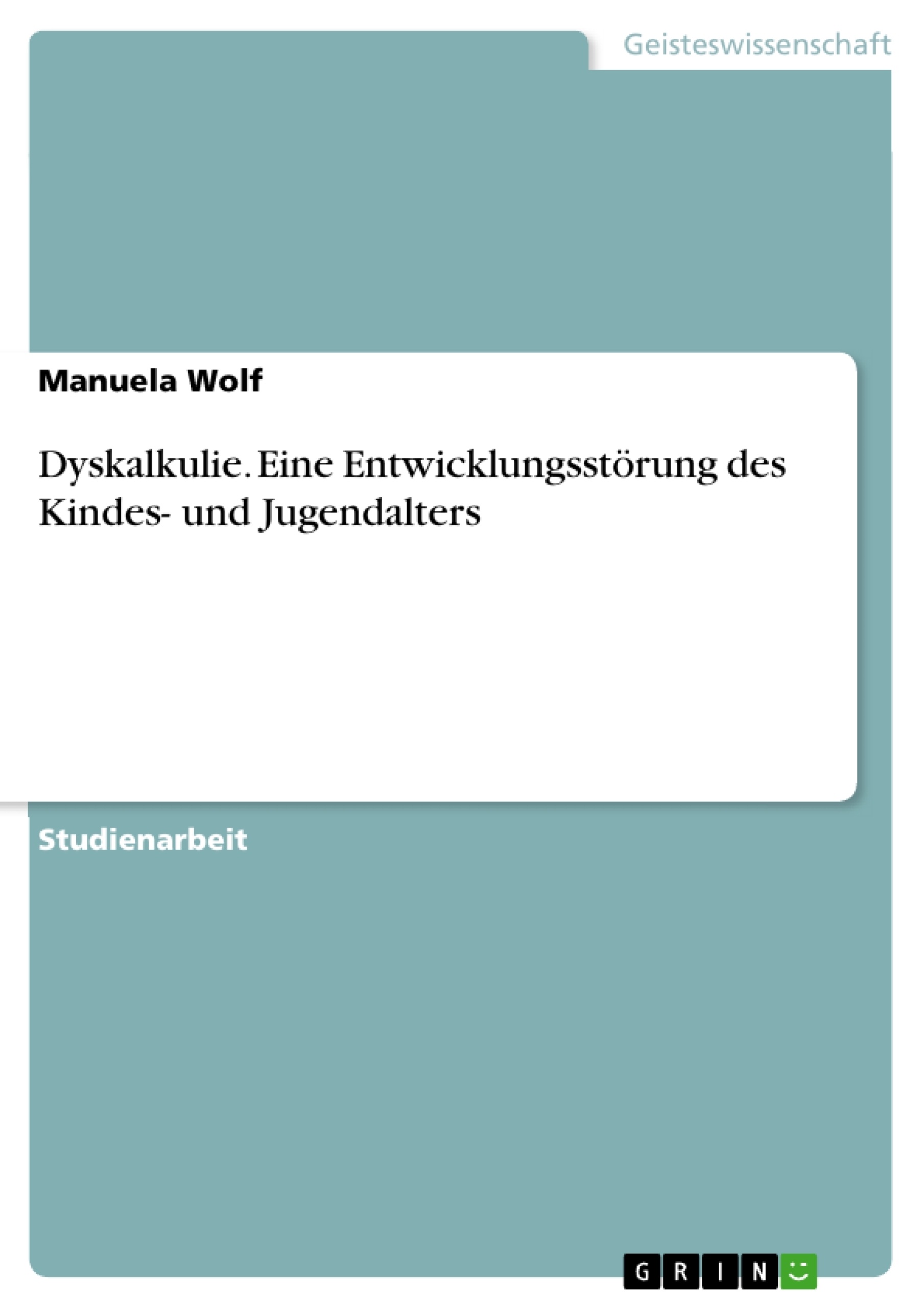‚Dyskalkulie’, ‚Rechenschwäche’, ‚Rechenstörung’, ‚Zählschwäche’ – die Anzahl der Begrifflichkeiten, die in der Literatur zu diesem Thema auftauchen, sind beinahe ebenso vielfältig wie die Erscheinungsformen dieser Störung des Kindes- und Jugendalters. Eines ist jedoch allen gemeinsam und sollte bei aller Wissenschaftlichkeit nie aus dem Blickfeld geraten: manche Kinder haben von Beginn an ganz besondere Probleme beim Erlernen grundlegender mathematischer Operationen, die nicht ad hoc erklärbar sind.
Da solche Probleme zunächst meist auf den Mathematikunterricht begrenzt bleiben und die Kinder nicht sofort versetzungsgefährdet sind, wird leider immer noch viel zu oft abgewartet und die Kinder mit übermäßigem monotonen Üben zusätzlich belastet. Wie ich später noch aufzeigen werde, kann aber genau diese Praxis das Problem noch verschärfen. Rechtfertigungen von Seiten der Eltern wie auch der Lehrer, wie ‚der Knoten platzt schon noch’, ‚die Begabung fehlt’ oder ‚er/sie ist eben einfach zu langsam’ zeigen, dass das Problem der Rechenstörung in der Praxis kaum Eingang gefunden hat, „versagt ein Kind hier (im Rechenunterricht; Anm. d. Verf.), verbinden Lehrerinnen aufgrund der vermeintlichen Logik der Inhalte dies häufig zu Unrecht mit Intelligenzmangel“ . Auch in der wissenschaftlichen Forschung sind die Veröffentlichungen zu diesem Thema eher spärlich, im Gegensatz zur Lese-Rechtschreib-Schwäche beispielsweise. Dies ist umso erstaunlicher, als „der Rechenunterricht [wird] neben dem Lese-Schreib-Unterricht als das schullaufbahnentscheidende Fach in der Grundschule angesehen“ wird.
Im Rahmen dieser Arbeit konzentriere ich mich vor allem auf die Standardwerke von Grissemann/Weber, Lobeck und Röhrig, wobei letztgenannter eher eine konträre Meinung zu den anderen Autoren vertritt. Meine Hauptargumentation bezieht sich deshalb auf Grissemann/Weber und Lobeck, während ich an geeigneter Stelle jeweils die Kritik Röhrigs anbringen werde. Bei der Verwendung der Begriffe schließe ich mich ebenfalls Grissemann/Weber an und werde ‚Dyskalkulie’, ‚Rechenstörung’ und ‚Rechenschwäche’ synonym verwenden, wohingegen andere Begriffe separat erklärt bzw. definiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen zur Dyskalkulie und deren kritische Betrachtungen
- Definitionen
- Kritische Auseinandersetzungen mit wissenschaftlichen Theorien zur Dyskalkulie
- Einordnung der Dyskalkulie und allgemeine Charakteristika umschriebener Entwicklungsstörungen
- Symptomatik
- Rechenfehler im Zusammenhang mit dem Sprach- und Symbolverständnis
- Rechenfehler im Zusammenhang mit Störungen im quantitativen Denken
- Rechenfehler im Zusammenhang mit dem Verständnis von Operationen
- Übersicht zu den genannten Symptomen
- Verhalten im Unterricht
- Bedingungen, die zur Entstehung einer Rechenschwäche beitragen können
- Kritische Auseinandersetzung mit der Ursachenforschung
- Diagnostik
- Zusammenhang von Dyskalkulie mit anderen Störungen des Kindes- und Jugendalters
- Intervention
- Schulische Intervention
- Therapeutischer Therapieansatz
- Zusammenfassung und abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Dyskalkulie, einer Entwicklungsstörung des Kindes- und Jugendalters, die sich durch erhebliche Schwierigkeiten beim Erlernen mathematischer Fähigkeiten auszeichnet. Ziel ist es, die Problematik der Dyskalkulie anhand wissenschaftlicher Theorien zu beleuchten und die Besonderheiten dieser Störung in den Kontext anderer Entwicklungsstörungen einzuordnen. Die Arbeit soll zudem Hilfestellungen für die Diagnose und Intervention von Dyskalkulie im schulischen und therapeutischen Kontext geben.
- Definition und Abgrenzung der Dyskalkulie
- Symptome und Ursachen der Dyskalkulie
- Zusammenhang der Dyskalkulie mit anderen Entwicklungsstörungen
- Diagnostische Ansätze und Interventionen bei Dyskalkulie
- Bedeutung der frühen Erkennung und Förderung von Kindern mit Dyskalkulie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema Dyskalkulie einführt und die Problematik anhand eines Praxisbeispiels verdeutlicht. Kapitel 2 befasst sich mit verschiedenen Definitionen der Dyskalkulie und einer kritischen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien zur Entstehung dieser Störung. Kapitel 3 ordnet die Dyskalkulie in den Kontext allgemeiner Entwicklungsstörungen ein. Kapitel 4 beschreibt die Symptomatik der Dyskalkulie, wobei verschiedene Arten von Rechenfehlern im Zusammenhang mit Sprach-, Symbol- und Operationsverständnis beleuchtet werden. Kapitel 5 untersucht Bedingungen, die zur Entwicklung einer Rechenschwäche beitragen können und setzt sich kritisch mit der Ursachenforschung auseinander. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und abschließenden Betrachtung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Dyskalkulie, Rechenstörung, Rechenschwäche, Entwicklungsstörung, mathematische Fähigkeiten, Diagnose, Intervention, Förderung, Schulische und therapeutische Ansätze, Symptome, Ursachen und Zusammenhänge mit anderen Störungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Dyskalkulie?
Dyskalkulie (auch Rechenstörung genannt) ist eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der Kinder gravierende Schwierigkeiten beim Erlernen grundlegender mathematischer Operationen haben, die nicht durch mangelnde Intelligenz erklärbar sind.
Woran erkennt man eine Rechenschwäche im Unterricht?
Typische Anzeichen sind das Verharren beim zählenden Rechnen, Probleme beim Verständnis des Stellenwertsystems, Verwechslungen von Rechenzeichen und Schwierigkeiten beim quantitativen Denken.
Ist Dyskalkulie ein Zeichen von mangelnder Intelligenz?
Nein, eine Rechenstörung tritt unabhängig vom allgemeinen Intelligenzniveau auf. Oft sind betroffene Kinder in anderen Schulfächern sehr leistungsstark.
Wie wird Dyskalkulie diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt meist durch standardisierte Rechentests, Intelligenztests und eine genaue Analyse der Fehlerstrategien durch spezialisierte Therapeuten oder Psychologen.
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es?
Neben schulischer Förderung ist oft eine außerschulische Lerntherapie notwendig, die an den individuellen Verständnisproblemen des Kindes ansetzt und mathematische Konzepte neu aufbaut.
Welche Folgen hat eine unerkannte Dyskalkulie?
Betroffene Kinder leiden oft unter massiver Prüfungsangst, mangelndem Selbstwertgefühl und können psychische Folgestörungen entwickeln, wenn ihr Problem fälschlicherweise als Faulheit oder Dummheit interpretiert wird.
- Arbeit zitieren
- Manuela Wolf (Autor:in), 2002, Dyskalkulie. Eine Entwicklungsstörung des Kindes- und Jugendalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10767