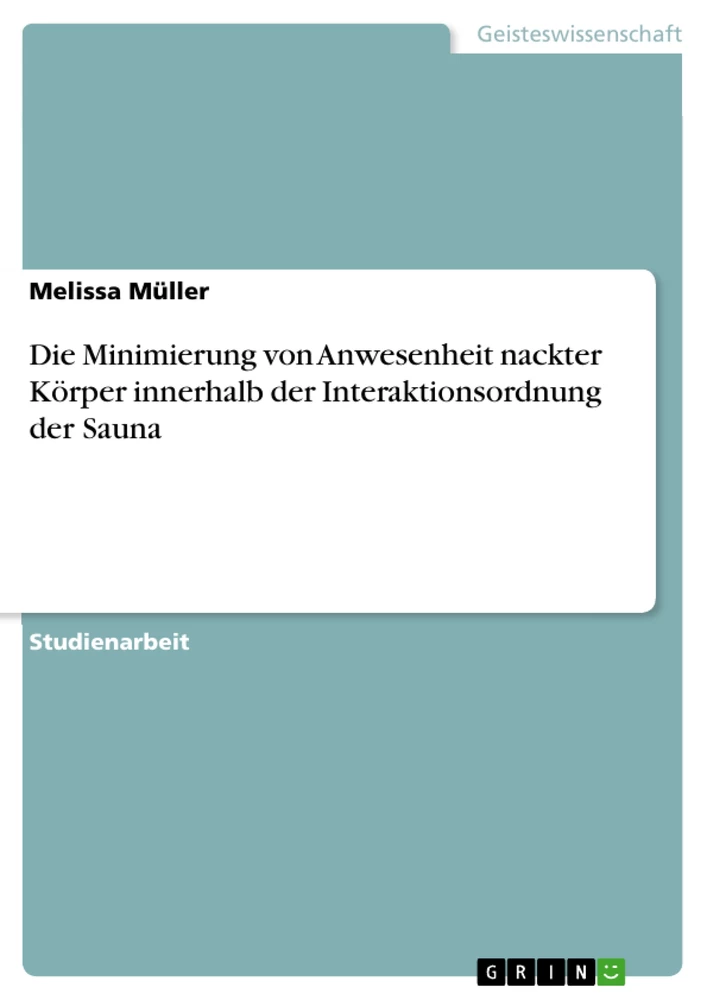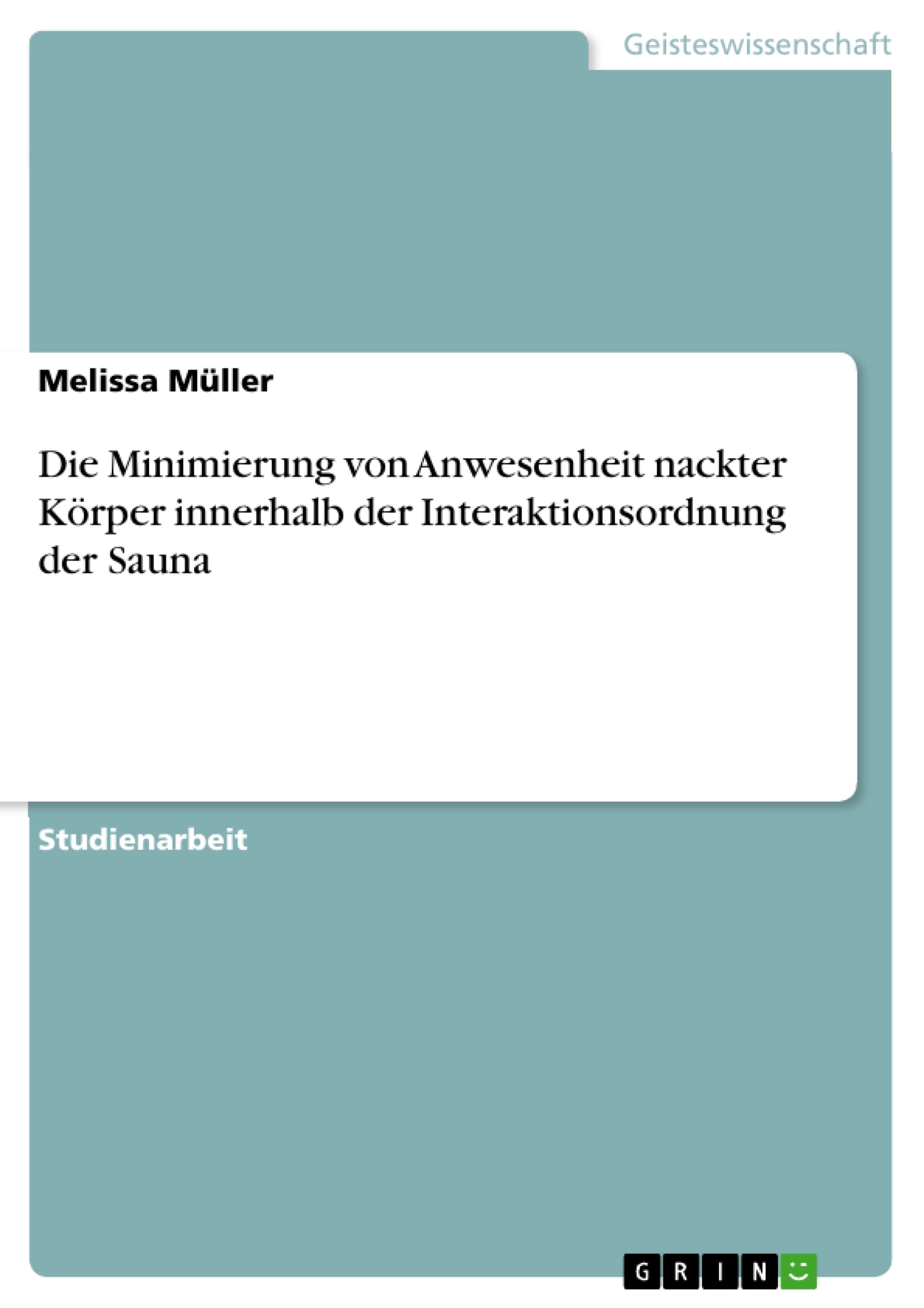Die soziale Situation in der Sauna unterscheidet sich von alltäglichen Situationen in einem Punkt elementar: die Menschen in der Sauna sind nackt. Während meiner Beobachtungen in der Sauna gelangte ich daraufhin zu der Frage, wie die Interaktionsordnung in der Sauna trotz nackter Körper zur Minimierung von Anwesenheit beiträgt.
Angelehnt an Erving Goffmans Interaktionssoziologie wird dieser Frage in der vorliegenden Arbeit nachgegangen. Dabei wird insbesondere Bezug auf Goffmans Konzept der „Territorien des Selbst“ sowie auf die empirische Arbeit zur Minimierung von Anwesenheit in einem Fahrstuhl von Stefan Hirschauer genommen. An die einleitenden Erläuterungen zu den theoretischen Grundlagen und der Forschungsmethode schließt sich die Interpretation des Datenmaterials an. Dabei richte ich mich in der Argumentation derjenigen Reihenfolge, in der eine Saunapraktik vollzogen wird: vom Betreten und der Platzwahl in der Sauna über das Ordnen der Blicke während des Saunabads bis zum Verlassen der Saunakabine. Im Fokus stehen hierbei die „Territorien des Selbst“, die auf ihre Funktion zur Minimierung von Anwesenheit hin analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 „Die Territorien des Selbst“
- 2.2 „Die Praxis der Fremdheit und die Minimierung von Anwesenheit“
- 3. Methode
- 4. Interpretation
- 4.1 Die Rolle des Handtuchs bei der Platzwahl
- 4.2 In der Sauna: Blicke kontrollieren und Anwesenheit minimieren
- 4.3 Die Sauna verlassen
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Interaktionsordnung in der Sauna, insbesondere im Hinblick darauf, wie die Minimierung von Anwesenheit trotz nackter Körper erreicht wird. Angelehnt an Erving Goffmans Interaktionssoziologie werden Goffmans Konzept der „Territorien des Selbst“ sowie Stefan Hirschauers empirische Arbeit zur Minimierung von Anwesenheit in einem Fahrstuhl herangezogen.
- Die „Territorien des Selbst“ als Mittel zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Interaktionsordnung in der Sauna
- Die Rolle von Blicken und der Kontrolle des eigenen Körpers zur Minimierung von Anwesenheit
- Die Anwendung von Goffmans Theorie auf die spezifische Situation des Saunabads
- Vergleichspunkte zwischen der Interaktionsordnung in der Sauna und der sozialen Situation im Fahrstuhl
- Die Bedeutung von Raum und Distanz in der Sauna
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sauna und die Forschungsfrage ein, die sich auf die Minimierung von Anwesenheit in der Sauna trotz nackter Körper konzentriert. Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es Goffmans Konzept der „Territorien des Selbst“ sowie Hirschauers empirische Studie zur Minimierung von Anwesenheit im Fahrstuhl darstellt. Kapitel 3 beschreibt die Forschungsmethode der Arbeit, die auf der Beobachtung von Interaktionen in der Sauna basiert. Kapitel 4 interpretiert das gesammelte Datenmaterial, wobei die einzelnen Praktiken des Saunabads, wie die Platzwahl, das Ordnen der Blicke und das Verlassen der Saunakabine, in den Fokus gerückt werden. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die Bedeutung der „Territorien des Selbst“ für die Interaktionsordnung in der Sauna hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen „Interaktionsordnung“, „Territorien des Selbst“, „Minimierung von Anwesenheit“, „Sauna“, „Blicke“, „Körper“, „Raum“, „Distanz“ und „Soziale Situation“. Die empirischen Beobachtungen und die Analyse der Daten basieren auf Goffmans Theorie und Hirschauers empirischen Untersuchungen.
Häufig gestellte Fragen zur Interaktionsordnung in der Sauna
Wie funktioniert die "Minimierung von Anwesenheit" in der Sauna?
Trotz Nacktheit wahren Saunagäste die soziale Ordnung, indem sie Blickkontakt vermeiden, körperliche Distanz halten und so tun, als wären die anderen Anwesenden kaum präsent.
Was sind Goffmans "Territorien des Selbst"?
Das sind soziale Schutzbereiche (wie der persönliche Raum oder die Hülle des Körpers), die ein Individuum beansprucht, um seine Privatsphäre in öffentlichen Situationen zu wahren.
Welche Rolle spielt das Handtuch bei der Interaktion?
Das Handtuch dient nicht nur der Hygiene, sondern markiert das persönliche Territorium auf der Saunabank und schafft eine physische Barriere zwischen den nackten Körpern.
Wie werden Blicke in der Sauna kontrolliert?
Saunagäste praktizieren oft das "Anstarren der Leere" oder richten den Blick auf die Decke oder den Ofen, um das Unbehagen durch die gegenseitige Nacktheit zu minimieren.
Warum ist die Sauna mit einem Fahrstuhl vergleichbar?
In beiden Situationen herrscht räumliche Enge mit Fremden. Wie im Fahrstuhl wird auch in der Sauna durch Schweigen und Blickvermeidung die soziale Interaktion auf ein Minimum reduziert.
- Citation du texte
- Melissa Müller (Auteur), 2019, Die Minimierung von Anwesenheit nackter Körper innerhalb der Interaktionsordnung der Sauna, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1068982