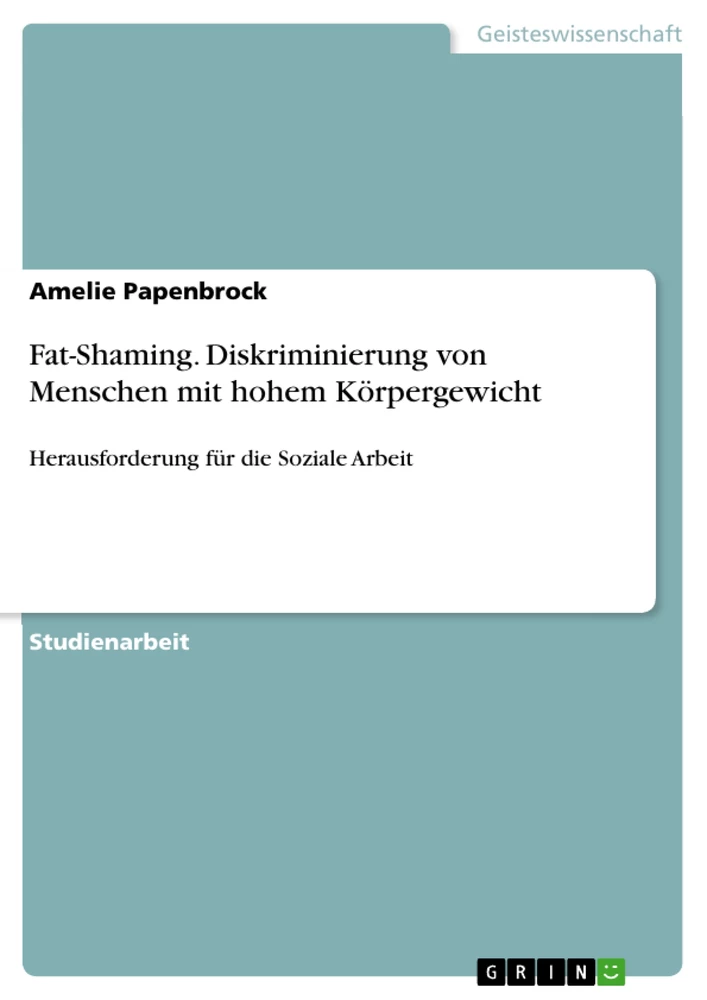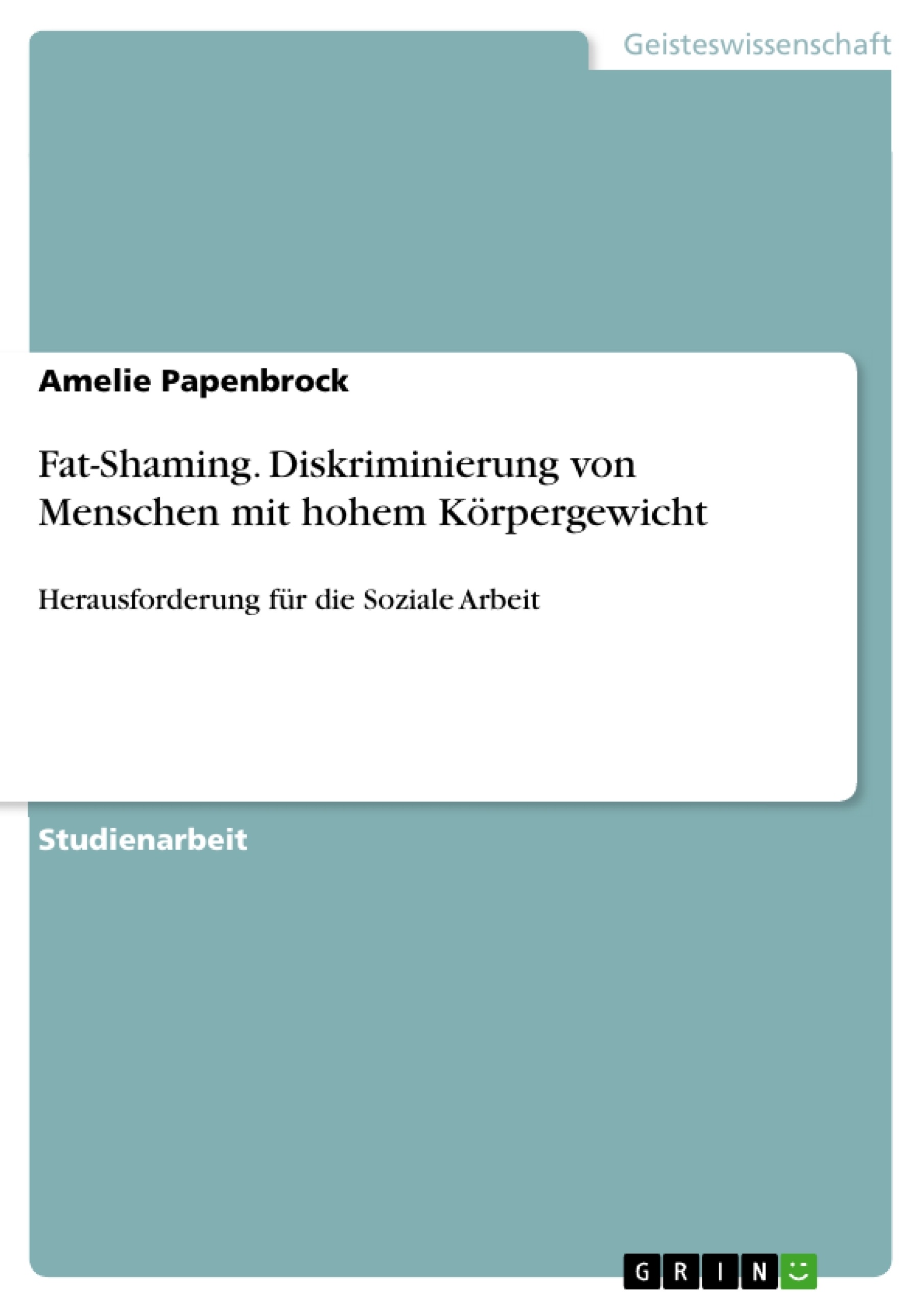Diese Arbeit soll der Frage nachgehen, inwiefern Menschen mit hohem Körpergewicht in Deutschland diskriminiert werden, welche Ansätze gegen diese Diskriminierung bereits vorhanden sind und auch, wie die soziale Arbeit als Disziplin und Profession diesem Thema begegnet.
Dafür soll zunächst der zentrale Begriff Adipositas und Übergewicht bestimmt werden, um anschließend auf den historischen Kontext der Diskriminierung von Betroffenen einzugehen. Ferner soll die Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht anhand der Bereiche Arbeit, Gesundheit, Bildung und gesellschaftlicher Repräsentation herausgearbeitet werden, um auch die intersektionalen Aspekte anhand der Differenzlinien Geschlecht, Schichtzugehörigkeit/sozioökonomischer Status sowie Ethnie in die Betrachtung miteinzubeziehen. Im Anschluss sollen Konzepte beispielhaft vorgestellt werden, die der Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht entgegenwirken und der Umgang der sozialen Arbeit mit der Differenzlinie Gewicht hinterfragt werden. Ein persönliches Fazit mit Ausblick soll diese Arbeit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Geschichtlicher Hintergrund
- Diskriminierung dicker Menschen in verschiedenen Bereichen
- Arbeit
- Gesundheit
- Bildung
- Gesellschaftliche Repräsentanz
- Intersektionale Perspektiven
- Konzepte gegen Fatshaming
- Fat-Acceptance Movement
- Bezug zur sozialen Arbeit
- Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht in Deutschland. Sie beleuchtet den historischen Kontext, analysiert die Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen und betrachtet intersektionale Aspekte. Zusätzlich werden Konzepte gegen Fatshaming vorgestellt und der Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt.
- Definition von Adipositas und Übergewicht und deren gesellschaftliche Wahrnehmung
- Historische Entwicklung der gesellschaftlichen Bewertung von Körpergewicht
- Diskriminierung in Arbeit, Gesundheit, Bildung und gesellschaftlicher Repräsentanz
- Intersektionale Perspektiven (Geschlecht, Schicht, Ethnie)
- Konzepte und Strategien gegen Fatshaming
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Ausgangslage: Eine körperfettfeindliche Gesellschaft, in der Übergewicht medial stark negativ dargestellt wird und Betroffene stigmatisiert werden. Trotz rechtlicher Bemühungen zur Gleichbehandlung, besteht weiterhin Diskriminierung. Die Arbeit untersucht die Diskriminierung, vorhandene Gegenstrategien und den Umgang der Sozialen Arbeit mit diesem Thema.
Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff Adipositas und seine Problematik. Der Body Mass Index (BMI) wird kritisch hinterfragt, da er nicht immer den tatsächlichen Körperfettanteil widerspiegelt. Es werden unterschiedliche gesellschaftliche Betrachtungsweisen von Übergewicht vorgestellt, von individueller Verantwortlichkeit bis hin zur Anerkennung von Körpervielfalt und der Fat-Acceptance-Bewegung.
Geschichtlicher Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel der gesellschaftlichen Bewertung von Körpergewicht. Während Fülle früher als positiv angesehen wurde, hat sich seit den 1880er Jahren ein gesellschaftlicher Trend zur Schlankheit etabliert. Die Rolle der Medizin in diesem Wandel wird diskutiert, wobei hervorgehoben wird, dass sie sich der gesellschaftlichen Wahrnehmung angepasst hat, anstatt diese zu prägen.
Diskriminierung dicker Menschen in verschiedenen Bereichen: Dieses Kapitel wird sich detailliert mit den verschiedenen Bereichen auseinandersetzen, in denen Menschen mit hohem Körpergewicht Diskriminierung erfahren. Dies beinhaltet die Analyse von Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt, im Gesundheitswesen, im Bildungssystem und in der gesellschaftlichen Repräsentation. Es werden Beispiele genannt und die Auswirkungen dieser Diskriminierung auf das Leben der Betroffenen beleuchtet.
Intersektionale Perspektiven: In diesem Kapitel wird die Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht unter Berücksichtigung weiterer Differenzlinien wie Geschlecht, soziale Schicht und Ethnie untersucht. Es wird analysiert, wie sich diese verschiedenen Faktoren überschneiden und die Diskriminierungserfahrungen verstärken oder verändern können.
Konzepte gegen Fatshaming: Hier werden Konzepte vorgestellt, die der Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht entgegenwirken sollen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Fat-Acceptance-Bewegung, die sich für eine positive und akzeptierende Sichtweise auf Körpervielfalt einsetzt. Die Ziele und Strategien der Bewegung werden erläutert und diskutiert.
Bezug zur sozialen Arbeit: Dieses Kapitel analysiert, wie die Soziale Arbeit als Disziplin und Profession auf das Thema Fatshaming und die Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht reagiert und welche Rolle sie dabei spielen kann. Es werden mögliche Ansätze und Interventionen im Sozialen Arbeitskontext beleuchtet.
Schlüsselwörter
Fatshaming, Adipositas, Diskriminierung, Körpergewicht, Body Mass Index (BMI), Fat-Acceptance Movement, Intersektionalität, Soziale Arbeit, Gesundheit, Bildung, Gesellschaftliche Repräsentanz, Gewichtsstigma.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diskriminierung dicker Menschen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht in Deutschland. Sie beleuchtet den historischen Kontext, analysiert die Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen (Arbeit, Gesundheit, Bildung, Gesellschaft), betrachtet intersektionale Aspekte (Geschlecht, Schicht, Ethnie) und stellt Konzepte gegen Fatshaming sowie den Bezug zur Sozialen Arbeit dar.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Begriffsbestimmungen (inkl. kritischer Betrachtung des BMI), einen geschichtlichen Hintergrund zur gesellschaftlichen Bewertung von Körpergewicht, eine detaillierte Analyse der Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen, eine Betrachtung intersektioneller Perspektiven, die Vorstellung von Konzepten gegen Fatshaming (mit Schwerpunkt auf der Fat-Acceptance-Bewegung) und eine Analyse des Bezugs zur Sozialen Arbeit. Ein Fazit und Ausblick runden die Arbeit ab.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die jeweils einen Aspekt des Themas behandeln. Diese Kapitel umfassen eine Einleitung, Begriffsbestimmungen, einen geschichtlichen Überblick, eine Analyse der Diskriminierung in verschiedenen Bereichen, eine Betrachtung intersektioneller Perspektiven, die Vorstellung von Konzepten gegen Fatshaming, den Bezug zur Sozialen Arbeit und ein abschließendes Fazit und Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Fatshaming, Adipositas, Diskriminierung, Körpergewicht, Body Mass Index (BMI), Fat-Acceptance Movement, Intersektionalität, Soziale Arbeit, Gesundheit, Bildung, Gesellschaftliche Repräsentanz, Gewichtsstigma.
Wie wird der BMI in der Arbeit betrachtet?
Der Body Mass Index (BMI) wird kritisch hinterfragt, da er nicht immer den tatsächlichen Körperfettanteil widerspiegelt und somit als alleiniges Maß für die Beurteilung des Körpergewichts ungeeignet ist.
Welche Rolle spielt die Fat-Acceptance-Bewegung?
Die Fat-Acceptance-Bewegung wird als ein zentrales Konzept gegen Fatshaming vorgestellt. Ihre Ziele und Strategien für eine positive und akzeptierende Sichtweise auf Körpervielfalt werden erläutert und diskutiert.
Wie wird der Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt?
Die Arbeit analysiert, wie die Soziale Arbeit auf Fatshaming und die Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht reagiert und welche Rolle sie dabei spielen kann. Mögliche Ansätze und Interventionen im Sozialen Arbeitskontext werden beleuchtet.
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Der geschichtliche Wandel der gesellschaftlichen Bewertung von Körpergewicht wird beleuchtet. Dabei wird der Übergang von einer früheren positiven Bewertung von Fülle hin zu einem seit den 1880er Jahren vorherrschenden Schlankheitsideal untersucht, und die Rolle der Medizin in diesem Wandel wird kritisch hinterfragt.
Welche intersektionellen Perspektiven werden berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht mit anderen Differenzlinien wie Geschlecht, soziale Schicht und Ethnie überschneidet und die Diskriminierungserfahrungen verstärkt oder verändert.
Wo findet man detaillierte Informationen zur Diskriminierung in verschiedenen Bereichen?
Das Kapitel "Diskriminierung dicker Menschen in verschiedenen Bereichen" analysiert detailliert die Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt, im Gesundheitswesen, im Bildungssystem und in der gesellschaftlichen Repräsentation. Es werden Beispiele genannt und die Auswirkungen dieser Diskriminierung auf das Leben der Betroffenen beleuchtet.
- Quote paper
- Amelie Papenbrock (Author), 2019, Fat-Shaming. Diskriminierung von Menschen mit hohem Körpergewicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1068786