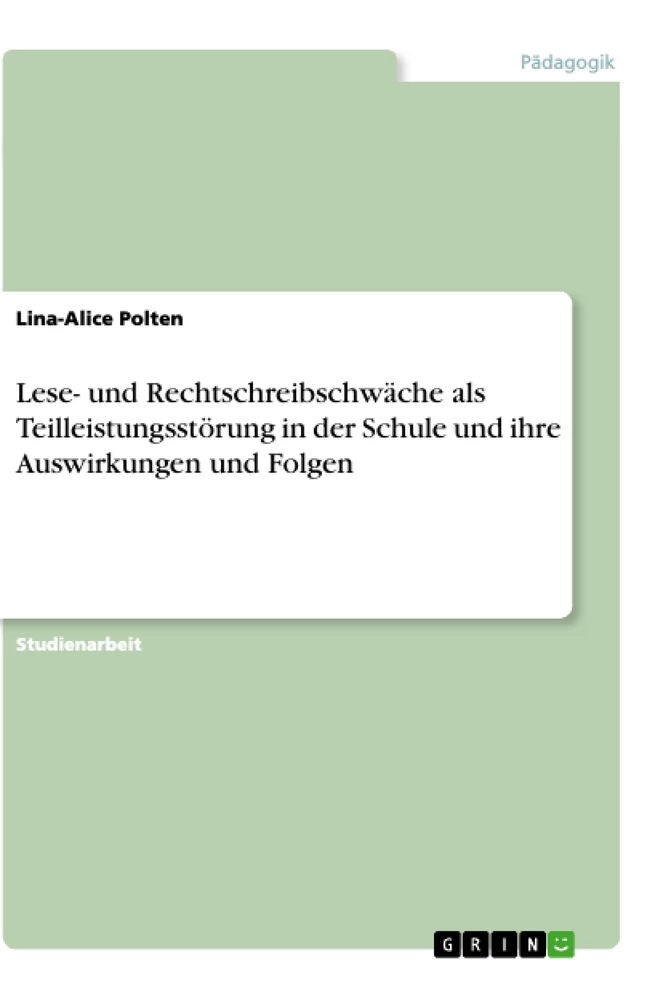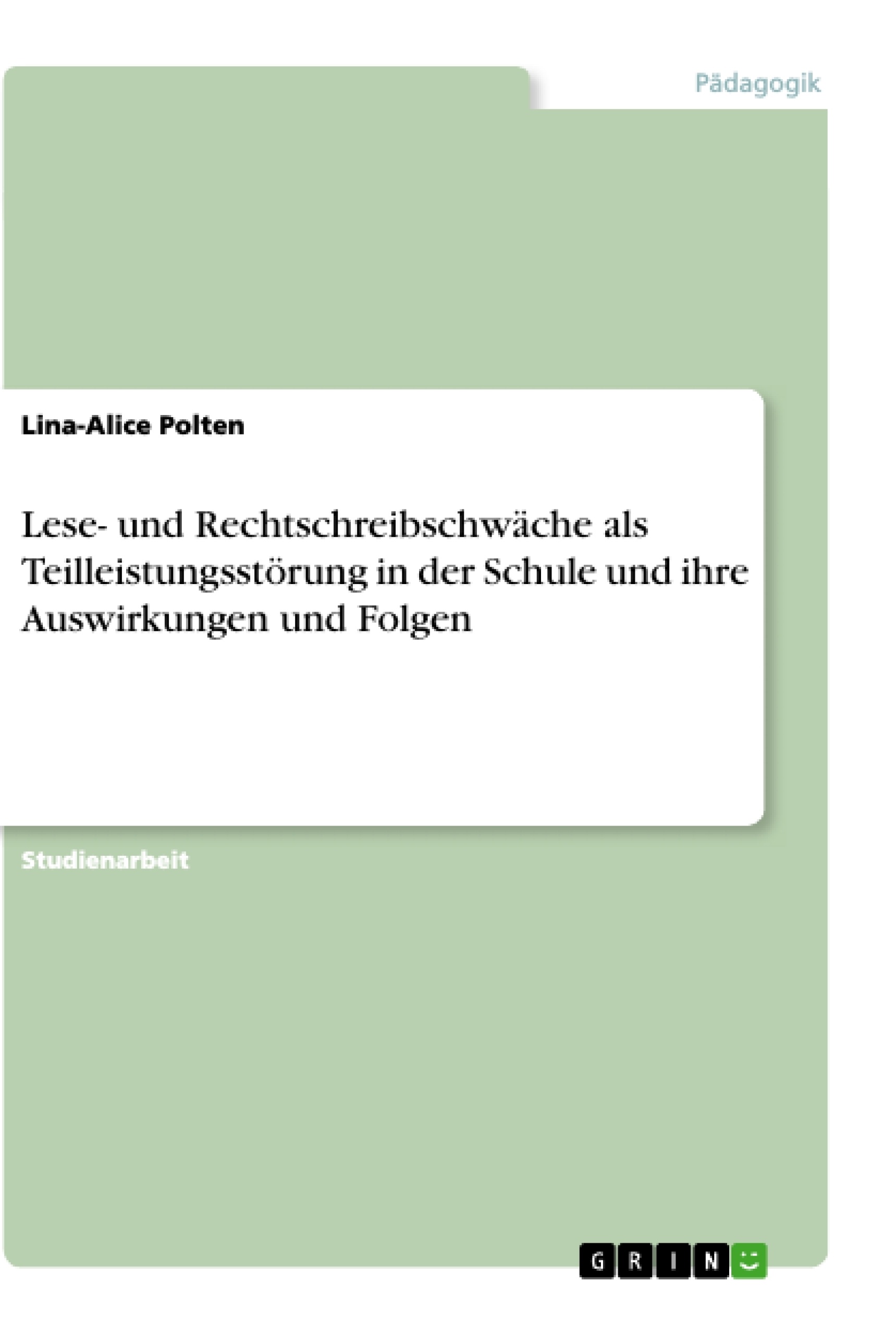Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Auswirkungen und Folgen einer Lese- und Rechtschreibschwäche LRS zu verdeutlichen und zu diskutieren. Zu Beginn wird der theoretische Hintergrund beleuchtet. Es wird darauf eingegangen, wie LRS definiert wird und welche Ursachen dieser zugrunde liegen. Darauf folgt die Erklärung wie LRS erkannt und diagnostiziert werden kann. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Situation in der Schule gelegt und welche Auswirkungen sowie Folgen es für die Betroffenen geben kann. Des Weiteren wird dargestellt, welche präventiven Maßnahmen sich als wirksam herausgestellt haben, sowie welche nicht präventiven Maßnahmen es im Rahmen der schulischen Betreuung gibt. Die Diskussion beginnt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse über die LRS und bezieht sich auf Studien, die sich mit der Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen beschäftigten. Als Fazit der Ausarbeitung wird gezogen, dass auf das frühe Erkennen von LRS ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der Lese- und Rechtschreibschwäche
- 3. Potenzielle Ursachen einer Lese- Rechtschreibschwäche
- 3.1. Die visuelle und auditive Wahrnehmung
- 3.2. Die genetische Erklärung
- 4. Die Erkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
- 4.1. Symptome
- 4.2. Diagnostik
- 5. Lese- Rechtschreibschwäche in der Schule - Auswirkungen und Folgen
- 6. Prävention und Förderungsmöglichkeiten
- 6.1. Prävention von Schwierigkeiten vor dem Schulbeginn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) als Teilleistungsstörung im schulischen Kontext, beleuchtet deren Auswirkungen und Folgen und diskutiert präventive sowie fördernde Maßnahmen. Der Fokus liegt auf der genetisch bedingten Form der LRS (Legasthenie).
- Definition und Abgrenzung der Lese-Rechtschreibschwäche
- Ursachen und Entstehung der LRS (biologische und genetische Faktoren)
- Erkennung und Diagnostik von LRS
- Auswirkungen und Folgen von LRS auf den schulischen Erfolg und die psychosoziale Entwicklung
- Prävention und Förderung von LRS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) heraus, indem sie auf die hohe Prävalenz in Deutschland und die erheblichen Auswirkungen auf den schulischen und gesellschaftlichen Werdegang hinweist. Sie hebt die Bedeutung frühzeitiger Erkennung und Prävention hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition, Ursachen, Erkennung, Auswirkungen und Fördermöglichkeiten der LRS umfasst. Die Einleitung verdeutlicht, dass neben den akademischen Konsequenzen, auch die psychosozialen Auswirkungen für Betroffene im Fokus der Arbeit stehen.
2. Definition der Lese- und Rechtschreibschwäche: Dieses Kapitel definiert die Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) als eine Entwicklungsstörung im Bereich des Lesens und Schreibens, die nicht durch Intelligenzminderung, fehlende Schulung, psychische Erkrankungen oder Hirnschädigungen erklärt werden kann. Es wird zwischen der genetisch bedingten LRS (Legasthenie) und der erworbenen LRS unterschieden, wobei sich die Arbeit auf die genetisch bedingte Form konzentriert. Die Definition betont die Bedeutung der Abgrenzung zu anderen Faktoren und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich umfassend mit Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS). Sie definiert LRS, untersucht mögliche Ursachen (insbesondere genetische Faktoren), beschreibt die Erkennung und Diagnostik, analysiert die Auswirkungen auf Schule und Sozialleben und stellt präventive sowie fördernde Maßnahmen vor. Der Fokus liegt auf der genetisch bedingten Form, der Legasthenie.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Abgrenzung von LRS, Ursachen und Entstehung (biologische und genetische Faktoren), Erkennung und Diagnostik, Auswirkungen auf schulischen Erfolg und psychosoziale Entwicklung, sowie Prävention und Förderung von LRS. Die visuelle und auditive Wahrnehmung als potenzielle Einflussfaktoren werden ebenfalls beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition von LRS, potenzielle Ursachen (inklusive visueller und auditiver Wahrnehmung und genetischer Aspekte), Erkennung von LRS (Symptome und Diagnostik), Auswirkungen von LRS auf die Schule, Prävention und Fördermöglichkeiten (inklusive präventiver Maßnahmen vor Schulbeginn). Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht LRS als Teilleistungsstörung im schulischen Kontext, beleuchtet deren Auswirkungen und Folgen und diskutiert präventive und fördernde Maßnahmen. Der Schwerpunkt liegt auf der genetisch bedingten Form der LRS (Legasthenie).
Welche Arten von LRS werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der genetisch bedingten LRS (Legasthenie) und der erworbenen LRS, konzentriert sich aber hauptsächlich auf die genetisch bedingte Form.
Wie werden LRS erkannt und diagnostiziert?
Die Arbeit beschreibt die Symptome von LRS und geht auf die Methoden der Diagnostik ein, ohne diese im Detail zu spezifizieren.
Welche Auswirkungen hat LRS auf den schulischen Erfolg?
Die Arbeit thematisiert die negativen Auswirkungen von LRS auf den schulischen Erfolg und die psychosoziale Entwicklung der Betroffenen.
Welche Möglichkeiten der Prävention und Förderung gibt es?
Die Arbeit beschreibt präventive Maßnahmen, die bereits vor Schulbeginn ergriffen werden können, und weitere Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS, ohne diese im Detail aufzulisten.
- Citar trabajo
- Lina-Alice Polten (Autor), 2020, Lese- und Rechtschreibschwäche als Teilleistungsstörung in der Schule und ihre Auswirkungen und Folgen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1066481