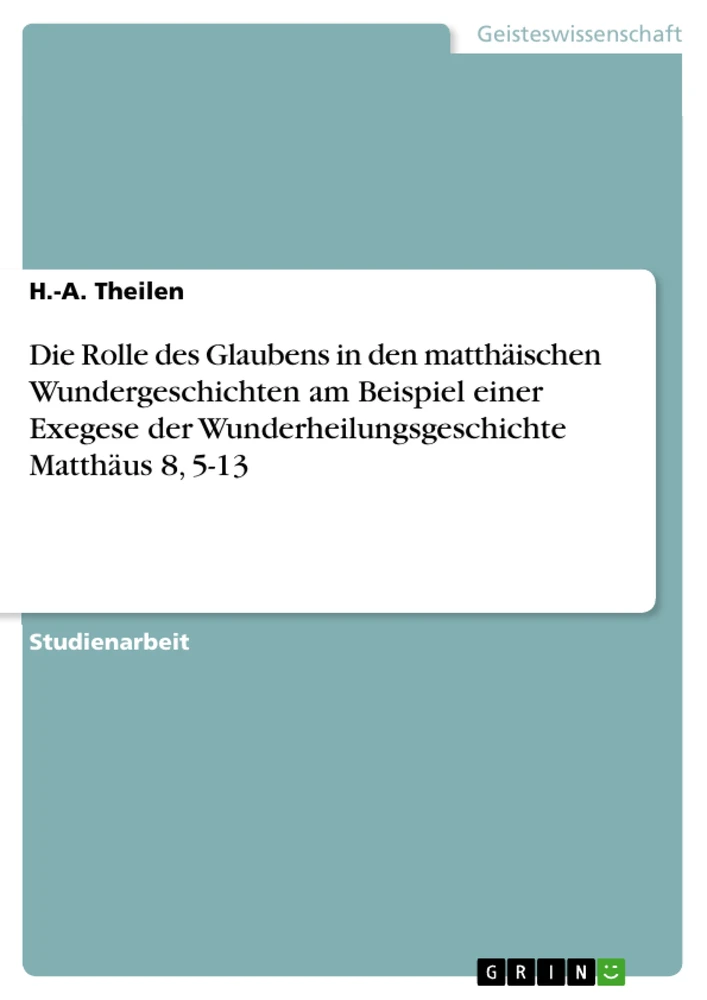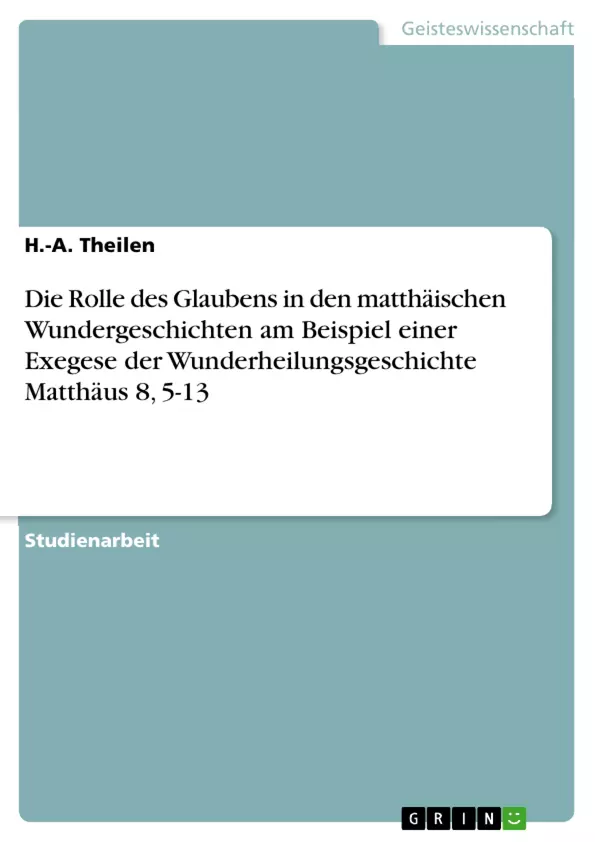In dieser Seminararbeit geht es um die neutestamentliche Geschichte „Der
Hauptmann von Kafarnaum", die im Matthäusevangelium 8,5-13 steht. Es
werden an diesem Text die exegetischen Methoden verwendet, um einen
gewissenhaften Umgang mit neutestamentlichen Texten zu pflegen und dem
sachgemäßen Verstehen derselben zu dienen.
Nach einer Inhaltsangabe der Geschichte folgen die Exegeseschritte
sprachliche Analyse, Quellenanalyse, Gattungskritik, Traditions- und
Redaktionskritik. Im Anschluss an die eigentliche Exegese folgt eine kurze
Zusammenfassung, in der die wichtigsten Ergebnisse und Schlüsse
wiedergegeben werden.
Den letzten Teil dieser Hausarbeit bildet eine Einführung in die Rolle des
Glaubens nach dem matthäischen Verständnis. Es geht darum aufzuzeigen,
dass der Evangelist Matthäus auch in den Wundergeschichten immer wieder
die große Bedeutung des Glaubens betont.
Inhaltsverzeichnis
- Exposition
- Die Übersetzung des Matthäustextes 8, 5-13
- Inhaltsangabe
- Textkritik
- Anmerkungen zum übersetzten Text
- Literarkritik
- Abgrenzung der Geschichte
- Struktur der Geschichte
- Synoptischer Vergleich
- Formgeschichte
- Tradition und Redaktion
- Zusammenfassung
- Der Glaube in den matthäischen Wundergeschichten
- Das Thema des Glaubens
- Die Rolle des Glaubens in den mt. Wundergeschichten
- Der Glaube als Gebetsglaube bei Matthäus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die neutestamentliche Geschichte „Der Hauptmann von Kafarnaum“ aus dem Matthäusevangelium (8, 5-13) unter Verwendung exegetischer Methoden. Ziel ist es, einen genauen Umgang mit neutestamentlichen Texten zu fördern und deren Verständnis zu verbessern.
- Analyse der sprachlichen Besonderheiten und der Quelle des Textes
- Untersuchung der literarischen Struktur und des synoptischen Vergleichs der Geschichte
- Erforschung der Rolle des Glaubens in den matthäischen Wundergeschichten
- Bedeutung des Gebetsglaubens im Matthäusevangelium
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Analyse der Übersetzung des Matthäustextes 8, 5-13, inklusive einer Inhaltsangabe. Die Textkritik beleuchtet wichtige Aspekte der Übersetzungsvarianten und der möglichen Quellen des Textes. Im Abschnitt der Literarkritik werden die Abgrenzung der Geschichte, ihre Struktur und der Vergleich mit anderen synoptischen Evangelien untersucht.
Weiterhin wird die Formgeschichte betrachtet, die die Entstehung und Entwicklung der Geschichte beleuchtet. Die Traditions- und Redaktionskritik analysiert die Überlieferung und die redaktionelle Bearbeitung des Textes durch Matthäus. Ein zusammenfassendes Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Exegese zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen des Glaubens und der Wunder in den matthäischen Wundergeschichten. Weitere wichtige Begriffe sind Exegese, Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte, Tradition und Redaktion sowie der Vergleich mit anderen synoptischen Evangelien. Insbesondere die Rolle des Gebetsglaubens im Matthäusevangelium wird in der Analyse hervorgehoben.
Häufig gestellte Fragen
Welche biblische Geschichte wird in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit befasst sich mit der Wunderheilungsgeschichte „Der Hauptmann von Kafarnaum“ aus Matthäus 8, 5-13.
Welche exegetischen Methoden kommen zum Einsatz?
Es werden sprachliche Analyse, Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte sowie Traditions- und Redaktionskritik angewendet.
Welche Rolle spielt der Glaube im Matthäusevangelium?
Matthäus betont die große Bedeutung des Glaubens, insbesondere in Form des Gebetsglaubens, als zentrales Element der Wundergeschichten.
Was ist das Ziel des synoptischen Vergleichs?
Der Vergleich mit anderen Evangelien dient dazu, die redaktionellen Besonderheiten und die spezifische theologische Akzentuierung von Matthäus herauszuarbeiten.
Was bedeutet „Redaktionskritik“ in diesem Zusammenhang?
Die Redaktionskritik untersucht, wie der Evangelist Matthäus überlieferte Traditionen bearbeitet und für seine spezifische Gemeindeabsicht zusammengestellt hat.
- Citation du texte
- H.-A. Theilen (Auteur), 2003, Die Rolle des Glaubens in den matthäischen Wundergeschichten am Beispiel einer Exegese der Wunderheilungsgeschichte Matthäus 8, 5-13, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10637