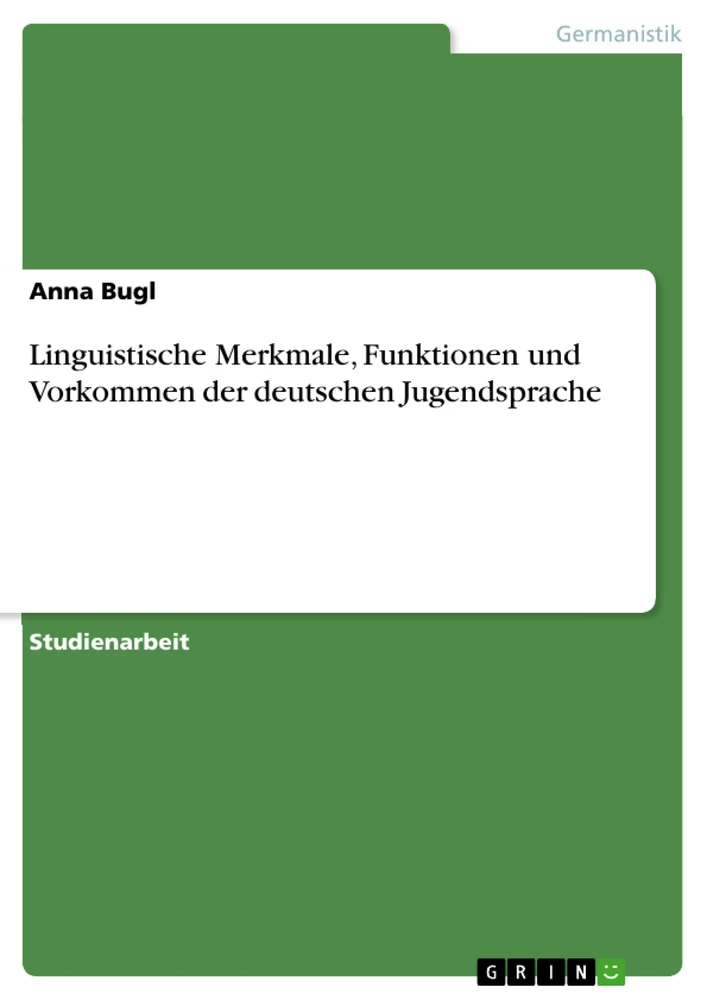Eltern, Lehrer und Medien werten ihn ab und setzen ihn mit Sprachverfall gleich; Jugendliche identifizieren sich mit ihm: der Begriff Jugendsprache ist ein allgegenwärtiger. So kommt man im alltäglichen Leben kaum um die Jugendsprache umher, sie scheint ein ständiger Berührungspunkt zu sein. Grundsätzlich kann die Sprache der Jugendlichen aus sprachwissenschaftlicher Sicht in dem Bereich der Soziolinguistik verankert werden. Dennoch ruft der Terminus Jugendsprache so manche Fragen auf. Auf diese soll in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen und schrittweise geklärt werden.
Mögliche anfängliche Fragen scheinen eine Erklärung des schwammigen Begriffes und eine allgemeine Definition zu fordern. Des Weiteren herrscht oftmals Unklarheit, beziehungsweise Unstimmigkeit über die Tatsache, ob es sich bei der Sprache der Jugendlichen um eine Varietät oder um einen Stil handelt. Die Fragen nach gewissen Merkmalen der Sprache und Situationen, in denen die Jugendsprache auftritt, sind ebenso berechtigt. Auch die Funktionen dieser Sprechweise stellen ein Rätsel auf.
Um jene Fragen zu klären, werden zunächst die Termini Jugend und Jugendsprache definiert. Daraufhin werden die Funktionen und Situationen, in denen die Jugendsprache geläufig ist, vorgestellt. Der Fokus der Arbeit wird auf den Merkmalen der Jugendsprache liegen, wobei hier auf das Lexikon, die Semantik, die Syntax und die Morphologie Bezug genommen wird.
Abschließend folgt ein prägnanter Exkurs zu der Jugendsprachforschung und deren Kritik, wobei hier genauer auf Jugendwörterbücher und die Präferenzhypothese eingegangen wird. Im abschließenden Fazit sollen die vorherig genannten Fragen endgültig geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition Jugend
- 3 Jugendsprache
- 3.1 Definition
- 3.2 Varietät oder Stil?
- 4 Funktionen der Jugendsprache
- 5 Vorkommen der Jugendsprache
- 6 Merkmale der Jugendsprache
- 6.1 Lexikon
- 6.1.1 Anglizismen
- 6.1.2 „Migrantendeutsch“
- 6.1.3 Adjektive
- 6.1.4 Lautwörter und Comicsprache
- 6.2 Morphologie
- 6.2.1 Komposition
- 6.2.2 Derivation
- 6.2.3 Konversion
- 6.2.4 Modifikation
- 6.2.5 Kurzwörter
- 6.2.6 Neologismen
- 6.3 Semantik
- 6.3.1 Metaphorisierungen
- 6.3.2 Bedeutungserweiterungen und Bedeutungsverengungen
- 6.4 Syntax
- 6.4.1 Strukturen
- 6.4.2 Partikel
- 6.4.3 Floskeln und Phraseologismen
- 6.1 Lexikon
- 7 Jugendsprachforschung
- 7.1 Jugendwörterbücher
- 7.2 Präferenzhypothese
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den vielschichtigen Begriff der Jugendsprache. Ziel ist es, den Begriff zu definieren, seine Funktionen und sein Vorkommen zu beschreiben und seine sprachlichen Merkmale (Lexikon, Morphologie, Semantik, Syntax) zu analysieren. Dabei wird auch die Jugendsprachforschung mit ihren Ansätzen, wie Jugendwörterbüchern und der Präferenzhypothese, beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Jugendsprache"
- Funktionen und Verwendungskontexte von Jugendsprache
- Sprachliche Merkmale der Jugendsprache (Lexikon, Morphologie, Semantik, Syntax)
- Jugendsprachforschung: Ansätze und Kritik
- Die Frage nach Varietät oder Stil der Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Jugendsprache ein und benennt zentrale Forschungsfragen. Sie verdeutlicht die Ambivalenz des Begriffs, der von Erwachsenen oft negativ konnotiert, von Jugendlichen aber als Identifikationsmerkmal genutzt wird. Die Arbeit kündigt die schrittweise Klärung dieser Fragen durch Definitionen, Beschreibungen von Funktionen und Vorkommen sowie eine Analyse der sprachlichen Merkmale an. Der Fokus liegt auf dem Lexikon, der Semantik, der Syntax und der Morphologie der Jugendsprache, abschließend wird ein Exkurs zur Jugendsprachforschung folgen.
2 Definition Jugend: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, Jugend einheitlich zu definieren. Es wird betont, dass Jugend individuell geprägt ist und von Faktoren wie Hobbies, Freundeskreis und sozialer Schicht beeinflusst wird. Trotzdem wird Jugend als Phase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter (etwa 14-18 Jahre, mit möglicher Variation) eingeordnet. Die Heterogenität der Jugend wird hervorgehoben, da Faktoren wie Geschlecht, Alter und soziale Rollen die Sprachverwendung stark beeinflussen.
3 Jugendsprache: Dieses Kapitel geht auf die Definition und Einordnung der Jugendsprache ein. Es wird klargestellt, dass es sich nicht um eine homogene Sprache, sondern um ein Konglomerat verschiedener Sprechweisen handelt, die sich je nach Gruppe, Nationalität und Zeit stark unterscheiden. Die Frage, ob Jugendsprache eine Varietät der Standardsprache oder ein Sprechstil ist, wird als zentrale Forschungsfrage aufgeworfen und im weiteren Verlauf des Kapitels genauer untersucht.
6 Merkmale der Jugendsprache: Dieses Kapitel analysiert detailliert die sprachlichen Merkmale der Jugendsprache, unterteilt in Lexikon, Morphologie, Semantik und Syntax. Es werden Beispiele für Anglizismen, "Migrantendeutsch", Wortbildungsprozesse, metaphorische Sprache, und syntaktische Besonderheiten untersucht. Die Analyse zeigt die Vielfältigkeit und Dynamik der sprachlichen Mittel, die Jugendliche verwenden, um ihre Identität und Gruppenzugehörigkeit auszudrücken und die sprachlichen Entwicklungen im Laufe der Zeit zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Soziolinguistik, Varietät, Stil, Lexikon, Morphologie, Semantik, Syntax, Anglizismen, Migrantendeutsch, Neologismen, Jugendsprachforschung, Präferenzhypothese, Sprachwandel, Identifikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Jugendsprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend den Begriff der Jugendsprache. Sie definiert den Begriff, beschreibt seine Funktionen und sein Vorkommen und analysiert seine sprachlichen Merkmale (Lexikon, Morphologie, Semantik, Syntax). Zusätzlich beleuchtet sie die Jugendsprachforschung mit ihren Ansätzen wie Jugendwörterbüchern und der Präferenzhypothese.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition Jugend, Jugendsprache (inkl. der Frage Varietät oder Stil), Funktionen der Jugendsprache, Vorkommen der Jugendsprache, Merkmale der Jugendsprache (Lexikon, Morphologie, Semantik, Syntax), Jugendsprachforschung (inkl. Jugendwörterbücher und Präferenzhypothese) und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Jugendsprache.
Wie wird Jugendsprache definiert?
Die Arbeit betont die Heterogenität von Jugendsprache. Sie wird nicht als homogene Sprache, sondern als Konglomerat verschiedener Sprechweisen definiert, die sich je nach Gruppe, Nationalität und Zeit stark unterscheiden. Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Jugendsprache eine Varietät der Standardsprache oder ein Sprechstil darstellt.
Welche Funktionen hat Jugendsprache?
Die Arbeit beschreibt die Funktionen der Jugendsprache, jedoch sind die spezifischen Funktionen im gegebenen Textauszug nicht detailliert aufgeführt. Es wird aber implizit darauf hingewiesen, dass Jugendsprache zur Identifikation und Gruppenbildung beiträgt.
Wo kommt Jugendsprache vor?
Der Textauszug nennt keine spezifischen Orte oder Situationen, in denen Jugendsprache vorkommt. Es wird aber implizit darauf hingewiesen, dass der Kontext (z.B. Freundeskreis, soziale Schicht) die Sprachverwendung beeinflusst.
Welche sprachlichen Merkmale werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die sprachlichen Merkmale der Jugendsprache, unterteilt in Lexikon (Anglizismen, "Migrantendeutsch", etc.), Morphologie (Wortbildungsprozesse), Semantik (metaphorische Sprache, Bedeutungserweiterungen etc.) und Syntax (syntaktische Besonderheiten).
Welche Aspekte der Jugendsprachforschung werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Jugendsprachforschung mit ihren Ansätzen, insbesondere Jugendwörterbücher und die Präferenzhypothese. Es wird darauf hingewiesen, dass die Jugendsprachforschung die sprachlichen Entwicklungen im Laufe der Zeit beleuchten soll.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Soziolinguistik, Varietät, Stil, Lexikon, Morphologie, Semantik, Syntax, Anglizismen, Migrantendeutsch, Neologismen, Jugendsprachforschung, Präferenzhypothese, Sprachwandel, Identifikation.
Wie wird Jugend definiert?
Die Arbeit betont die Schwierigkeit, Jugend einheitlich zu definieren, da sie individuell geprägt und von Faktoren wie Hobbies, Freundeskreis und sozialer Schicht beeinflusst wird. Sie wird als Phase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter (etwa 14-18 Jahre, mit möglicher Variation) eingeordnet. Die Heterogenität der Jugend wird hervorgehoben.
- Citar trabajo
- Anna Bugl (Autor), 2021, Linguistische Merkmale, Funktionen und Vorkommen der deutschen Jugendsprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1060956