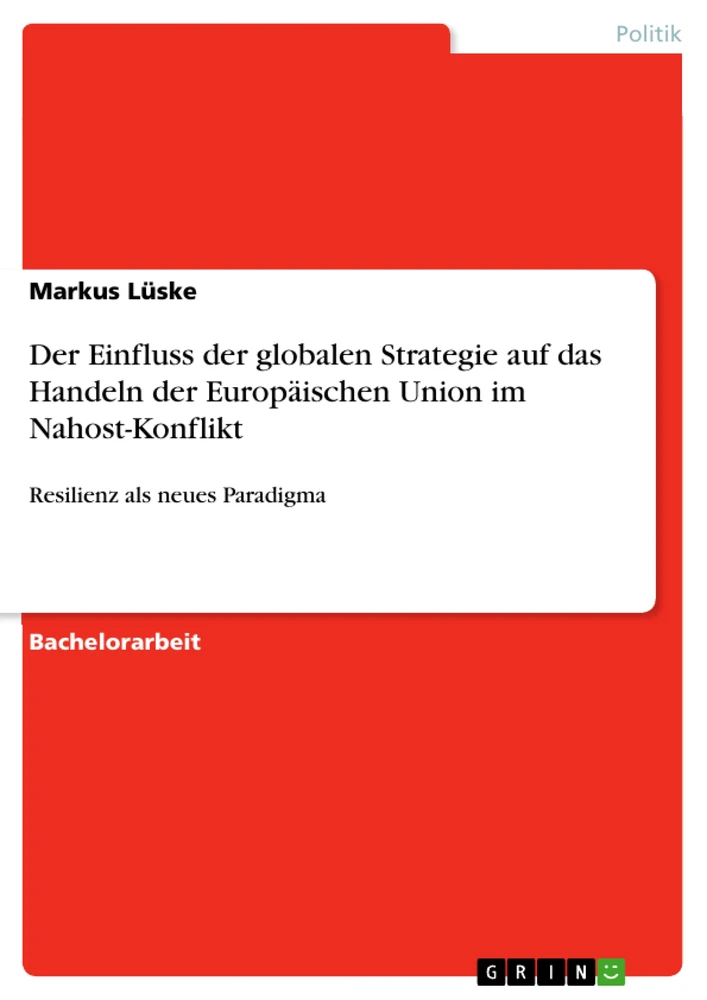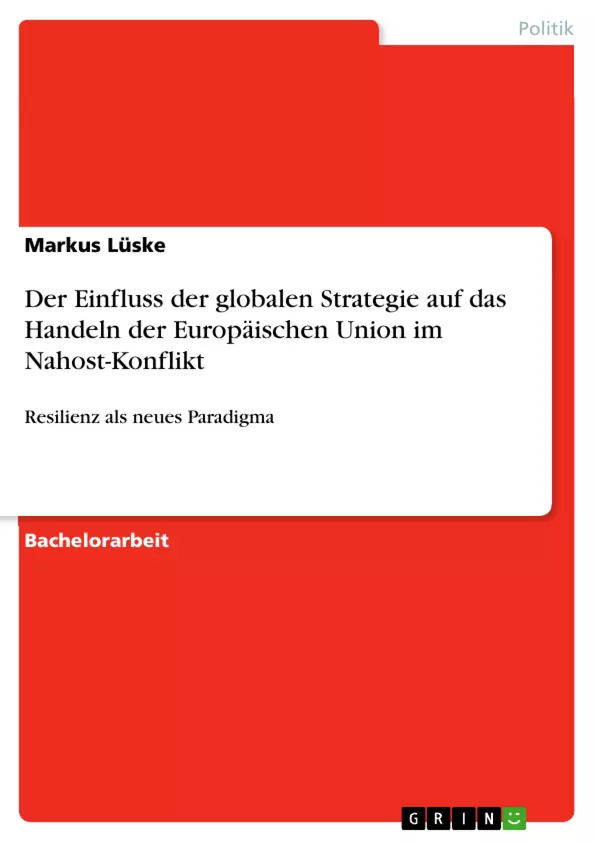Diese Arbeit wird der Frage nachgehen, wie die Europäische Union das Konzept der Resilienz mit Hilfe von Förderprogrammen und Projekten im israelisch-palästinensischen Konflikt umsetzt. Die Relevanz und Aktualität der Frage lässt sich daran ermessen, dass es der EU bis heute aus vielfältigen Gründen nicht gelungen ist, eine von allen Beteiligten anerkannte Rolle als friedenspolitische Akteurin mit Gewicht einzunehmen.
Zurzeit bestimmen die USA mit dem Friedensplan der Trump-Administration und die Normalisierungsabkommen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten die außenpolitischen Entwicklungen in der Region. Allein die Tatsache, dass die EU und zuvor die Europäische Gemeinschaft seit über 50 Jahren als Vermittlerin in diesem langwierigen Konflikt auftreten, der immer wieder auch gewaltsam ausgetragen wird, ist eine Form der Widerstandsfähigkeit und Konfliktfestigkeit. Und mit ihrem Resilienzkonzept als Kernelement der neuen globalen Strategie verfolgt die EU weiterhin das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung, die übrigens auch von der neuen Biden-Regierung favorisiert wird.
Europa und der Nahe Osten stehen seit Jahrhunderten in besonderen Beziehungen zueinander. Belege dafür sind die Kreuzzüge im Mittelalter, die Kolonialpolitik Frankreichs und Englands sowie der Beitrag Europas zur Gründung des Staates Israels und dem daraus resultierenden Konflikt mit der palästinensischen Bevölkerung. Und auch in der dritten Dekade des neuen Jahrtausends sucht die Europäische Union nach Möglichkeiten, zur Stabilität in dieser Region beizutragen im Bewusstsein, dass der Frieden in Europa auch von einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten abhängig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der Resilienz
- Resilienz als Leitmotiv politischen Handelns
- Analyse des Konzepts
- Eigenschaften von Resilienz
- Ziele, AkteurInnen und Resilienzobjekte
- Resilienzinstrumente und Aktivitäten
- Messung und Bewertung von Resilienzmaßnahmen
- Raster zur Analyse von Resilienzprojekten
- Kritische Anmerkungen zum Konzept
- Die außen- und sicherheitspolitische Ausrichtung der Union seit 2016
- Grundsätze und prioritäre Ziele der Globalen Strategie
- Resilienz als neues Paradigma
- Kritik am Resilienzkonzept der EU
- Die Nahost-Politik der Europäischen Union im Überblick
- Motive und Ziele
- Positionen und aktuelle Handlungsfelder
- Die Umsetzung des Resilienzkonzepts der Europäischen Union
- Konfliktprävention und Krisenbewältigung in der südlichen Nachbarschaft
- Auswahl der Projekte und Untersuchungszeitraum
- Überregionale Resilienzmaßnahmen
- „Support to Intra-Palestinian Dialogue and the Resilience of Children and Youths Affected by Conflict in Palestine“
- Resilienzförderung kleiner und mittlerer Unternehmen
- „Enhancing Gaza Economic Resilience“
- Resilienzprojekte im Westjordanland
- „Supporting Palestinian Presence in Area C“
- Resilienzinitiative der Europäischen Investitionsbank
- Resilienzprogramme in Ost-Jerusalem
- „Support to East Jerusalem in 2018, 2019 and 2020“
- Unterstützung des Netzwerks palästinensischer Krankenhäuser
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie die Europäische Union das Konzept der Resilienz im israelisch-palästinensischen Konflikt mit Hilfe von Förderprogrammen und Projekten umsetzt. Sie analysiert die Rolle der EU als friedenspolitische Akteurin in einer Region, die von zahlreichen Krisen und geopolitischen Spannungen geprägt ist. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz und Aktualität der EU-Strategie vor dem Hintergrund der schwierigen Situation im Nahen Osten.
- Das Konzept der Resilienz und seine Anwendung in der EU-Außenpolitik
- Die Globalstrategie der EU und das neue Paradigma der Resilienz
- Die Nahost-Politik der Europäischen Union und die Herausforderungen des israelisch-palästinensischen Konflikts
- Die Umsetzung des Resilienzkonzepts in konkreten EU-Projekten im Westjordanland, Ost-Jerusalem und dem Gaza-Streifen
- Die Bewertung des Beitrags der EU zur Stabilität und zum Frieden im Nahen Osten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die historische Beziehung zwischen Europa und dem Nahen Osten und führt den zentralen Begriff der Resilienz ein, der im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert wird.
Kapitel 2 widmet sich dem Konzept der Resilienz. Es analysiert die Eigenschaften, Ziele, Akteure, Instrumente und die Messbarkeit von Resilienzmaßnahmen. Dieses Kapitel liefert wichtige Grundlagen für die spätere Untersuchung der EU-Projekte.
Kapitel 3 erläutert die aktuelle strategische Ausrichtung der EU mit dem Schwerpunkt auf der Globalen Strategie und dem neuen Paradigma der Resilienz. Es beleuchtet auch kritische Aspekte des Resilienzkonzepts im Kontext der EU-Außenpolitik.
Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Nahost-Politik der EU, ihre Motive und Ziele sowie ihre Positionen zu zentralen Streitthemen. Es zeigt auch auf, in welchen Handlungsfeldern das Resilienzkonzept zur Anwendung kommt.
Kapitel 5 analysiert die Umsetzung des Resilienzkonzepts in sieben EU-Projekten im Westjordanland, Ost-Jerusalem und im Gaza-Streifen. Der Untersuchungszeitraum umfasst die Jahre 2016 bis 2020.
Schlüsselwörter
Resilienz, Globale Strategie, Europäische Union, Nahost-Konflikt, israelisch-palästinensischer Konflikt, Konfliktprävention, Friedensförderung, Entwicklungszusammenarbeit, EU-Projekte, Westjordanland, Ost-Jerusalem, Gaza-Streifen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept der Resilienz in der EU-Außenpolitik?
Resilienz beschreibt die Widerstandsfähigkeit und Konfliktfestigkeit von Gesellschaften und ist ein Kernelement der Globalen Strategie der EU seit 2016.
Welches politische Ziel verfolgt die EU im Nahost-Konflikt?
Die Europäische Union verfolgt weiterhin das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts.
In welchen Regionen setzt die EU Resilienzprojekte um?
Die Projekte konzentrieren sich auf das Westjordanland (Area C), Ost-Jerusalem und den Gaza-Streifen.
Nennen Sie Beispiele für konkrete EU-Förderprogramme im Nahen Osten.
Beispiele sind Programme zur Unterstützung palästinensischer Krankenhäuser in Ost-Jerusalem und Projekte zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz in Gaza.
Wie wird die Rolle der EU als Vermittlerin bewertet?
Trotz jahrzehntelangem Engagement fiel es der EU schwer, eine von allen Beteiligten anerkannte Rolle als gewichtige friedenspolitische Akteurin neben den USA einzunehmen.
- Quote paper
- Markus Lüske (Author), 2021, Der Einfluss der globalen Strategie auf das Handeln der Europäischen Union im Nahost-Konflikt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1059525