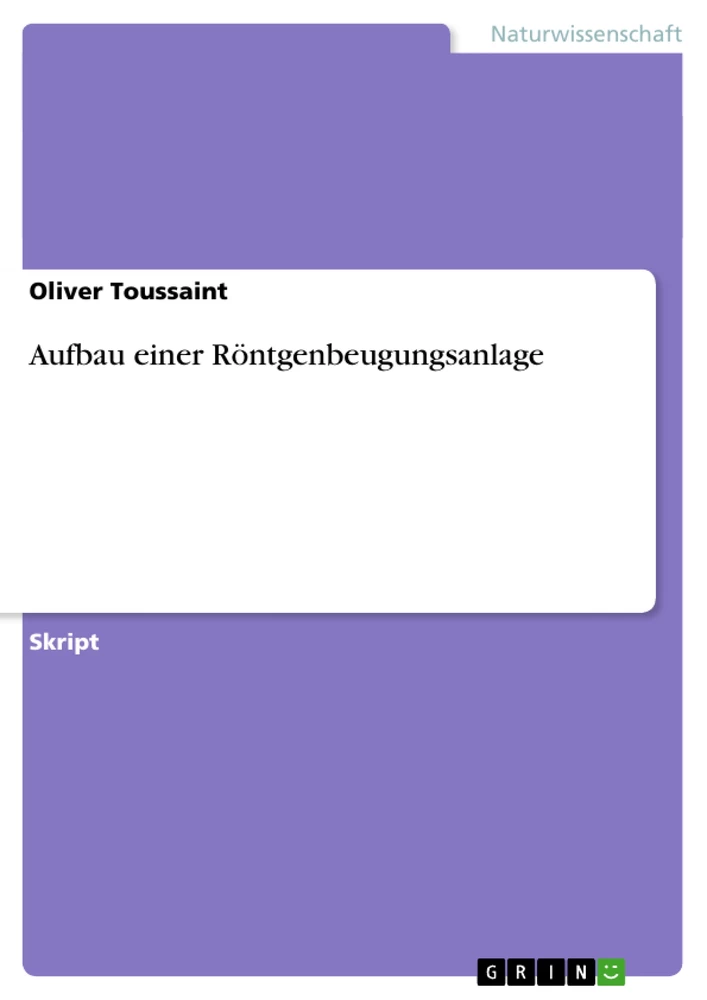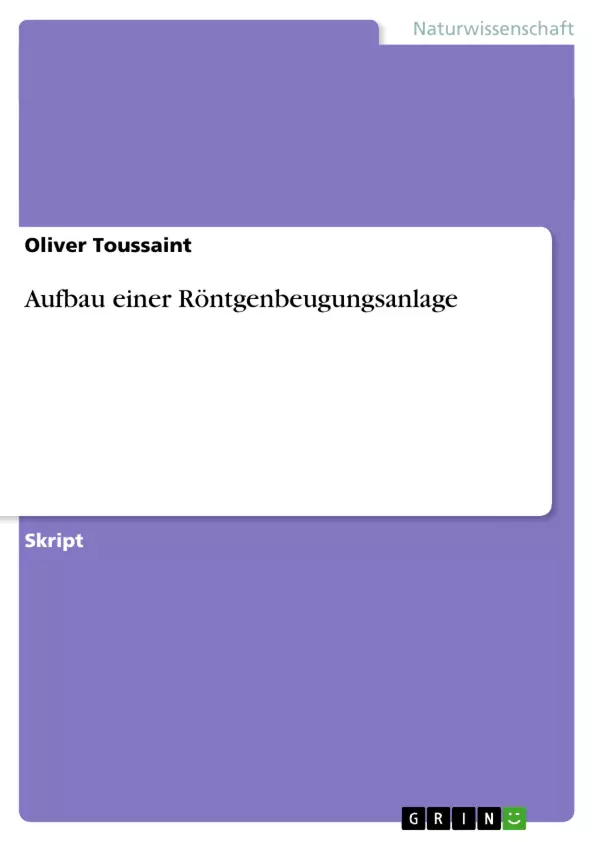1. Aufbau einer Röntgenbeugungsanlage
Zu einer Röntgenbeugungsanlage gehören unter anderem ein sog. Zählrohrgoniometer, zu dem eine Röntgenröhre, ein Probenhalter sowie ein Zählrohr integriert ist und die entsprechenden Energieversorgungs-, Steuerungs- und Aufzeichnungseinheiten.
1.1 Prinzipschaltbild
In der Röhre entsteht beim Aufprall schneller Elektronen auf die Anode Röntgenstrahlung, die vom Brennfleck ausgeht und die Röhre durch die Röhrenfenster verlässt. Die eigentliche Strahlenquelle hat eine Strichbreite von etwa 1 x 10 mm, bei Feinfokusröhren ist diese etwa 0,4 x 8 mm und weniger groß.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Röntgenapparatur im Prinzipschaubild
Die Bremsstrahlung bzw. das weiße Röntgenlicht ist der stets vorhandene Strahlungsanteil mit kontinuierlichem Spektrum und wird im wesentlichen nur für Laue-Aufnahmen benötigt. Die Wellenverteilung der Bremsstrahlung hängt von der Anodenspannung ab; bei steigender Spannung nimmt der Anteil der kürzeren Wellenlängen zu, die Strahlung wird „härter“. Die zur Feinstrukturuntersuchung meistens verwandte charakteristische K-Strahlung wird neben der Bremsstrahlung ausgestrahlt, sobald die Anodenspannung der Röhre die K-Anregungsspannung des Anodenmaterials überschreitet. Normalerweise wählt man die Anodenspannung etwa drei- bis viermal so hoch wie die Anregungsspannung. Die charakteristische K-Strahlung besteht aus mehreren Linien verschiedener Wellenlänge, von denen die wichtigsten die das Ka-Dublett bildenden a1- und a2-Linien sind. Falls man diese möglichst in reiner Form erhalten will, benutzt man zur bevorzugten Abschwächung der kurzwelligeren Kb-Linien einen Kb-Filter, dessen Anregungsspannung etwas niedriger ist als die des Anodenmaterials. Die Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstellung der Betriebsdaten für Feinfokusröhren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Betriebsdaten für Feinfokusröhren
In der Tabelle sieht man deutlich, wie mit zunehmender Ordnungszahl des Anodenmaterials die Anodenspannung U zunimmt. Gleichzeitig nimmt die ausgestrahlte Wellenlänge ab. Der zu verwendete Kb-Filter ist in der Regel um eine Ordnungszahl kleiner als das verwendete Anodenmaterial. Eine Ausnahme wird bei Molybdänanoden (Mo: Z=6) gemacht, wobei ein Kb-Filter aus Zirkon (Zr: Z=4) verwendet wird. Bei der Verwendung von Kb-Filtern wird also die Kb-Linie stärker geschwächt als die Ka-Linie und eine für viele Zwecke ausreichende Monochromatisierung erreicht, zumal auch das Bremsspektrum weitgehend absorbiert wird.
1.2 Strahlengang beim Zählrohrgoniometer
Das Zählrohrgonoimeter beruht auf der Fokussierung nach BRAGG-BRENTANO deren Prinzip nach Abbildung 2 veranschaulicht wird. Im Zentrum des durch Eintrittsblende bzw.
Röhrenfokus/Anodenbrennflecks A und Zählrohrblende Z gehenden Goniometerkreises/Meßkreises M steht die Probe P. Sie tangiert den durch A, Z und das Zentrum des Goniometerkreises M gehenden Fokussierungskreis F. Einfallender und gebeugter Strahl bilden den Glanzwinkel Q mit der Probenfläche P und den Winkel 2Q miteinander. Es werden also nur zur Probenoberfläche parallele Netzebenen zur BRAGGschen Reflexion zugelassen. Bei Fortbewegung des Zählrohrs längs des Meßkreises M muß die Probe mit der halben Winkelgeschwindigkeit in der gleichen Richtung gedreht werden, um die Fokussierungsbedingung einzuhalten. Dabei wird aber die Größe des Fokussierungskreises F stetig geändert, so dass es nicht möglich ist, durch Krümmung der Probe längs des Fokussierungskreises für einen bestimmten Glanzwinkel auch exakte Fokussierung für andere Glanzwinkel zu erzielen. Dabei bewegt sich der Mittelpunkt des Fokussierungskreises F entlang einer Geraden zwischen Anodenbrennfleck A und der Probe P.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2 Strahlengang in einem Zählrohrgonoimeter (schematisch)
1.3 Vor- und Nachteile des Goniometerverfahrens
Das Goniometerverfahren weist folgende Vorteile auf:
- Größere kompakte Präparate können gemessen werden. · Nahezu alle Reflexe werden erfaßt: (2Q: 7° - 165°).
- Linienlage auf 1...2’ genau bestimmbar.
- Die Intensitäten fallen als Zahlenwert genau an. Geometrische Korrekturen der ralativen Intensität sind möglich. I (Q) als Formel bekannt.
- Kb-Filter im reflektierten Strahlengang (Fluoreszens wird ausgefiltert). · Der Meßablauf ist bequem, schnell und automatisierbar.
- Sinnvolle Eingriffe während der Messung sind möglich, da das Ergebnis auf dem Linienschreiber stets beobachtbar sind.
Als Nachteile sind folgende bekannt:
- Es wird nur im Äquator des Reflexionskegelsgemessen. Textur und Gromkrorn sören => unterschiedliche Schwärzung.
- Die Justierung von Röhre und Goniometer ist aufwendig aber nur 1x beim Röhrenwechsel erforderlich.
- Keine “riesigen” Proben.
- Anlage teuer, (ca. 500.000 DM). Stabilisierung der elektrischen Röhrenversorgung und Meßelektronik für Detektor nötig.
2. Nachweis von Röntgenstrahlen
Zum Nachweis von Röntgenstrahlen wird Zählrohr verwendet. Dieser besteht aus einem dünnwandigem, mit Luft oder Gas gefüllten Metallzylinder von einigen Zentimetern Durchmesser. In der Zylinderachse verläuft ein gegen den Metallzylinder isolierter Metalldraht an der eine Spannung von 1 - 3 kV angelegt ist; meist ist der Draht als Anode geschaltet. In dem starken elektrischen Feld nahem dem sog. Zähldraht setzen die durch das ionisierende Teilchen erzeugten Elektronen durch Stoßionisation lawinenartig sekundärelektronen frei. Der dadurch verursachte Stromimpuls wird elektronisch verstärkt und registriert. In einem Szintillationszähler werden die in einem Szintillator durch Teilchen oder Photonen ausgelösten Lichtblitze mit einer Photozelle oder einem angekoppelten Photmultiplier elektronisch registriert. In der Regel ist für jede Teilchenart die Leichtausbeute dem Energieverlust im Szintillator proportional, so dass mit einem an den Szintillator angeschlossenen Szintillationsspektrometer das gesamte Energiespektrum der auf den Szintillator einfallenden Teilchen oder Photonen aufgenommen werden kann.
3. Durchführung von Absorptionsmessungen
Bei Absorptionsmessungen ist gefragt, wie stark ein Medium eine Strahlung absorbiert. Dabei ist die Intensität der Strahlung, d. h. die Strahlung, die hindurchgeht, abhängig von der Ordnungszahl Z, von der Dicke x und der Dichte r des verwendeten Absorbers, sowie von der verwendeten Wellenänge l der Strahlung => IAbs = f (Z, x, r, l) .
Das hier beim Versuch verwendete Anodenmaterial der Röntgenröhre ist Cu. Die Messung selbst wird an der (111) Netzebene eines Au-Präparats durchgeführt. Die verwendeten Absorber sind Al und Cu unterschiedlicher Dicke.
3.1 Vesuchsaufbau und Versuchsdurchführung
Zunächst wird eine dünne Goldfolie auf einem Glashalter befestigt und dieser wiederum an den Probenhalter des Goniometers. Aus dem Atomabstand aAu = 0,40786 nm erhält man einen (111)- Netzebenenabstand von :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus diesem Ergebnis erhält man mit n = 1 und l = 0,1542 nm nach der Bragg - Gleichung n l = 2 dhkl sinq :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Daraus ergibt sich ein Winkel q von 19,11 ° bzw. 2q = 38,22 °. Dieser Wert 2q sowie weitere Parameter, wie 2q-Bereich, Schrittweite, Schrittzahl usw. wird in den Rechner eingegeben (siehe Hupsi-Parameter Liste). Außerdem muß ein bestimmter Abstand von der Probenoberfläche zum Detektor exakt eingestellt sein, damit sich die Probenoberfläche auf dem Fokussierungskreis befindet. Dieser wird mit Hilfe einer Meßuhr eingestellt und dem Rechner ebenfalls mitgeteilt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Aufbau einer Röntgenbeugungsanlage?
Eine Röntgenbeugungsanlage besteht aus einem Zählrohrgoniometer, einer Röntgenröhre, einem Probenhalter, einem Zählrohr und den dazugehörigen Energieversorgungs-, Steuerungs- und Aufzeichnungseinheiten.
Wie funktioniert eine Röntgenröhre?
In der Röhre entsteht Röntgenstrahlung, wenn schnelle Elektronen auf die Anode treffen. Diese Strahlung wird vom Brennfleck abgegeben und verlässt die Röhre durch die Röhrenfenster. Die eigentliche Strahlenquelle hat eine Strichbreite von etwa 1 x 10 mm, bei Feinfokusröhren ist diese etwa 0,4 x 8 mm und weniger groß.
Was ist Bremsstrahlung?
Bremsstrahlung, auch als weißes Röntgenlicht bezeichnet, ist der stets vorhandene Strahlungsanteil mit einem kontinuierlichen Spektrum. Sie wird hauptsächlich für Laue-Aufnahmen verwendet. Die Wellenverteilung der Bremsstrahlung hängt von der Anodenspannung ab.
Was ist charakteristische K-Strahlung?
Die charakteristische K-Strahlung wird neben der Bremsstrahlung ausgestrahlt, sobald die Anodenspannung der Röhre die K-Anregungsspannung des Anodenmaterials überschreitet. Sie besteht aus mehreren Linien verschiedener Wellenlänge, wobei die wichtigsten die das Ka-Dublett bildenden a1- und a2-Linien sind.
Wozu dient ein Kb-Filter?
Ein Kb-Filter dient dazu, die kurzwelligeren Kb-Linien zu bevorzugen und abzuschwächen, um die charakteristische K-Strahlung in möglichst reiner Form zu erhalten. Die Anregungsspannung des Filters ist etwas niedriger als die des Anodenmaterials.
Was ist das Prinzip des Zählrohrgoniometers?
Das Zählrohrgoniometer basiert auf der Fokussierung nach BRAGG-BRENTANO. Die Probe tangiert den Fokussierungskreis, der durch den Anodenbrennfleck, die Zählrohrblende und das Zentrum des Goniometerkreises verläuft. Einfallender und gebeugter Strahl bilden den Glanzwinkel Q mit der Probenfläche und den Winkel 2Q miteinander.
Welche Vorteile hat das Goniometerverfahren?
Zu den Vorteilen gehören die Möglichkeit, größere Proben zu messen, die Erfassung nahezu aller Reflexe, die genaue Bestimmung der Linienlage, die Angabe der Intensitäten als Zahlenwerte, die Verwendung von Kb-Filtern und die Automatisierbarkeit des Messablaufs.
Welche Nachteile hat das Goniometerverfahren?
Zu den Nachteilen gehören die Messung nur im Äquator des Reflexionskegels, der Aufwand für die Justierung von Röhre und Goniometer, die Beschränkung der Probengröße und die hohen Kosten der Anlage.
Wie werden Röntgenstrahlen nachgewiesen?
Röntgenstrahlen werden mit Zählrohren oder Szintillationszählern nachgewiesen. Zählrohre bestehen aus einem mit Gas gefüllten Metallzylinder, in dem durch Ionisation erzeugte Elektronen Lawinenartig freigesetzt werden. Szintillationszähler nutzen Lichtblitze in einem Szintillator, die mit einer Photozelle oder einem Photomultiplier registriert werden.
Was wird bei Absorptionsmessungen untersucht?
Bei Absorptionsmessungen wird untersucht, wie stark ein Medium Strahlung absorbiert. Die Intensität der Strahlung hängt von der Ordnungszahl, der Dicke, der Dichte des Absorbers und der Wellenlänge der Strahlung ab: IAbs = f (Z, x, r, l) .
Wie werden Absorptionsmessungen durchgeführt?
Eine dünne Goldfolie wird auf einem Glashalter befestigt und am Probenhalter des Goniometers positioniert. Messungen werden zunächst ohne Absorber durchgeführt, dann mit Aluminiumabsorbern unterschiedlicher Dicke und schließlich mit einem Kupferabsorber.
- Arbeit zitieren
- Oliver Toussaint (Autor:in), 2001, Aufbau einer Röntgenbeugungsanlage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105012