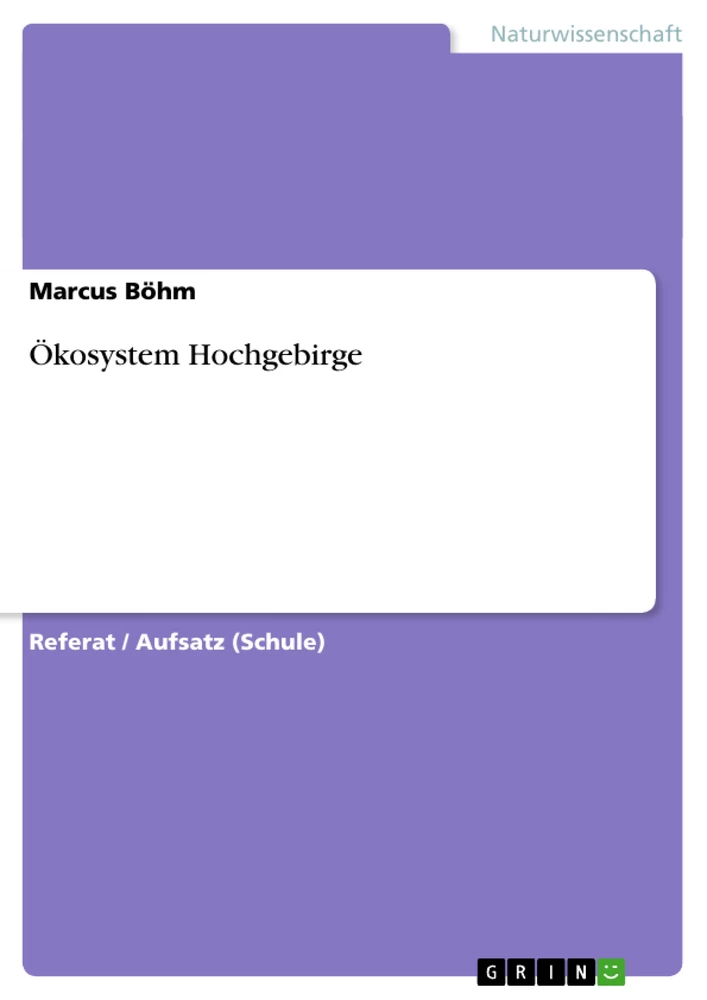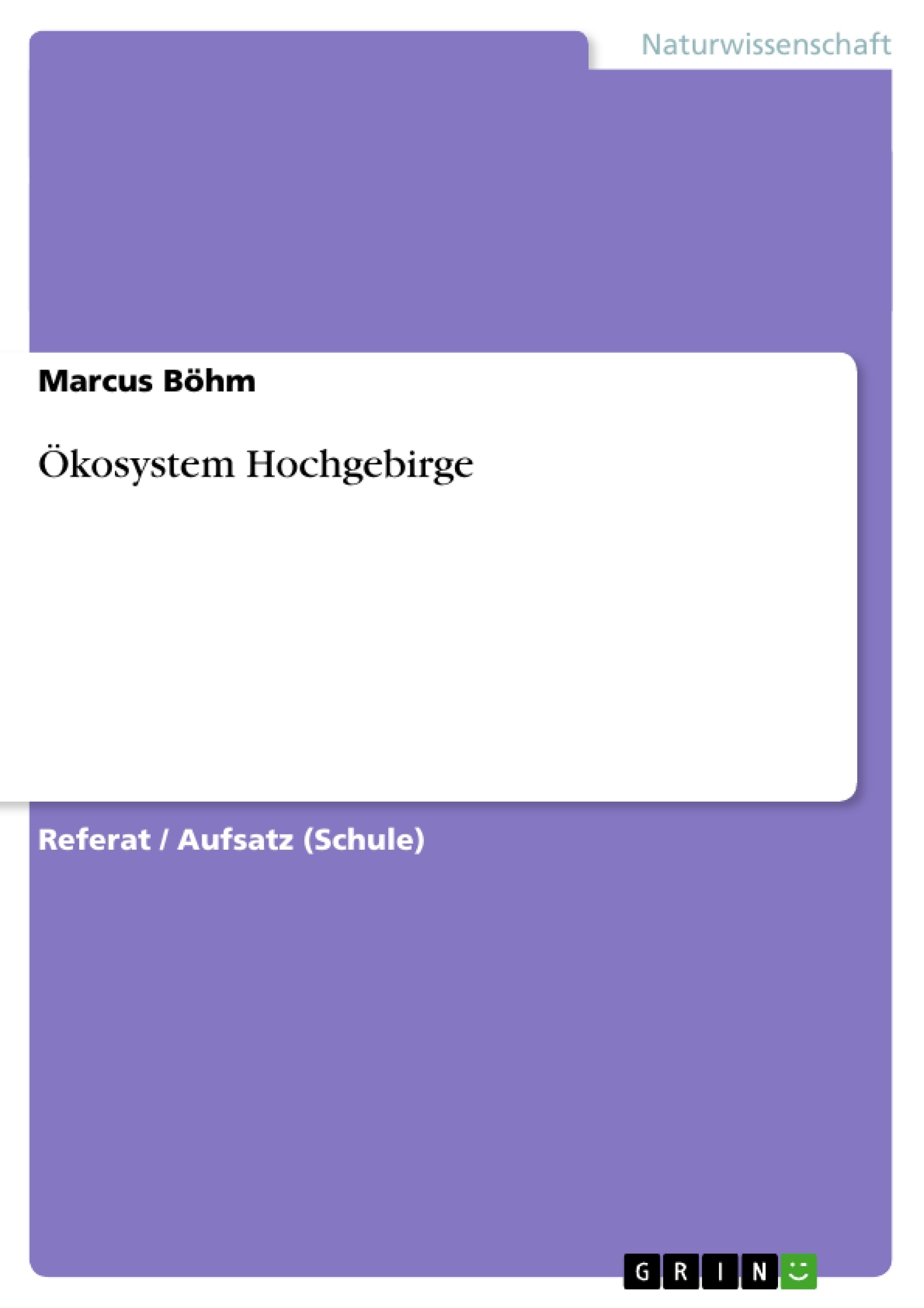Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Überleben zur Kunst wird, eine Welt, die von eisigen Winden und steilen Klippen geformt wurde: das Ökosystem Hochgebirge. Dieses Buch entführt Sie in eine faszinierende Welt extremer Bedingungen, in der Flora und Fauna einzigartige Strategien entwickelt haben, um den Herausforderungen des Lebens in der Höhe zu trotzen. Entdecken Sie die erstaunlichen Anpassungen der Pflanzen, von der dicken Epidermis zum Schutz vor UV-Strahlung bis hin zu weit verzweigten Wurzelsystemen, die sich in Felsspalten verankern. Erfahren Sie, wie Tiere wie Schneehase und Murmeltier mit dichtem Fell, speziellen Kreislaufsystemen und ausgeklügelten Tarnmechanismen den eisigen Temperaturen und der dünnen Luft trotzen. Tauchen Sie ein in die komplexen Zusammenhänge zwischen Klima, Bodenbeschaffenheit und den Lebensgemeinschaften, die diese einzigartige Umwelt prägen. Von den kargen Rohböden bis hin zu den tiefgründigen Alpenhumusböden – jeder Aspekt des Hochgebirges wird beleuchtet. Doch dieses sensible Ökosystem ist bedroht: Saure Regen, Schadstoffbelastung, der Bau von Forstwegen und die globale Erwärmung setzen ihm zu. Erkunden Sie die Auswirkungen der Gletscherschmelze, die Zunahme von Bergstürzen und die Veränderungen in Flora und Fauna. Dieses Buch ist ein Weckruf, ein Plädoyer für den Schutz dieser fragilen und doch so widerstandsfähigen Welt, in der das Leben an seine Grenzen geht. Eine fesselnde Reise in eine Welt der Extreme, die uns die Schönheit und Verletzlichkeit unserer Natur vor Augen führt, ein Muss für alle, die sich für Ökologie, Biologie und den Schutz unserer Bergwelten interessieren. Es ist eine Erkundung der Anpassungsfähigkeit des Lebens und eine Mahnung, die ökologischen Herausforderungen, denen sich diese einzigartigen Lebensräume stellen müssen, nicht zu ignorieren. Ein tiefgründiges Verständnis der Zusammenhänge im Hochgebirge ermöglicht es uns, die Notwendigkeit des Schutzes dieser besonderen Ökosysteme zu erkennen und zu handeln, bevor es zu spät ist. Lassen Sie sich von der Widerstandsfähigkeit der Natur inspirieren und werden Sie Teil der Bewegung, die sich für den Erhalt unserer Bergwelten einsetzt.
file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Wilhelm/Desktop/Neuer Ordner/k18960.html
Marcus Böhm
Referat
Ökosystem Hochgebirge
Hochgebirge:
Gebirge mit großen absoluten (über 1000/2000 m) und relativen (>1000m) Höhen, meist über die Baum- und sogar die Schneegrenze aufragend, mit schroffen, steilen Formen.
Klima:
extreme Wetterbedingungen und schneller Wetterwechsel
mit zunehmender Höhe: sinkt die Temperatur um 0,5°C pro 100m
nehmen die Windstärken zu
nimmt der Niederschlag zu und Luftfeuchtigkeit sinkt (ab gewisser Höhe sinkt jedoch auch wieder die Niederschlagsmenge)
steigt die Strahlungsintensität der Sonne sinkt die Sauerstoffkonzentration der Luft
Hangneigungen bestimmen: Einfallswinkel der Sonne (es entstehen Mikroklimate)
Windströmungen
Vegetationsfläche ,
odenarten und -vorkommen
Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens/ des Gesteins
Licht- und Schattenseiten der Berge bestimmen die Sonneneinstrahlungsdauer und somit die Zeit, die den Pflanzen für die Photosynthese zur Verfügnung steht
Flora ist jedoch Klimaabhängiger als Fauna, da sie Standortgebundener ist
Flora: - passt sich den Höhenstufen und dessen Klimate an Vegetationsstufen siehe Abbildung
file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Wilhelm/Desktop/Neuer Ordner/k18960.html
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anpassungsstrategien sind:
große Stoffwechselamplitude (von -8 bis 45°C)
dicke Epidermis und Pigmente (wegen UV-Strahlung)
dicke, schwer wasserdurchlässige Baumrinde (Frostschutz) großes, weites Wurzelwerk (wegen Boden/Gestein) Wasseraufnahme auch durch Blätter (Luftfeuchtigkeit) Vermehrung vegetativ und durch Selbstbestäubung (Wind) Rasenbildung (Windunanfälliger, Wasser/Lichtaufnahme) Kleinwuchs (Windunanfälligkeit)
geringer Nährstoffbedarf (aufgrund der armen Böden)
Fauna: - ist nicht an Vegetationsstufen gebunden, außer sie ist auf bestimmte Pflanzen spezialisiert
- jedoch auch mit zunehmender Höhe abnehmende Individuenzahlen
- sind im Gegensatz zu Flora stärker an Luftdruck gebunden (Atmung)
- gleicht in vielen Merkmalen der der Fauna in den polaren Landschaftsgürteln (Taiga, Tundra)
- doch genau wie Flora muss auch Fauna sich an Klimate anpassen
- Anpassung: starke Behaarung (Windschutz, UV-Schutz, Kälteschutz)
Hohle Haare (Isolation durch die Luftkammern)
dicke Haut (Isolationswirkung, UV-Schutz)
teilweise dunkle Haut (Wärmeaufnahme durch Sonne, UV-Schutz)
in der Schneezone weisses Fell (Tarnung, z.B. Schneehase, UV-Schutz) große Pfoten (in der Schneezone, gegen Absinken in den Schnee) Augenschutzhaut (bei Schneestürmen)
Blutkreislauf (abgekühltes Blut geht in Pfoten, um weitere Abkühlung zu meiden)
file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Wilhelm/Desktop/Neuer Ordner/k18960.html
Vertreter:
Schneehuhn, Schneehase, Alpenkrähen, Mauerläufer, Murmeltier
Böden:
da Hanglagen überwiegen sind Böden oft sehr flachgründig
selten feinkörnig, wegen Windabtragung
sowohl kalkhaltiges als auch kristallines, saures Silikatgestein
wichtig für Vegetation, da es kalkliebende Arten auf neutral-basischen wie als auch kalkfliehende, auf sauren Böden gibt
jedoch auch Wassergehalt ausschlaggebend: Grünerle (feucht) Latsche (trocken) überwiegend Rohböden vorhanden (Felsböden, Schuttböden) tiefgründige Böden in lokalen Verebnungen oder Senken
mit Höhe und steigender Humidität werden braune Waldböden zuerst lessiviert und dann zu nährstoffarmen, podsolierten Böden mit Rohhumusauflage (vor allem in Fichtenstufe)
mit Höhe sinkt Temp., damit auch Humusabbau kleiner als Humusbildung
somit in Hochlagen stärkere Ausbildung des Humushorizontes (Alpenhumusböden)
Probleme:
Schädigung der Bergwälder (60 % sind geschädigt, durch sauren Regen)
hohe Schadstoffkonzentration durch Industrie und Verkehr
Bau von Forst- und Almwegen, sowie Siedlungsvordringen bewirken Hanglabilitäten damit verstärkte Lawinengefahr
Erderwärmung bewirkt Gletscherschmelze, damit vermehrte Bergstürze, Änderung des Wasserhaushaltes und veränderte Flora und Fauna
Begriffserklärung:
Waldgrenze: Höhe, bis zu der geschlossene Baumbestände vordringen Baumgrenze: Höhe, bis zu der freistehende Bäume vordringen
Krüppelgrenze: vereinzelte Bäume dringen unter Schneeschutz oder an sonnenexponierten Felsen als langsam wachsende Zwerge noch höher vor Lessivierung: Bodenbildender Prozess der Tonverlagerung, Tonverarmung im Oberboden und Tonanreicherung im Unterboden. Geringe bis mäßige Versauerung des Bodens Podsol: Bleicherde, sauer, carbonatarm, sandig, vorwiegend in humiden Misch- und Nadelwaldgebieten. Tonzerstörung durch Versauerung, sehr nährstoffarm
file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Wilhelm/Desktop/Neuer Ordner/k18960.html
Quellen:
Das Leben der Berge (Artia Verlag); Bertelsmann Lexikathek;
Encarta ´98; Internet (www.lycos.de/Suche), daraus folgend: Ökologie der Erde; Lehrbuch der Botanik; Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen (Ulmer Verlag);
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Hochgebirge?
Ein Hochgebirge ist ein Gebirge mit großen absoluten (über 1000/2000 m) und relativen (>1000m) Höhen, das meist über die Baum- und sogar die Schneegrenze aufragt und schroffe, steile Formen aufweist.
Welche klimatischen Bedingungen herrschen im Hochgebirge?
Im Hochgebirge herrschen extreme Wetterbedingungen und schnelle Wetterwechsel. Mit zunehmender Höhe sinkt die Temperatur um 0,5°C pro 100m, die Windstärken nehmen zu, der Niederschlag nimmt zu (bis zu einer gewissen Höhe, ab der er wieder sinkt), die Luftfeuchtigkeit sinkt und die Strahlungsintensität der Sonne steigt. Die Sauerstoffkonzentration der Luft sinkt ebenfalls.
Welche Faktoren beeinflussen die Vegetation im Hochgebirge?
Die Hangneigung (Einfallswinkel der Sonne), Windströmungen, Vegetationsfläche, Bodenarten und -vorkommen, Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens/Gesteins, Licht- und Schattenseiten der Berge (Sonneneinstrahlungsdauer) beeinflussen die Vegetation. Die Flora ist stärker klimaabhängig als die Fauna, da sie standortgebundener ist.
Wie passt sich die Flora an die Bedingungen im Hochgebirge an?
Die Flora passt sich den Höhenstufen und deren Klimata an. Anpassungsstrategien sind: große Stoffwechselamplitude (von -8 bis 45°C), dicke Epidermis und Pigmente (wegen UV-Strahlung), dicke, schwer wasserdurchlässige Baumrinde (Frostschutz), großes, weites Wurzelwerk (wegen Boden/Gestein), Wasseraufnahme auch durch Blätter (Luftfeuchtigkeit), Vermehrung vegetativ und durch Selbstbestäubung (Wind), Rasenbildung (Windunanfälliger, Wasser/Lichtaufnahme), Kleinwuchs (Windunanfälligkeit) und geringer Nährstoffbedarf (aufgrund der armen Böden).
Wie passt sich die Fauna an die Bedingungen im Hochgebirge an?
Die Fauna ist nicht an Vegetationsstufen gebunden, es sei denn, sie ist auf bestimmte Pflanzen spezialisiert. Es gibt jedoch mit zunehmender Höhe abnehmende Individuenzahlen. Anpassungen sind: starke Behaarung (Windschutz, UV-Schutz, Kälteschutz), hohle Haare (Isolation durch die Luftkammern), dicke Haut (Isolationswirkung, UV-Schutz), teilweise dunkle Haut (Wärmeaufnahme durch Sonne, UV-Schutz), in der Schneezone weißes Fell (Tarnung, z.B. Schneehase, UV-Schutz), große Pfoten (in der Schneezone, gegen Absinken in den Schnee), Augenschutzhaut (bei Schneestürmen) und ein spezieller Blutkreislauf (abgekühltes Blut geht in Pfoten, um weitere Abkühlung zu meiden).
Welche Bodentypen findet man im Hochgebirge?
Aufgrund der Hanglagen sind die Böden oft sehr flachgründig und selten feinkörnig (wegen Windabtragung). Es gibt sowohl kalkhaltiges als auch kristallines, saures Silikatgestein. Überwiegend sind Rohböden vorhanden (Felsböden, Schuttböden), tiefgründige Böden finden sich in lokalen Verebnungen oder Senken. Mit der Höhe und steigender Humidität werden braune Waldböden zuerst lessiviert und dann zu nährstoffarmen, podsolierten Böden mit Rohhumusauflage (vor allem in der Fichtenstufe). In Hochlagen ist die Ausbildung des Humushorizontes stärker (Alpenhumusböden).
Welche Probleme gibt es im Ökosystem Hochgebirge?
Schädigung der Bergwälder (durch sauren Regen), hohe Schadstoffkonzentration durch Industrie und Verkehr, Bau von Forst- und Almwegen sowie Siedlungsvordringen (Hanglabilitäten, Lawinengefahr), Erderwärmung (Gletscherschmelze, Bergstürze, Änderung des Wasserhaushaltes, veränderte Flora und Fauna).
Was bedeuten die Begriffe Waldgrenze, Baumgrenze und Krüppelgrenze?
Waldgrenze: Höhe, bis zu der geschlossene Baumbestände vordringen. Baumgrenze: Höhe, bis zu der freistehende Bäume vordringen. Krüppelgrenze: vereinzelte Bäume dringen unter Schneeschutz oder an sonnenexponierten Felsen als langsam wachsende Zwerge noch höher vor.
Was bedeuten die Begriffe Lessivierung und Podsol?
Lessivierung: Bodenbildender Prozess der Tonverlagerung, Tonverarmung im Oberboden und Tonanreicherung im Unterboden. Geringe bis mäßige Versauerung des Bodens. Podsol: Bleicherde, sauer, carbonatarm, sandig, vorwiegend in humiden Misch- und Nadelwaldgebieten. Tonzerstörung durch Versauerung, sehr nährstoffarm.
- Citar trabajo
- Marcus Böhm (Autor), 2000, Ökosystem Hochgebirge, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104984