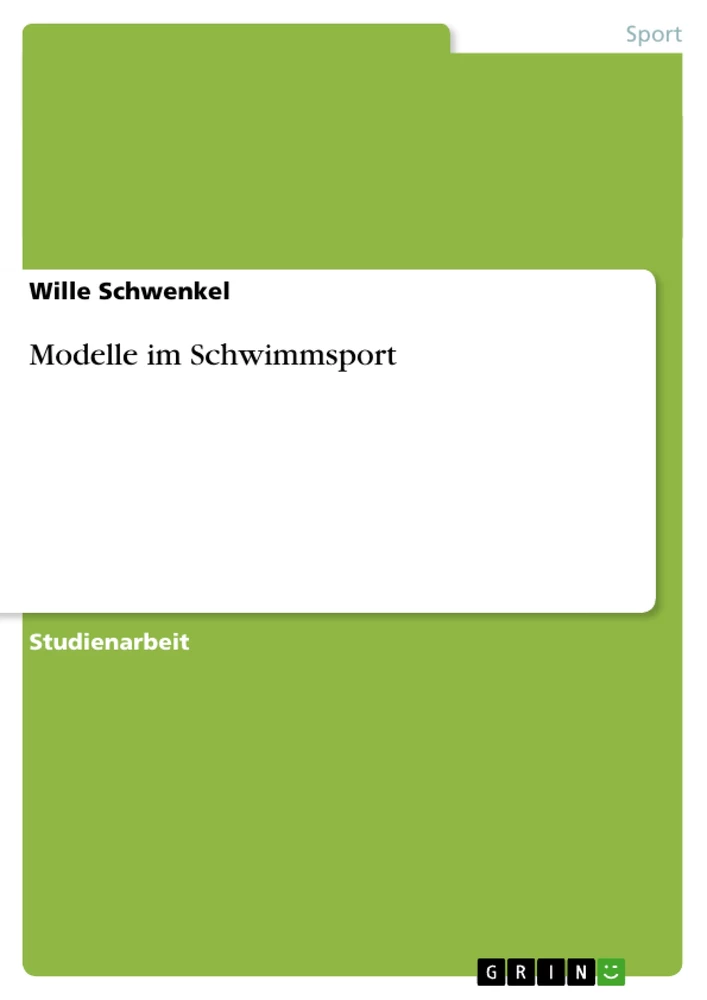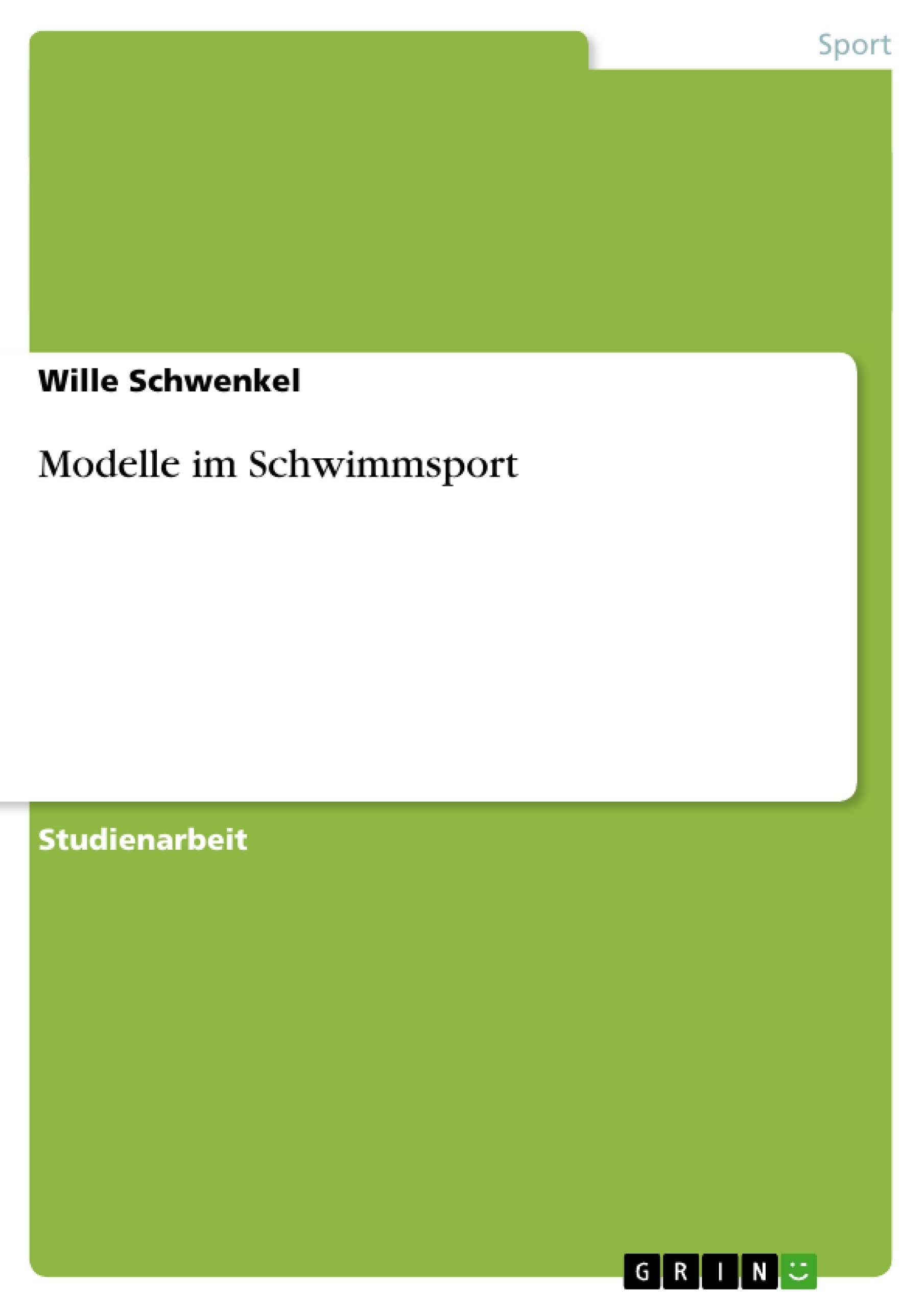Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
1. MOTORISCHE FERTIGKEITEN
2. THEORIE DES DSV (KURT WILKE)
INHALTE UND REIHENFOLGE DER ANFÄNGERSCHWIMMAUSBILDUNG DES DSV
3. ROTHS PRINZIPIEN
PRINZIP DER VERKÜRZUNG DER PROGRAMMLÄNGE
PRINZIP DER VERRINGERUNG DER PROGRAMMBREITE
PRINZIP DER PARAMETERVERÄNDERUNG
VORTEIL DER VEREINFACHUNGSSTRATEGIEN
SERIELLE ÜBUNGSREIHEN
FUNKTIONALE ÜBUNGSREIHEN
PROGRAMMIERTE ÜBUNGSREIHEN
4. GILDENHARDTS PRINZIP IEN
PRINZIP DER VIELSEITIGKEIT
PRINZIP DER GROBFORM
PRINZIP DER KOMBINATION
PRINZIP DER INTEGRATION
5. FAZIT:
6. PRAKTISCHE ANWENDUNG DIESER KONZEPTE (STUNDENAUSARBEITUNG EINER
ZWEISTÜNDIGEN UNTERRICHTSSTUNDE)
SERIELLE ÜBUNGSREIHE
STAFFEL ZUM PRINZIP DER VIELSEITIGKEIT:
STAFFEL ZUM PRINZIP DER KOMBINATION:
FUNKTIONELLE ÜBUNGSREIHE
7. LITERATURANGABEN
Einleitung
Im Laufe seiner Geschichte war der ‚Schwimmsport’ den unterschiedlichsten Veränderun- gen unterworfen. Mit Nicolaus Wynmann wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts das Schwimmen erstmals gesellschaftsfähig. Er setzte sich über die Vorurteile des Klerus und die vielen Badeverbote jener Zeit hinweg und veröffentlichte 1538 sein Lernbuch der Schwimmkunst unter dem lateinischen Titel „Colymbetes sive de arte natandi“. Nie zuvor hatte jemand ein so umfassendes und mit so großer Sachkenntnis erarbeitetes Fachbuch geschrieben. Das älteste und erste Schwimmlehrbuch der Welt war damit entstanden.
Dieser älteste Schwimmtheoretiker kannte neben den genannten Schwimmarten auch das Wassertreten, Fuß- und Kopfsprünge, Tauchen und das Rettungsschwimmen. Für den Anfängerunterricht empfahl er sogar Trockenschwimmübungen. Nach den Grundsätzen von Wynmann war das Schwimmen dennoch schwer zu erlernen, da seine Methode keine Gewohnheitsübungen enthielt und er ein Vertraut machen mit dem Wasser nicht forderte. Als beispielhaft ist anzusehen, dass er die Schwimmbewegungen nicht zergliederte, so wie es später noch oft geschehen sollte. Alle Schwimmbewegungen ließ Wynmann in ihrer Ganzheit ausführen.
In der Folgezeit verlor die Ganzheitlichkeit immer mehr an Bedeutung. Unter Ernst von Pfuel wurde 1817 das Schwimmen in die einzelnen Komponenten zerlegt. Das Zergliedern der Bewegungen, das laute Zählen der einzelnen Teile, eine bewusst geforderte straffe Ausführung der einzelnen Bewegungen ließen das Schwimmenlernen zu einem drillmäßi- gen, kasernenhofartigen Exerzitium werden.
Die Technik des Schwimmenlernens mit Schwimmapparaten hielt sich bis in die Anfänge des 20 Jahrhunderts. Noch vor ca. 80 Jahren war gültige Meinung, dass das Erlernen des Schwimmens sinnvoller zu Lande als zu Wasser geschehen sollte. Zu diesem Zwecke entwarf man Trockenschwimmmaschinen (siehe Abb. 1 und Abb.2), die die einzelnen Komponenten der jeweiligen Schwimmart erlernbar machen sollten. Diese Art des Vermit- telns wurde unter anderem gewählt, weil sie weniger gefährlich erschien und einheitliche Bewegungsmuster besser zu korrigieren waren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1 Schwimmapparate zu Beginn des 20. Jahrhunderts1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2 Apparat für Trockenschwimmkurse von Chevalier, Paris 18532
Heutzutage existiert ein grundlegend anderes Verständnis über das Vermitteln des Schwimmens. Da Schwimmen im Wasser und nicht zu Lande stattfindet, verlagerte man die Schwimmausbildung zunehmend zurück ins Wasser. Gleichzeitig veränderte sich auch die gesellschaftliche Stellung des Schwimmens und so wurde das Schwimmen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bereits fester Bestandteil des Schulsports. In den 70 er und 80 er Jahren entstanden verschiedene Konzepte zum Schwimmenlernen. In dieser Arbeit wollen wir 3 Konzepte, die sich als sinnvoll und praktisch erwiesen haben, vorstellen und erläutern. Es sei jedoch erwähnt, dass es nicht drei völlig unterschiedliche Theorien des Schwimmenlernens sind, sondern verschiedene Gewichtungen und Ausprägungen, die strukturell große Ähnlichkeiten aufweisen. Den Anfang dieser Konzepte macht die Theorie des Deutschen Schwimmverbandes, die ihren Schwerpunkt jedoch auf das Wett- kampfschwimmen legt. Dem gegenüber stellen wir die Konzeptionen Roths und Gilden- hardts.
Zu Beginn möchten wir jedoch noch theoretische Überlegungen zum Schwimmen anstel- len. Im folgenden Abschnitt wollen wir Schwimmen als eine geschlossene Sportart begreif- lich machen.
1. Motorische Fertigkeiten
Um eine geschlossene Sportart, wie zum Beispiel das Schwimmen zu beherrschen, muss der Sportler die vorgegebene Technik neu erlernen und so lange trainieren bis der Bewe- gungsablauf eine präzise Form angenommen hat. Danach erst durchläuft er die Stadien des Automatisierens und des Stabilisierens . Vorab sollte man an dieser Stelle den Unter- schied zwischen geschlossenen und offenen Fertigkeiten klären:
Geschlossene Fertigkeiten sind Fertigkeiten, bei deren Anwendung es auf eine festgeleg- te, möglichst stabile und Fehlerfreie Reproduktion ankommt. Dies ist vor allem in jenen Sportarten der Fall, die durch weitgehend Vorhersehbare und konstante (sogenannte ge- schlossene) Ausführungsbedingungen gekennzeichnet sind. Dem Sportler werden sozu- sagen „Fragen“ gestellt, die dieser mit vorgefertigten Lösungen beantworten kann. Zu er- lernen sind genormte Grundfertigkeiten, die stets in der gleichen Form präzise zu wieder- holen sind. Der Weg der Vermittlung beinhaltet Prozesse des Neulernens, des Automati- sierens und des Stabilisierens von Bewegungsformen.
Offenen Fertigkeiten sind dadurch gekennzeichnet, dass sich einzelnen Bewegungspara- meter nicht vorab festlegen lassen, da Variationen im Umfeld ständige Neuanpassungen der Fertigkeiten erfordern. Der Sportler muss auf variable, rasch wechselnde und nur schwer vorhersehbare Situationen reagieren, dass heißt er muss ebenfalls die Grundtech- niken beherrschen, aber noch dazu auch in der Lage sein dies in wechselnden Situationen anzuwenden. Neben dem Neulernen und Automatisieren rücken damit das Variations- und Anwendungstraining in den Vordergrund.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Theorie des DSV (KURT WILKE)
Bei der Anfängerschwimmausbildung, wie sie KURT WILKE beschreibt, fällt zunächst einmal auf, dass die gesamte Ausbildung „im“ Wasser stattfindet und nicht außerhalb. Wie bereits in der Einleitung geschildert wurde, war dies vor nur wenigen Jahrzehnten noch völlig an- ders. Deshalb erscheint es mir wichtig, dieser aus heutiger Sicht eher unscheinbaren Tat- sache eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Wilkes Theorie des Schwimmenlernens liegt die Überzeugung zugrunde, dass Schwimmsport den Menschen lebenslang berei- chern kann und er ein sehr breitgestreutes Betätigungsfeld in ihm finden kann. Die Verbin- dung seines Konzepts mit der Philosophie des DSV, dessen Ziel es ist, gute Wettkampf- schwimmer hervorzubringen, wird deutlich, wenn er von der „Qualität der späteren schwimmsportlichen Bewegungsabläufe“ spricht.3 Wilke, der früher selber deutscher Hochschulmeister im Schwimmen war, weiß natürlich, dass am Ende einer Schwimmaus- bildung ein guter Schwimmer bzw. Wettkampfschwimmer stehen soll. Natürlich kann nicht jeder, der diese Art von Anfängerschwimmausbildung durchläuft ein guter Wettkampf- schwimmer werden. Trotzdem ist es auffällig, dass Wilke diese Qualität der Bewegung von der er spricht, besonders am Herzen liegt, und sein Verständnis von Schwimmenlernen deshalb häufig mit dem Wettkampfsport in Verbindung gebracht wird. Gerade weil er un- terschwellig dieses eher wettkampforientierte Ziel verfolgt, ist es um so erstaunlicher, dass er gegen eine frühe Spezialisierung in der frühen Ausbildung ist und dem Lernenden ge- nügend Zeit und Möglichkeit gibt, neue Bewegungen im und am Element Wasser zu ma- chen. Genau diese Tatsache macht seine Konzeption wiederum so wertvoll für den Schul- sport. Wenngleich wir im Schulsport meist die Zeit zu einer Schwimmausbildung, wie sie Wilke proklamiert nicht haben, so ist sie für den Sportlehrer doch ein geeignetes Mittel, seine Schwimmausbildung mit Schülern zu strukturieren.
[...]
1 Pahncke. 1979. S. 104
2 Pahncke, 1979. S.104
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung des Textes?
Die Einleitung beschreibt die historische Entwicklung des Schwimmsports, beginnend mit Nicolaus Wynmann und seinem Schwimmlehrbuch "Colymbetes sive de arte natandi". Sie beleuchtet, wie sich die Methodik des Schwimmenlernens im Laufe der Zeit von ganzheitlichen Ansätzen zu zergliederten Techniken und dem Einsatz von Trockenschwimmmaschinen entwickelt hat. Heutzutage wird das Schwimmenlernen wieder mehr ins Wasser verlagert. Die Arbeit stellt drei Konzepte zum Schwimmenlernen vor, die sich als sinnvoll erwiesen haben: die Theorie des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) sowie die Konzeptionen von Roth und Gildenhardt.
Was wird im Abschnitt "Motorische Fertigkeiten" behandelt?
Dieser Abschnitt behandelt die Unterscheidung zwischen geschlossenen und offenen Fertigkeiten im Sport. Geschlossene Fertigkeiten erfordern eine stabile und fehlerfreie Reproduktion von Bewegungsabläufen, während offene Fertigkeiten ständige Neuanpassungen an variable Umgebungsbedingungen erfordern. Schwimmen wird als eine geschlossene Sportart betrachtet, bei der die Technik zunächst neu erlernt, automatisiert und stabilisiert werden muss.
Was sind die Hauptpunkte der Theorie des DSV (Kurt Wilke)?
Die Theorie des DSV nach Kurt Wilke legt Wert darauf, dass die Anfängerschwimmausbildung vollständig im Wasser stattfindet. Wilke betont, dass Schwimmen den Menschen lebenslang bereichern kann und dass die Qualität der späteren schwimmsportlichen Bewegungsabläufe wichtig ist. Er spricht sich gegen eine frühe Spezialisierung aus und plädiert dafür, dass die Lernenden ausreichend Zeit haben sollen, neue Bewegungen im und am Element Wasser zu machen. Sein Konzept eignet sich gut, um die Schwimmausbildung im Schulsport zu strukturieren, auch wenn dort oft nicht genug Zeit für eine umfassende Ausbildung zur Verfügung steht.
Welche weiteren Konzepte zum Schwimmenlernen werden erwähnt?
Neben der Theorie des DSV werden die Konzeptionen von Roth und Gildenhardt als weitere sinnvolle und praktische Konzepte zum Schwimmenlernen erwähnt.
Was beinhalten Roths Prinzipien?
Roths Prinzipien umfassen das Prinzip der Verkürzung der Programmlänge, das Prinzip der Verringerung der Programmbreite und das Prinzip der Parameterveränderung. Diese Strategien zielen darauf ab, den Lernprozess zu vereinfachen und effektiver zu gestalten.
Welche Prinzipien werden Gildenhardt zugeschrieben?
Gildenhardts Prinzipien umfassen das Prinzip der Vielseitigkeit, das Prinzip der Grobform, das Prinzip der Kombination und das Prinzip der Integration.
Gibt es einen praktischen Teil im Text?
Ja, der Text beinhaltet die Ausarbeitung einer zweistündigen Unterrichtsstunde mit praktischen Beispielen für serielle und funktionelle Übungsreihen sowie Staffeln zur Anwendung der Prinzipien der Vielseitigkeit und Kombination.
Wo finde ich die Literaturangaben?
Am Ende des Textes befindet sich ein Abschnitt mit Literaturangaben.
- Citation du texte
- Wille Schwenkel (Auteur), 2000, Modelle im Schwimmsport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104785