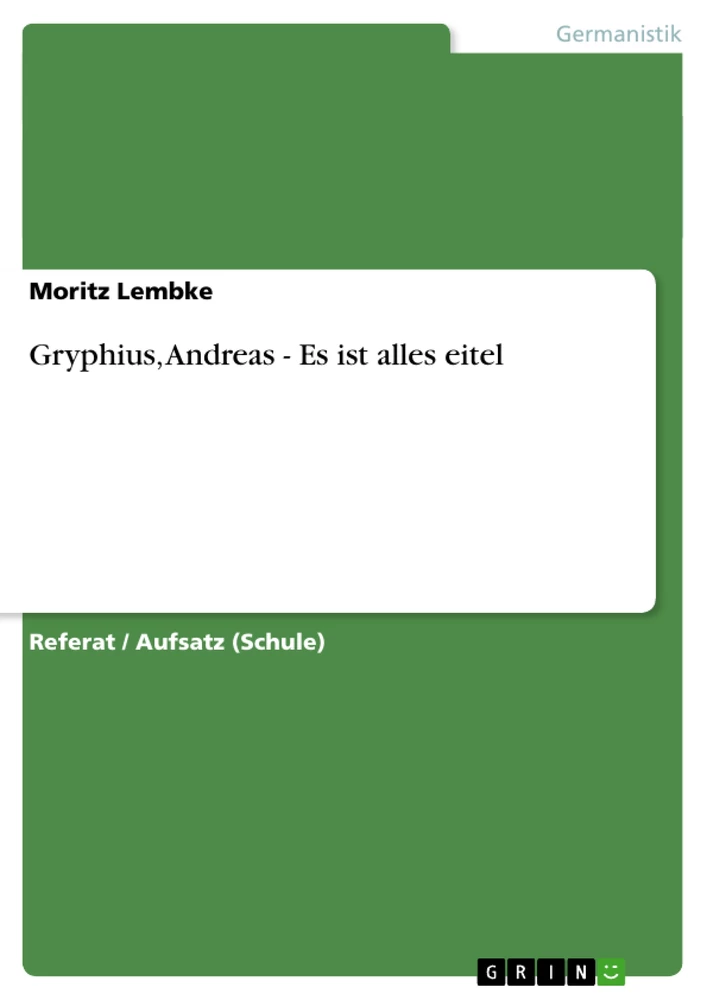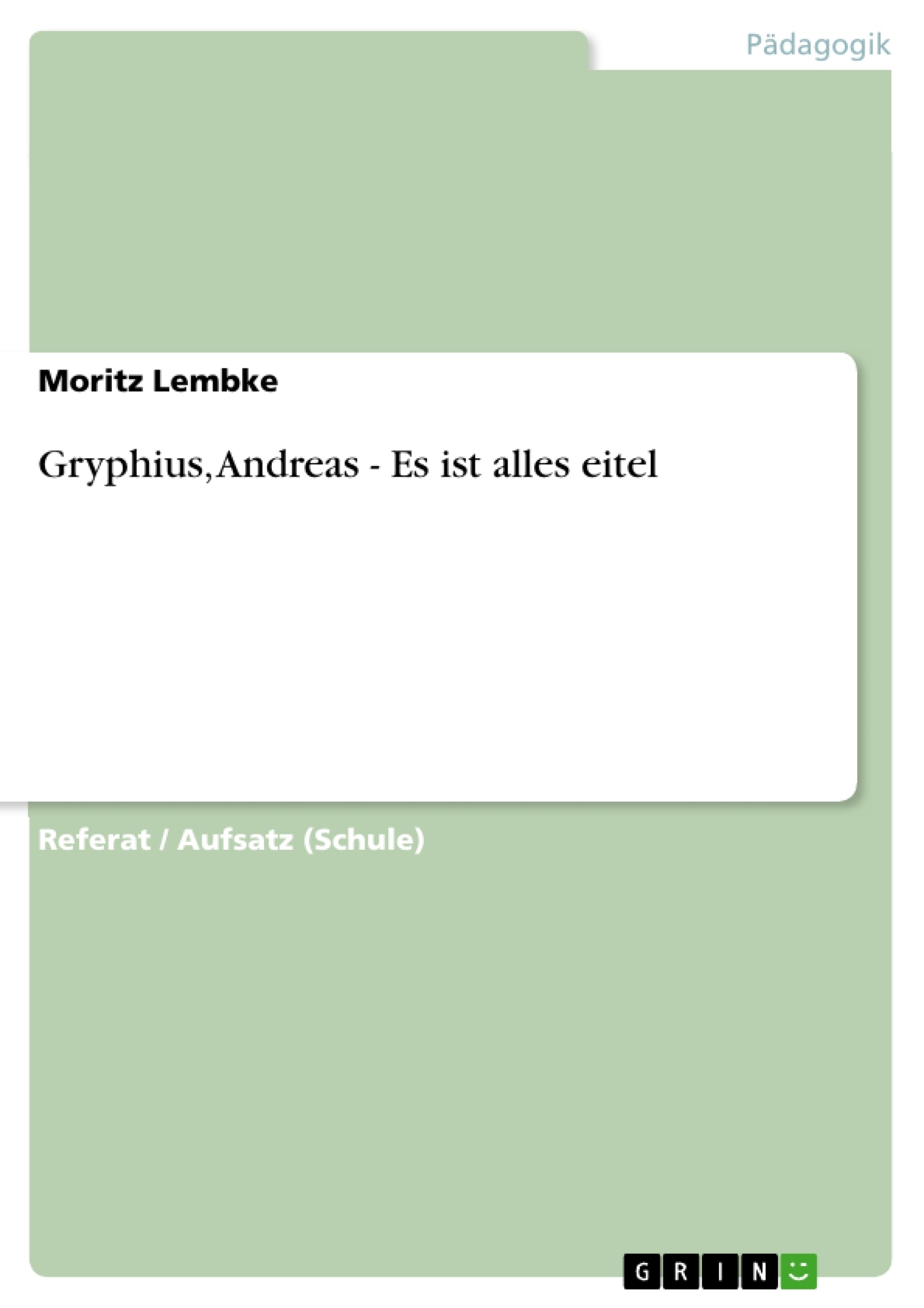Analyse und Interpretation des Gedichts
„Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius
Das Gedicht „Es ist alles eitel“ wurde 1637 (beziehungsweise in der vorliegenden veränderten Fassung 1663) von Andreas Gryphius geschrieben. Der Sohn eines lutherischen Pastors beschäftigt sich in diesem Gedicht mit der Vergänglichkeit und der dazu im Gegensatz stehenden Ewigkeit, also mit zwei durchaus für die Epoche des Barocks üblichen Themenkomplexen.
Es handelt sich bei dem Gedicht um ein typisches Sonett: Während die ersten beiden Strophen vier Zeilen beinhalten, sind die letzten beiden Strophen dreizeilig.
Die beiden Quartette sind in einem umarmenden Reim (a-b-b-a) geschrieben und die beiden Terzette bilden einen Schweifreim (c-c-d und e-e-d). Beim Rhythmus handelt es sich um einen sechshebigen Jambus mit Mittelzäsur in den Zeilen 1-3, 5-8 und ab Zeile 10. Diese Zweiteilung nach der dritten Hebung nennt man Alexandriner.
Die Verse a, c und d enden mit einer weiblichen Kadenz, wohingegen die Verse b und e mit einer männlichen enden.
Schon der Titel lohnt, näher betrachtet zu werden. So ist das Wort „eitel“ anders zu verstehen als es heutzutage üblich ist:
wird es doch meist mit dem Begriff „eingebildet“ umschrieben. Mit genauer Kenntnis der Bibel (über die Gryphius ohne Frage verfügte) lassen sich diesem Wort noch mehr Eigenschaften zuschreiben. So heißt es in dem Prediger Salomo (Kapitel 1, Vers 2), dass „eitel“ unnütz, falsch, vergeblich, leer, nichtig und eingebildet ist. Vor allem in den Worten „nichtig“ und „vergeblich“ erkennt man das Problem der Vergänglichkeit, welches ja auch hier beschrieben werden soll.
Mit Beginn des ersten Verses bezieht das lyrische Ich den Leser unmittelbar in seine Anschauungen mit ein. Dies geschieht mit der Correctio „Du siehst, wohin du siehst...“ (Z.1), die den Leser persönlich anspricht und ihm den ersten Blick erweitert, indem er ihn nicht nur auf die unmittelbare Umgebung lenkt, sondern die Vergänglichkeit, die allgegenwärtig ist betrachten lässt. Dass es sich nur um eine Vergänglichkeit allem Irdischen handelt, betont der Autor mit dem Ende des ersten Verses: „...auf Erden.“ (Z.1).
In den Versen zwei bis neun kommt es nun zu antithetischen Beispielhäufungen, die vor allem in den Versen zwei und drei, sowie fünf, sechs und acht parallel aufgebaut sind: Jeweils vor der Zäsur spricht Gryphius von etwas Gegenwärtigem, welches, nach der Zäsur, in der Zukunft nicht mehr sein wird. Dies wird von Vers zu Vers weiter gesteigert. So handelt es sich zunächst noch um materielle Dinge [„Was dieser heute baut,“ (Z.2)], beschäftigt sich daraufhin mit der unbelebten [„...Städte...“(Z.3)] und belebten [„...prächtig blüht,“(Z.5)] Natur und findet schließlich seinen Abschluss beim Menschen [„Was .. so pocht und trotzt,“(Z.6)]. All diese Dinge vergehen. So „reißt jener morgen ein,“ (Z.2), was vorher gebaut wurde, so „wird eine Wiesen sein,“ (Z.3), wo vorher die Stadt stand, so wird auch „..bald zertreten werden.“, was vorher blühte und also wird auch der Mensch „..morgen Asch und Bein.“ (Z.6) sein. All dieser Vergänglichkeit der ersten Strophe steht im letzten Vers der selbigen „...ein Schäferskind...“ (Z.4), welches „...spielen...“ (Z.4) wird gegenüber. Aus der Zerstörung entsteht also wieder Neues, in diesem Fall eine Idylle, die durch das Schäferskind symbolisiert wird. Es erscheint zunächst so, als würde die pessimistische Grundstimmung des ersten Verses umschlagen, doch diese Vorstellung wird mit dem nächsten Quartett zunichte gemacht (wie auch schon teilweise zitiert).
In Vers sieben zeigt der Verfasser sogar die Vergänglichkeit der Dinge auf, die für uns ewig erscheinen: „...Erz...“ und „...Marmorstein.“ (Z.7).
In Vers zehn wird die Aufzählung von Beispielen und der daraus resultierende Gleichklang durch einen Satz, der im Konjunktiv steht plötzlich unterbrochen: „Sollt denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?“ (Z.10). Gryphius tritt dieser Frage, der eventuellen Möglichkeit der Unsterblichkeit des Menschen mit äußerst merklicher Skepsis entgegen.
Der elfte Vers, der mit der Unmut äußernden Interjektion „Ach,“ (Z.11) beginnt, wird versübergreifend auf die zwölfte und 13. Zeile bezogen. Er kritisiert, dass die Menschen nur mit ihrer Gegenwart beschäftigt sind und führt gleichzeitig wieder deren Vergänglichkeit anhand der Klimax „...Schatten, Staub und Wind,“ (Z.12) und dem Bild der Wiesenblume, als Repräsentant des Lebens, „die man nicht wiederfind’t.“ (Z.13) auf.
Mit dem letzten Vers stellt Gryphius abschließend eine wesentliche Tatsache dar, die man als Appell interpretieren könnte: „Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten.“ (Z.14). Dieser Vers verdeutlicht abermals, dass Menschen fast ausschließlich mit vergänglichen Dingen und ihrer unmittelbaren Gegenwart beschäftigt sind. Diese letzte Zeile steht im Einklang zu der ersten, bestätigt diese und bringt gleichzeitig die religiöse Ebene in den Anschauungsbereich. Der eben erwähnte Appell könnte also die indirekte Aufforderung sein, im Glauben an Gott die Rettung, in welcher Form auch immer, zu finden.
Gryphius Gedicht lässt sich relativ problemlos auf die Gegenwart beziehen. Gerade in einer Konsumgesellschaft, wie der unserigen, spielen Dinge, die bei näherer Betrachtung so vergänglich sind eine große Rolle. Auch wenn ich nicht der Meinung bin, die Lösung dieses Problems bei Gott zu suchen, stimme ich dem Autor in seiner indirekten Aufforderung der Betrachtung der Dinge, die ewig währen zu. Man sollte sich bemühen, weniger auf materielle Dinge zu achten, sondern im Gegenzug geistige und philosophische Grundsätze sich selbst zu erarbeiten, um diese vielleicht verstehen zu können.