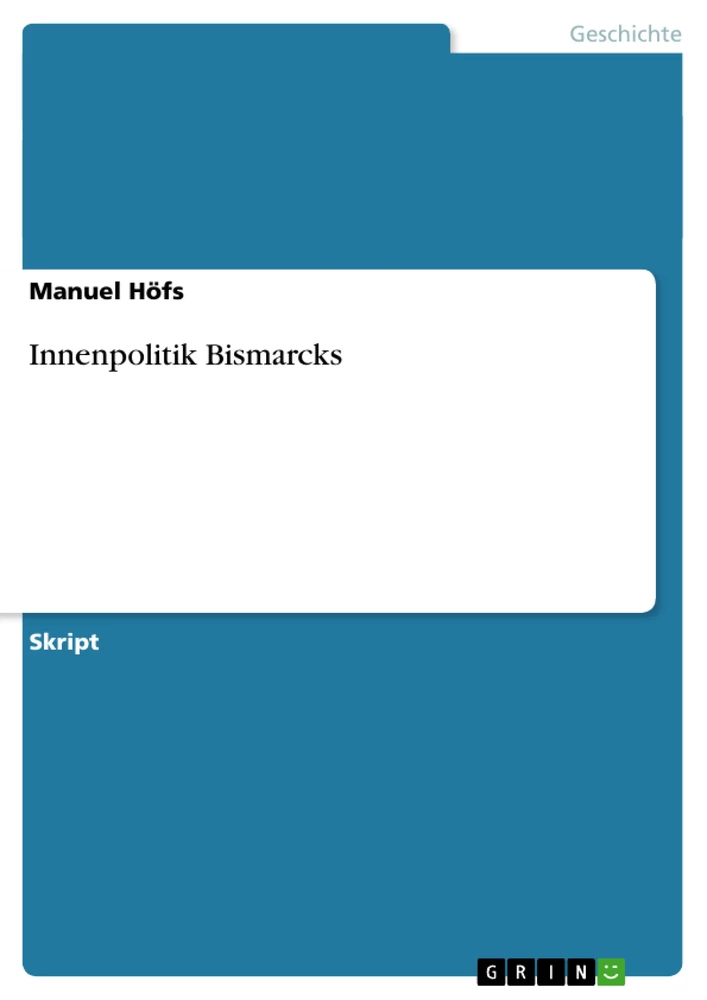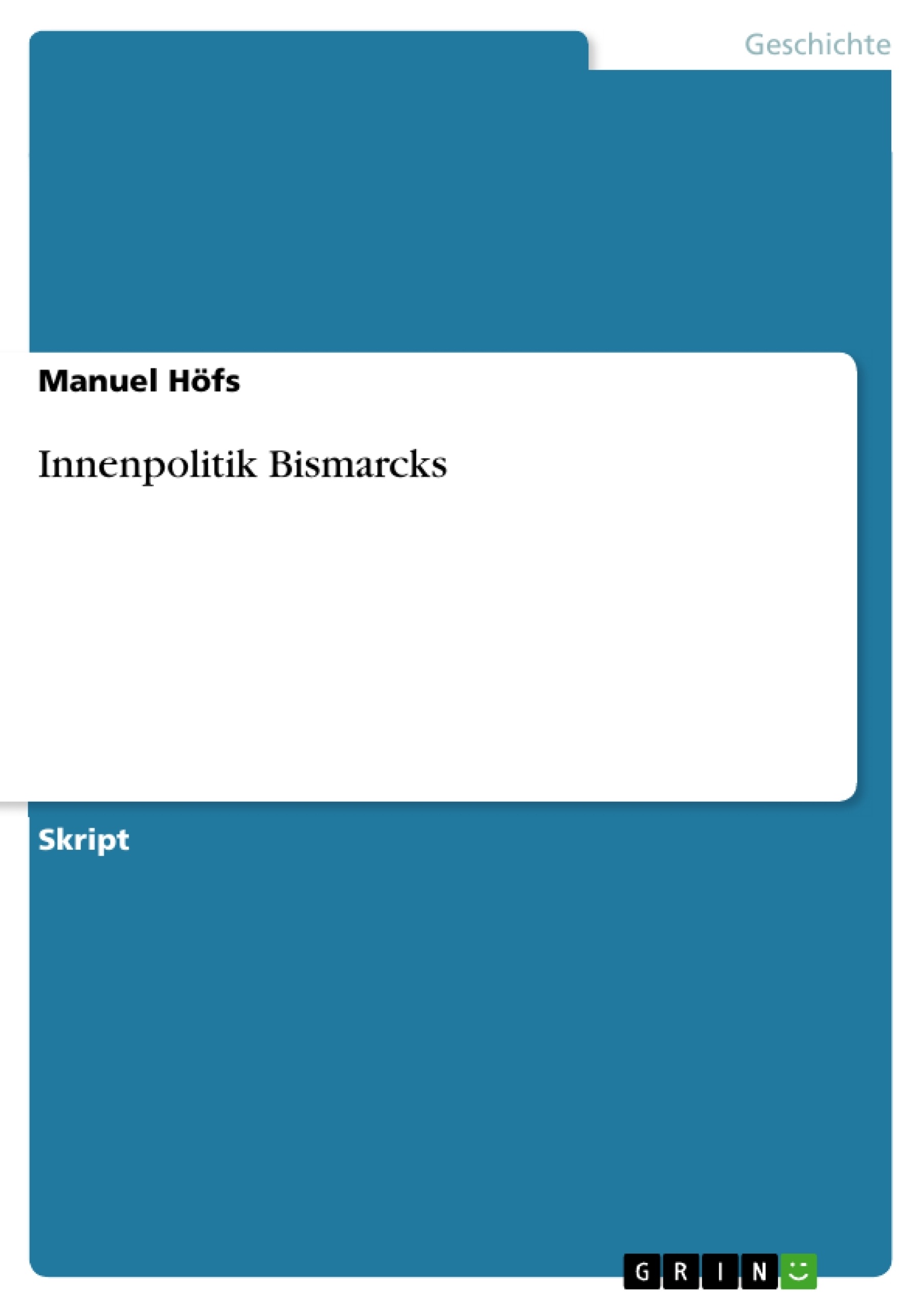Deutschland im Zeitalter Bismarcks: Eine Ära der Einheit, aber auch der inneren Zerrissenheit. Entdecken Sie in dieser packenden Analyse die Widersprüche und Ambivalenzen des Deutschen Kaiserreichs unter Otto von Bismarck, dem „eisernen Kanzler“. War er ein genialer Staatsmann, der Deutschland zu Größe führte, oder ein autoritärer Machtmensch, der die Saat für spätere Katastrophen säte? Tauchen Sie ein in eine Zeit des Umbruchs, in der sich das moderne Deutschland formte, und erleben Sie die politischen Schlachten, die Bismarck mit Liberalen, Katholiken und Sozialisten ausfocht. Der Kulturkampf gegen die katholische Kirche, die Sozialistengesetze und die Einführung der Sozialversicherung – diese Meilensteine der deutschen Geschichte werden neu beleuchtet und auf ihre langfristigen Auswirkungen hin untersucht. Erfahren Sie, wie Bismarcks Innenpolitik die deutsche Gesellschaft spaltete und die Entstehung einer echten Demokratie verhinderte. Analysiert werden die gesellschaftlichen Auswirkungen der Ära Bismarck, um zu einer kritischen Beurteilung dieser Politik zu gelangen. Bismarcks Aufstieg vom reaktionären preußischen Politiker zum Reichskanzler wird ebenso beleuchtet wie die Parteienlandschaft seiner Zeit, von den Konservativen bis zu den Sozialdemokraten. Ein besonderes Augenmerk gilt der wirtschaftlichen Entwicklung des Kaiserreichs, vom Gründerboom bis zur protektionistischen Wende. Diese tiefgründige Analyse bietet neue Einblicke in die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts und regt zur Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der deutschen Nationalstaatsgründung an. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die verstehen wollen, wie Bismarck Deutschland geprägt hat – im Guten wie im Schlechten. War Bismarck wirklich der Architekt des Deutschen Reiches, oder eher ein Brandstifter, der ungewollt den Weg für kommende Konflikte bereitete? Die Antwort erwartet Sie in diesem Buch, das historische Fakten mit spannenden Interpretationen verbindet und neue Perspektiven auf eine Epoche eröffnet, die bis heute nachwirkt. Erleben Sie die dramatischen Wendungen und unerwarteten Konsequenzen einer Politik, die Deutschland für immer verändern sollte.
1. Einleitung:
„Es wurde durch (diese) Maßnahmen Bismarcks verhinderte, daß es zur Bildung einer großen liberalen Partei in Deutschland kam, namentlich hier im westlichen Teil, denn hier war an sich eine liberale Gesinnung. Daß sie hier nicht zum Zuge kam, ist nach meiner Meinung zum großen Teil auf den Kulturkampf und auf die Sozialistengesetze zurückzuführen ... Bismarck war ein großer Außenpolitiker und ein sehr schlechter Innenpolitiker“ (Adenauer zitiert nach Schwarzmüller 1998, S.121).
Wer immer sich historisch mit Otto von Bismarck beschäftigt, sieht sich konfrontiert mit der Ambivalenz und Dialektik der deutschen Geschichte (vgl. Stürmer 1987, S.104). Betrachten einige Historiker Bismarck retrospektiv als Vorläufer und Wegbereiter eines nationalsozialistischen Deutschlands, so heben andere Geschichtswissenschaftler auf die ausgeklügelte Bismarcksche Außenpolitik ab, welche dem Deutschen Reich eine wichtige, aber für das europäische Ausland berechenbare diplomatische Mittlerposition zudachte. Mit außenpolitischem Geschick gelang es dem aus Schönhausen stammenden Reichskanzler, Deutschland über strategische Bündnisse und fragile Absicherungen aus einem europäischen Großkrieg herauszuhalten.
Für die deutsche Geschichtsschreibung gilt Bismarck vor allem als der Begründer der deutschen Staatsnation. Mit Blut und Eisen einte er in drei kriegerischen Auseinandersetzungen (1864, 1866, 1870/71) die deutschen Länder zu einem kleindeutschen Reich unter der Führung Preußens. Dieser militärische und politische Erfolg machte Bismarck bereits zu Lebzeiten zu einer Art Legende. Die Reichsgründung wirkte sich einerseits nachhaltig auf das europäische Mächtesystem aus, andererseits strahlte das nationale Pathos vor allem auf die deutsche Innenpolitik aus (vgl. Schwarzmüller 1998, S.97f.).
In fast allen Quellen, die diesem Exposé als Grundlage dienen, spielt dagegen die Innenpolitik Bismarcks nur eine untergeordnete Rolle, sie wird bisweilen nur am Rande skizziert (vgl. Görtemaker 1989). Dabei hat sich gerade die Innenpolitik Bismarcks nachhaltig auf das Verhältnis des Bürgertums, des Katholizismus und der Arbeiterschaft zur deutschen Nation ausgewirkt. In den folgenden Ausführungen sollen insbesondere diese spannungsreichen gesellschaftlichen und sozialpolitischen Auswirkungen der Ära Bismarck dargestellt werden, um dann zu einer abschließenden kritischen Beurteilung dieser Politik zu kommen.
2. Der Aufstieg Bismarcks zum Reichskanzler
Bereits zur Zeit der Revolution von 1848/49 tat sich Bismarck als reaktionärer preußisch-monarchistisch geprägter Politiker hervor, der sich vehement gegen jegliche Liberalisierungstendenzen im Deutschen Bund stemmte, hervor (vgl. Stürmer 1987, S.43). Da Bismarck als Einzelgänger galt und noch wenig politisches Gewicht besaß, wurde er 1859 zum Gesandten in Sankt Petersburg ernannt. Dort sammelte er wichtige diplomatische Erfahrungen und konnte unmittelbar vor Ort Einblick gewinnen in die russische Politik. 1862 wird er zum Gesandten in Paris ernannt. Noch ehe er sich dort richtig eingearbeitet hatte, ruft ihn Kaiser Wilhelm I. auf dem Höhepunkt des Verfassungskonfliktes als Ministerpräsident und Minister des Auswärtigen nach Preußen (23.9.). In dem Verfassungskonflikt ging es um die Umstrukturierung des preußischen Heeres; die Regierung forderte die Verlängerung des Wehrdienstes von zwei auf drei Jahre sowie eine Verstärkung der vom königstreuen adligen Offizierskorps geführten Heeresteil auf Kosten der stärker bürgerlich geprägten Landwehr. Da die Mehrheit des preußischen Parlamentes v.a. die liberale Mehrheitsfraktion mehr Mitsprache- und Kontrollrechte der Volksvertreter verlangte, löste der König die Kammer auf. Aus den Neuwahlen gingen die Liberalen aber gestärkt hervor. In dieser Situation benötigte der preußische König einen gewieften Politiker, der sich gegen die parlamentarische Widerstände durchsetzen konnte. In Otto von Bismarck schien der Monarch diese Person gefunden zu haben (vgl. Ullmann 1995, S.20). Dieser ließ den Verfassungskonflikt in der Schwebe, indem er die Staatsfinanzen ohne parlamentarische Budgetbewilligung wie bisher weiterführte. Seine außenpolitischen Erfolge in den folgenden Jahren taten das ihrige, um von den innenpolitischen Fragestellungen abzulenken. Nach dem Sieg über Dänemark 1864, spätestens mit dem überraschend eindeutigen militärischen Sieg über Österreich in der Schlacht von Königsgrätz von 1866, wurden die parlamentarischen Oppositionskräfte angesichts eines nationalen Siegestaumels gespalten. Insbesondere die starke liberale Partei wurde in zwei Strömungen zerrissen; einer nationalen, in der Folgezeit regierungsfreundlichen und einer linksliberalen Partei, welche sich weiterhin massiv grundsätzlich gegen repressive Rechtssystem der Monarchie stark machte. In einer Indemnitätsvorlage billigten die Liberalen im Nachhinein das verfassungsrechtlich fragwürdige Verhalten Bismarcks und seiner Regierung.
Für Deutschland als Kulturraum war mit dem Sieg Preußens über Österreich die endgültige Entscheidung für eine zukünftige kleindeutsche Staatslösung gefallen. Österreich wurde in einem großmütigen Friedensangebot, welches Bismarck gegen militärische Widerstände durchsetzte, zu einem langfristigen Bündnispartner ausersehen. Im neuformierten Norddeutschen Bund unter Führung Preußens, der nicht nur ökonomisch eng mit den Südstaaten Deutschland verbunden war, wurde bereits der Grundstein gelegt für den zukünftigen Nationalstaat, welcher mit dem militärischen Sieg über Frankreich im Jahre 1871 in Versailles feierlich proklamiert wurde. Mit Eisen und Blut gelang Bismarck die vom Volk lang ersehnte Einigung Deutschlands (vgl. Schwarzmüller 1998, S.97). Diese politischen Erfolge wurden auch von denjenigen Kräften in Deutschland anerkannt (v.a. Liberale), die sich lange Zeit für ein einiges und freiheitliches Deutschland eingesetzt hatten. Sie hofften nun darauf, daß nach der Einigung schrittweise rechtsstaatliche und liberale Prinzipien Einzug erhalten würden.
Die Politik Bismarcks mußte sich nun bewähren zwischen den Ansprüchen der herrschenden Obrigkeit und den wachsenden oppositionellen Kräften, welche sich für eine Liberalisierung der Politik engagierten.
Bismarck, der als Reichskanzler einzig und allein vom Kaiser abhängig war, maßschneiderte sich eine Verfassung (in Anlehnung an diejenige des Norddeutschen Bundes), welche seine außerordentliche Stellung in der konstitutionellen Monarchie sicherte (vgl. Stürmer 1987, S.69). Auf die Zusammenarbeit mit den Parteien war er kaum angewiesen und auf diese legte er nur dann Wert, wenn er dadurch eigene Vorstellungen durchsetzen konnte.
3. Die Parteienlandschaft im Deutschen Kaiserreich unter Bismarck
Die Parteienlandschaft, so wie sie sich Bismarck als Reichskanzler präsentierte, war seit den 60er Jahren bereits voll ausgebildet (vgl. Ullmann 1995, S.39ff.). Die zentralen gesellschaftspolitischen Strömungen wie der Liberalismus, der Konservatismus, der Katholizismus, der Nationalismus und der Sozialismus hatten in den diversen Parteigründungen in den 50er und 60er Jahren einen verbindlichen organisatorischen Rahmen gefunden. Über den Reichstag, der in einem allgemeinen und geheimen Wahlrecht (allerdings nur für Männer) bestimmt wurde, übten die dort vertretenden Parteien bescheidenen Einfluß aus auf das von der Hohenzollern- Monarchie gelenkte deutsche Staatswesen. Anders als in unserer parlamentarischen Verfassung der heutigen Bundesrepublik war der Reichskanzler in wesentlichen zentralen Fragen der Politik nicht vom Parlament (Reichstag) oder dem Bundesrat (als Organ der Länder) abhängig, sondern konnte die Richtlinien der Politik weitgehend auf die Gunst und Vollmachten seitens des deutschen Kaisers stützen. Im besonderen galt dies für die militärischen Fragestellungen, welche angesichts der exponierten Stellung und des Ansehens des Militärs im Kaiserreich von besonderer Relevanz waren. Nichtsdestotrotz darf man angesichts der angeführten Tatsachen die Rolle der Parteien im Kaiserreich zur Zeit Bismarcks nicht unterschätzen. Die Verabschiedung des Staatshaushaltes war nach wie vor elementare Angelegenheit der Volksvertretung. Bismarck war also in zentralen finanzpolitischen Fragen nicht nur auf die ihm eher geneigte Länderkammer angewiesen, sondern auch auf das Votum des Reichstages und somit der dort vertretenen Parteien (vgl. Stürmer 1987, S.69). Kontinuierlich vertreten waren im Reichstag die Konservative Partei, die Deutsche Reichspartei, die Nationalliberale Partei, die Fortschrittspartei, das Zentrum und die Sozialdemokratische Partei. Insbesondere für die sozialdemokratischen und sozialistischen Strömungen war das geltende Mehrheitswahlrecht ungünstig, da sich trotz erheblicher Stimmenanteile nur unverhältnismäßig wenige Parlamentssitze erwerben ließen. Ein zentraler Grund hierfür waren die antisozialistischen Zweckbündnisse der übrigen Parteien gegen die Kandidaten der Sozialdemokratie.
Insgesamt läßt sich zusammenfassen, daß die Parteienlandschaft zur Zeit Bismarcks trotz Vollständigkeit noch nicht jene Bedeutung innehatte, die sie bereits zur gleichen Zeit in anderen Staaten besaß (z.B. Großbritannien). Damit einher ging, daß sich die deutschen Parteien eher als ideologische Sammlungsbecken begriffen, welche die Ansichten und Forderungen einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht artikulierten, diese aber nicht im Austausch modifizieren mußten, da sie nicht auf Koalitionen angelegt waren. Bismarck waren die Parteien stets ein notwendiges Übel, mit dem er zu verhandeln hatte, geschätzt hat er diese nie. Paßte ihm die Position der einen Partei nicht in sein staatspolitisches Konzept, so buhlte er um die Zustimmung einer anderen Partei. Bismarck blieb Zeit seines Lebens antidemokratisch und aristokratisch eingestellt. Parteien hatten in seinem Staatsideal keinen Platz. Weite Teile der Parteienlandschaft rechnete er dem sogenannten Lager der Reichsfeinde zu und was das für einzelne Parteien bedeuten sollte wird im folgenden dargestellt werden.
4. Der ‘Kulturkampf’
Im sogenannten Kulturkampf, welcher kurz nach Reichsgründung von Reichskanzler Bismarck geführt wurde, zeigte der ‘eiserne’ Kanzler, daß er auch nach Innen keinen Spielraum für vermeintliche Reichsgegner und Oppositionelle dulden würde. In ‘seinem’ unter der protestantischen Vorherrschaft geeinten Deutschland unter Ausschluß des katholischen Österreichs sah er in den katholischen Minderheiten (v.a. in Bayern, Hannover, Westfalen, Rheinland, Würtemberg u.a.), welche seit jeher eher föderalistisch und somit antizentralistisch eingestellt waren eine potentielle Bedrohung der Sicherheit und Stabilität des Kaiserreiches (vgl. Becker 1983). Ihnen wurde Ultramontanismus (lat.: jenseits der Berge) nachgesagt. Mit dieser verleumderischen Bezeichnung wurde Katholiken pauschal unterstellt, daß sie sich illoyal zur deutschen Obrigkeit verhielten und von Rom aus regiert würden. Bismarck sah insbesondere durch den vom Papst Pius IX. vertretenen Unfehlbarkeitserlaß von 1870 eine massive Gefahr für das gerade geeinte Deutsche Reich (vgl. Görtemaker 1989, S.276). Das Zentrum als parteiliche Organisation der Katholiken stand für Bismarck im Visier seiner politischen Überlegungen. Als zweitstärkste Partei aus den Reichswahlen hervorgegangen befürchtete Bismarck, daß sich hinter dieser Partei weitere oppositionelle Gruppierungen (z.B. Welfen, Polen, Elsässer) scharren könnten, welche die gerade gewonnene ‘Revolution von oben’ gefährden könnten (vgl. Stürmer 1987, S.74).
Bereits im Juli 1871 wurde die katholische Abteilung im preußischen Kultusministerium aufgelöst. Noch im gleichen Jahr erließ Bismarck ‘Kanzlerparagraphen’ als Reichsgesetz, die den Geistlichen untersagten, in Ausübung ihres Berufes Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zu erörtern. Im folgenden Jahr wurde die geistliche Schulaufsicht in Preußen durch staatliche ersetzt; den Jesuiten wurden Niederlassung im Deutschen Reich verboten. 1873 begann man mit den ‘Mai- Gesetzen’ direkt in das kirchliche Leben einzugreifen. Die Ausbildung und Einstellung der Geistlichen wurde unter staatliche Kontrolle gestellt und die kirchliche Vermögensverwaltung wurde umstrukturiert. 1875 wurde vom Reichstag beschlossen, daß nur noch die standesamtliche Eheschließung vor dem Gesetz gültig ist. Die religiöse Trauung wurde dadurch nur noch zu einem symbolischen Akt. Alle diese drastischen Maßnahmen, die z.T. zu einer massiven Verfolgung von Geistlichen führte, sollten die katholischen Kräfte im Reich schwächen. Die Kirche unter der Führung des Papstes wußte diese Situation für eigene Propagandazwecke auszunutzen. Aus der Verfolgung Geistlicher wurde nach katholischer Lesart die Verfolgung der Gläubigen. Bismarck erreichte am Ende seines ‘Kulturkampfes’ eher das Gegenteil dessen, was er beabsichtigte (vgl. Becker 1983). Das Zentrum als parteipolitischer Anker der Katholiken gewann eher an Zulauf, die antipreußische Haltung der katholischen Gläubigen wurde verstärkt. Der Kulturkampf hinterließ im katholischen Teil der Bevölkerung tiefe Spuren, die sich beispielsweise nachhaltig auf föderalistische Struktur der Bundesrepublik nach 1945 ausgewirkt haben.
Bismarck mußte im Kulturkampf eine erste herbe innenpolitische Niederlage einräumen und suchte fortan gemäß dem Motto - wenn du sie nicht besiegen kannst, so suche aus Gegnern Freunde zu machen - vorsichtige Annäherung ans Zentrum, v.a. ab 1878, als das Zentrum die parlamentarische Schlüsselstellung der Liberalen politisch beerbte.
5. Die Sozialistengesetze
„Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe und wenn nicht eine Menge Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt in der Sozialreform bisher gemacht haben, auch noch nicht existieren, und insofern ist die Furcht vor der Sozialdemokratie in bezug auf denjenigen, der sonst kein Herz für seine armen Mitbürger hat, ein ganz nützliches Element“ (Bismarck 1884, zitiert nach Schwarzmüller 1998, S.127).
Ähnlich weitreichende Wirkung wie die Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche im Kulturkampf und dem Zentrum, hatte der Konflikt Bismarcks mit der Sozialdemokratie, welcher Ende der 70er Jahre begann. Waren die Sozialdemokraten 1871 mit 3,2% der Stimmen noch eine schwache Minderheit, so verzeichneten sie seit der Vereinigung der marxistischen und Lassalleanischen Richtung (Gotha 1875) einen stetigen Aufstieg. Bismarck realisierte den stetigen Zuwachs der Arbeiterbewegung, welche auch angesichts der wirtschaftlichen Flaute, welche seit 1873 herrschte, mit weiterem Zulauf rechnen konnte, mit zunehmendem Unbehagen. Bereits 1877 hatte sich der Stimmenanteil der Sozialdemokraten im Reichstag im Vergleich zu 1871 auf 9,1% verdreifacht, die Zahl der Mandate wurden sogar versechsfacht. Umtrieben von dem Alptraum der Revolution, welche der Pariser Kommuneaufstand 1871 an die Wand zeichnete, verfolgte Bismarck seit jeher eine Doppelstrategie. Einerseits bekämpfte er die Sozialdemokratie gesetzlich, andererseits kam er der Arbeiterschaft durch soziale Gesetzgebungen entgegen. Die massive staatliche Repression von Sozialdemokraten begann im Herbst 1878 mit der Verabschiedung des ‘Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie’ im Reichstag gegen die Stimmen von Zentrum und Fortschritt (vgl. Schwarzmüller 1998, S.124ff.). Als Anlaß hierfür erbot sich Bismarck ein zweites Attentat in kürzester Zeit auf Wilhelm I., welches fälschlicherweise, aber strategisch bewußt, der Sozialdemokratie in die Schuhe geschoben wurde. Es löste die Vereine und Organisationen unter der roten Fahne auf, mit Ausnahme der Reichstagsfraktion, welche Immunität genoß. Eine Welle von willkürlichen Verhaftungen sozialdemokratischer Gesinnungsgenossen rollte über das Reich, die Polizei hatte gar die Möglichkeit, Sozialdemokraten auf bloßen Verdacht hin ohne Prozeß auszuweisen. Tatsächlich hatten die ‘Sozialistengesetze’ aber nicht den Erfolg, den sich Bismarck von ihnen versprochen hatte. Im Gegenteil trugen diese Zwangsmaßnahmen des Staates eher dazu bei, daß sich die Arbeiterschaft als eigenständige gesellschaftliche Gruppierung identifizieren konnte, die zudem weiter auf Distanz zum reaktionären Obrigkeitsstaat preußischer Prägung ging. Diese Entwicklung schlug sich für die Sozialdemokraten auch in den Reichstagswahlen nieder (vgl. Engelberg 1983). Ab 1881 konnte die Partei einen stetigen Zulauf verzeichnen, 1890 wurde sie gar erstmals stärkste Fraktion im Reichstag. Die Bekämpfung der Sozialdemokratie einzig mittels der Repression war also zum Scheitern verurteilt. Bismarck suchte daher, einerseits die Partei der Arbeiter zu bekämpfen, andererseits die Arbeiter durch eine weitblickende und vorbildliche Sozialpolitik (vgl. Görtemaker 1989, S.293) für den Staat zu gewinnen. Die angekündigten Gesetze wurden verabschiedet: die Krankenversicherung 1883, das Unfallversicherungsgesetz 1884 und das Gesetz über Invalidität und Altersversicherung 1889. Interessanterweise wurden diese Gesetze gegen die Stimmen der Sozialdemokratie im Reichstag verabschiedet. Auch heute noch sind die sozialrechtlichen Errungenschaften Bismarcks unbestritten, zu Zeiten Bismarcks zielten diese jedoch ausschließlich darauf ab, die Arbeiterschaft zu beruhigen und mit dem Staate zu versöhnen. Einer Revolution sollte möglichst vorgebeugt werden. Bismarck hatte nach dem Kulturkampf auch den zweiten innenpolitischen Konflikt verloren. Trotz der progressiven Sozialgesetzgebung konnte er den Aufstieg der Sozialdemokratie nicht stoppen. Als der Lotse 1890 von Bord ging (bzw. gegangen wurde), waren die Sozialdemokraten bereits zu einer mächtigen und einflußreichen parlamentarischen Kraft herangewachsen. Sie blieben jedoch dauerhaft in Gegnerschaft mit dem verhaßten obrigkeitsstaatlichen System (vgl. Engelberg 1983). Daß sich die Arbeiterschaft während der Kaiserzeit niemals wirklich in das Deutsche Reich integriert fühlte, davon konnten sich die reaktionären Kräfte spätestens 1918 nach dem verlorenen ersten Weltkrieg überzeugen.
6. Die wirtschaftliche Entwicklung 1871-1890
Die Reichsgründung und die durch die militärischen Konflikte aufgestauten wirtschaftlichen Reserven mündeten in den ersten Jahren des Deutschen Reiches in einen Gründerboom. Die Wirtschaft wuchs und die Industrialisierung wurde massiv vorangetrieben. Begünstigt wurde die ökonomische Situation von der allgemeinen wirtschaftlichen Liberalisierung der Warenströme in Europa. Insbesondere die liberalen Parteien im Reichstag, auf die Bismarck in den ersten Jahren seine Macht stützte, galten als vehemente Befürworter des Freihandels und als Gegner von Zöllen und Handelshemmnissen. Erst als ab Mitte der 70er Jahre die Wirtschaft stagnierte und zudem der deutsche Markt mit billigen ausländischen Produkten bedroht wurde (die sogenannte große Depression von 1873 bis 1896), forcierten die Konservativen, aber zunehmend auch die Agrarlobby und v.a. die Schwerindustrie politische Schritte in Richtung einer protektionistischen Wirtschaftspolitik mit Schutzzöllen. Da die liberalen Parteien (sowohl der rechte als auch linke Flügel) politisch an Bedeutung verloren und das Zentrum neben den konservativen Kräften Ende der 70er Jahre ihre parlamentarische Rolle als Mehrheitsbeschafferin für die bismarcksche Finanzpolitik übernahm, schwand der Widerstand gegen die sogenannte ‘Konservative Wende’ von 1878/79 (vgl. Ullmann 1995, S.60ff.).
Dieser ökonomische Richtungswechsel bedeutete für Deutschland, daß man sich nicht mehr vorbehaltlos dem internationalen Freihandel öffnete, sondern daß sich das Deutsche Reich wirtschaftlich verstärkt abschirmte. Erst ab Mitte der 90er Jahre im Zeichen der nationalistischen Postulierung kolonialer Ziele wurde dieser eingeschlagene Wirtschaftskurs neu überdacht (vgl. Stürmer 1987, S.100). Dennoch wäre die Vorstellung falsch, daß das Kaiserreich unter Bismarck bereits ein hochmoderner ökonomischer Staat gewesen sei. Trotz der Tatsache einer nachhaltigen Industrialisierung, welche weite Bevölkerungskreise in die Industrieregionen (v.a. Ruhrzone, Sachsen, Rhein-Mainzone, Elsaß-Lothringen) lockte, arbeiteten die meisten Menschen des mittlerweile auf 41 Mio. Bewohner angewachsenen Deutschen Reiches zu seiner Gründungszeit im primären landwirtschaftlichen Sektor (49% der Beschäftigten, vgl. Ullmann 1995, S.41ff.) und lebten somit auf dem Lande. Daher war insbesondere der Einfluß der Großagrarier (v.a. der ostelbischen) und der landwirtschaftlichen Lobby der Kleinbauern politisch von entscheidender Bedeutung. Mit der zunehmenden Industrialisierung nahm aber auch ihr politischer Einfluß sukzessive ab.
7. Abschließende kritische Würdigung der Innenpolitik Bismarcks
Bismarcks Außenpolitik und sein diplomatisches Geschick bescherten dem deutschen Volk v.a. mittels seiner Politik der Saturiertheit eine bis dahin unbekannte lange Periode des Friedens (vgl. Stürmer 1987, S.81). Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 vergingen 43 Jahre, ohne daß das Deutsche Reich in unmittelbare kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt wurde. Daß sich viele Deutsche später an die guten Zeiten des alten Reiches erinnerten, ist sicherlich in weiten Teilen ein Verdienst der ausgeklügelten Außenpolitik des Strategen Bismarcks. Dennoch haben diese Ausführungen gezeigt, daß der eingangs zitierte ehemalige Bundeskanzler Adenauer nicht unrecht hatte, wenn er auf die innenpolitischen Konsequenzen der Politik Bismarcks verwies. Es stellte sich im nachhinein für Deutschland als eine nationale Katastrophe heraus, daß sich die liberalen Strömungen mit dem Motto ‘zunächst die Einheit, dann die Freiheit’ zufrieden gaben. Unter der Herrschaft des elbischen Junkers konnte sich keine konstruktive parlamentarische Opposition entwickeln, sie wurde entweder nicht ernst genommen oder aber mit staatlich repressiven Mitteln bekämpft. Insbesondere die völkischen Minderheiten, die Katholiken und die Arbeiterschaft verblieben in einer distanzierten Haltung gegenüber dem protestantischen Zentralstaat (vgl. Stürmer 1987, S.96). Es dürfte auch kein geschichtlicher Zufall sein, daß der fanatische Österreicher Hitler später z.T. ähnliche soziale Gruppierungen als Staatsfeinde brandmarkte, wie Bismarck es getan hatte (z.B. Sozialisten, Katholiken, Juden). Die geschichtliche Dialektik aber bleibt, einerseits die außenpolitisch ausgesprochen geschickte Diplomatie, nach Innen die repressive Unterdrückung jeglicher Opposition und Liberalisierung. Einerseits die weltweite Premiere der Einführung der staatlichen Fürsorge, andererseits die gnadenlose Unterdrückung der sozialdemokratischen Organisationen.
Daß aus der Weimarer Republik später eine Demokratie ohne Demokraten werden sollte, die zum Untergang verdammt war, daran hat das Bismarcksche Gesellschaftssystem mit seiner antidemokratischen und obrigkeitsstaatlichen politischen Kultur vermutlich einen großen Anteil (vgl. Blasius 1998, S.5).
8. Literatur
- Becker, W. (1983): Liberale Kulturkampf-Positionen und politischer Katholizismus, IN: Pflanze, O. (Hg.): Innenpolitische Probleme des Bismarck-Reiches. München: Oldenbourg, S.47-72.
Häufig gestellte Fragen
1. Worum geht es in dieser Einleitung über Bismarck?
Die Einleitung beschäftigt sich mit der ambivalenten Figur Otto von Bismarcks in der deutschen Geschichte. Während einige ihn als Wegbereiter des Nationalsozialismus sehen, heben andere seine kluge Außenpolitik hervor, die Deutschland als diplomatische Mittlerposition in Europa sicherte. Er wird als Gründer der deutschen Staatsnation betrachtet, aber seine Innenpolitik wird oft kritisiert.
2. Wie wurde Bismarck Reichskanzler?
Bismarck etablierte sich als reaktionärer Politiker während der Revolution von 1848/49. Nach diplomatischen Erfahrungen in Sankt Petersburg und Paris wurde er 1862 zum Ministerpräsidenten und Außenminister Preußens ernannt. Er setzte sich im Verfassungskonflikt durch, indem er ohne parlamentarische Zustimmung die Staatsfinanzen verwaltete. Seine militärischen Erfolge führten zur Spaltung der Liberalen und zur Annahme einer Indemnitätsvorlage, die sein fragwürdiges Verhalten nachträglich billigte. Der Sieg Preußens über Österreich ebnete den Weg für eine kleindeutsche Lösung und die Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871.
3. Wie war die Parteienlandschaft im Deutschen Kaiserreich unter Bismarck strukturiert?
Die Parteienlandschaft war bereits in den 1860er Jahren etabliert und umfasste Liberalismus, Konservatismus, Katholizismus, Nationalismus und Sozialismus. Der Reichstag hatte begrenzten Einfluss auf die Politik des Kaiserreiches, da der Reichskanzler hauptsächlich vom Kaiser abhängig war. Trotzdem war die Zustimmung des Reichstages für den Staatshaushalt notwendig. Die Konservative Partei, die Deutsche Reichspartei, die Nationalliberale Partei, die Fortschrittspartei, das Zentrum und die Sozialdemokratische Partei waren im Reichstag vertreten. Bismarck betrachtete Parteien als notwendiges Übel und behandelte sie je nach deren Nutzen für seine Ziele.
4. Was war der "Kulturkampf"?
Der "Kulturkampf" war eine Auseinandersetzung zwischen Bismarck und der katholischen Kirche. Bismarck sah in den katholischen Minderheiten eine Bedrohung für das geeinte Deutschland und unterstellte ihnen Ultramontanismus. Durch Gesetze wie den "Kanzlerparagraphen" und die "Mai-Gesetze" versuchte er, den Einfluss der Kirche einzuschränken. Die Maßnahmen führten jedoch eher zur Stärkung des Zentrums und zur Vertiefung der antipreußischen Haltung katholischer Gläubiger.
5. Was beinhalteten die Sozialistengesetze?
Die Sozialistengesetze wurden Ende der 1870er Jahre erlassen, um die Sozialdemokratie zu bekämpfen. Vereine und Organisationen unter roter Fahne wurden aufgelöst, und Sozialdemokraten wurden willkürlich verhaftet und ausgewiesen. Diese Maßnahmen führten jedoch nicht zum gewünschten Erfolg. Die Sozialdemokratie identifizierte sich als eigenständige gesellschaftliche Gruppierung und konnte ihren Zulauf bei Reichstagswahlen steigern. Um die Arbeiter für den Staat zu gewinnen, führte Bismarck eine Sozialgesetzgebung ein (Krankenversicherung, Unfallversicherungsgesetz, Gesetz über Invalidität und Altersversicherung), die jedoch von der Sozialdemokratie abgelehnt wurde.
6. Wie entwickelte sich die Wirtschaft zwischen 1871 und 1890?
Die Reichsgründung führte zu einem Gründerboom und einer massiven Industrialisierung. Die wirtschaftliche Liberalisierung der Warenströme in Europa begünstigte die Situation. Ab Mitte der 1870er Jahre stagnierte die Wirtschaft, und der deutsche Markt wurde mit billigen ausländischen Produkten bedroht (Große Depression). Konservative Kräfte und die Agrarlobby forderten eine protektionistische Wirtschaftspolitik mit Schutzzöllen. Die "Konservative Wende" von 1878/79 führte zu einer wirtschaftlichen Abschirmung Deutschlands. Trotz Industrialisierung arbeitete ein Großteil der Bevölkerung im landwirtschaftlichen Sektor.
7. Wie lässt sich die Innenpolitik Bismarcks abschließend bewerten?
Bismarcks Außenpolitik sicherte dem Deutschen Reich eine lange Friedensperiode. Seine Innenpolitik war jedoch von Unterdrückung jeglicher Opposition und Liberalisierung geprägt. Die liberalen Strömungen gaben sich mit der Einheit zufrieden, und es entwickelte sich keine konstruktive parlamentarische Opposition. Völkische Minderheiten, Katholiken und die Arbeiterschaft blieben distanziert gegenüber dem Zentralstaat. Das Bismarcksche Gesellschaftssystem trug möglicherweise dazu bei, dass die Weimarer Republik scheiterte.
8. Welche Literatur wird in diesem Text verwendet?
Die verwendete Literatur umfasst Werke von Becker, Blackbourn, Blasius, Engelberg, Görtemaker, Stürmer, Schwarzmüller und Ullmann, die sich mit der Innenpolitik des Bismarck-Reiches, dem Kulturkampf, der Sozialdemokratie und der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert befassen.
- Arbeit zitieren
- Manuel Höfs (Autor:in), 2000, Innenpolitik Bismarcks, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104619