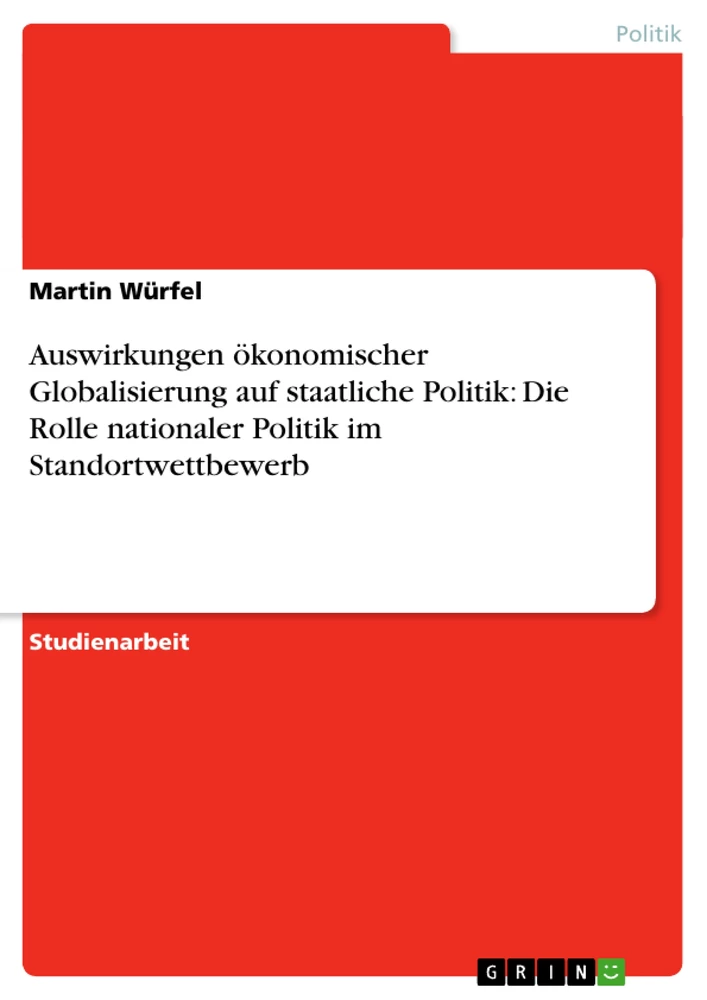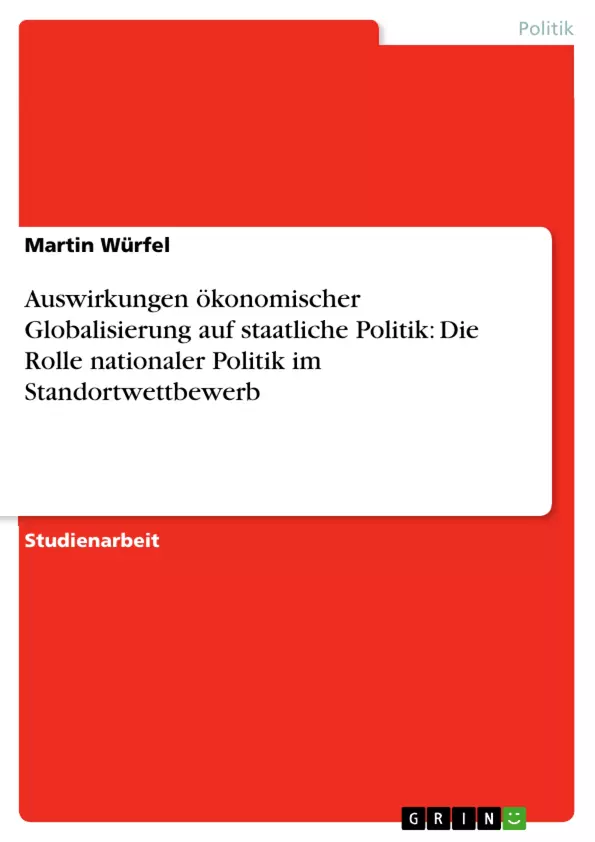Die Diskussion der Konsequenzen von Globalisierung findet vor dem Hintergrund einer radikalen Herausforderung durch ein neu erstarktes marktwirtschaftliches Lager in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik statt, das die Globalisierung der Wirtschaft als drastischen Einschnitt darstellt und als einzige mögliche Reaktion eine ebenso drastische Befreiung des Marktes und der Marktkräfte von politischer und institutioneller Regulierung proklamiert und in Angriff nimmt. Nun sind liberale Forderungen nach Wiedereinsetzung des Marktes alles andere als neu, was den Verdacht fördert, dass Globalisierung als neue Rechtfertigung für die Verfolgung alter Interessen vorgeschoben werde. Ebenso wenig neu ist die Behauptung, dass freie Märkte nicht nur die effizientesten, sondern zugleich auch die sozial gerechtesten Allokationsmechanismen seien, weshalb Deregulierung allen nutze, einschließlich denjenigen, die durch Regulierung geschützt werden sollen. Neu ist jedoch, dass das liberale Lager heute zunehmend die von ihm schon immer unterstellte technische und normative Ineffizienz regulative Eingriffe in den Markt auf ihren nationalen Charakter zurückführt. Politische Interventionen in den Markt müssen angeblich zu nicht optimaler Faktorenallokation wie beispielsweise Wachstumsverluste und Rückgang der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die auf dem nationalen Territorium produzieren sowie zu sozialer Ungerechtigkeit mit einhergehender hoher Dauerarbeitslosigkeit und wachsender Ungleichheit zwischen Arbeitslosen und Arbeitsplatzbesitzern führen, während die Wirtschaftssubjekte zunehmend international agierten und sich deshalb nationalstaatlichen Regulierungen notfalls zum Schaden der jeweiligen Volkswirtschaft entziehen könnten. Dies führe dazu, dass soziale Standards unter dem Druck zunehmenden wirtschaftlichen Wettbewerbs ebenso zusammenbrechen müssten wie die Institutionen und Organisationen, die derartige Standards bisher gegen den Markt durchgesetzt haben.
Andere Positionen schätzen die Rolle nationaler Politik im Standortwettbewerb dahingehend anders ein, als dass nationale wirtschaftspolitische Interventionen in einer internationalisierten Ökonomie die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Volkswirtschaft erhöhen können, und zwar sowohl durch infrastrukturbildende Industriepolitik, als auch durch eine den sozialen Ausgleich sichernde Sozialpolitik mit dem Hinweis darauf, dass sozialer Friede ein entscheidender [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundelemente und Merkmale von Globalisierung
- 2.1 Begriffliches
- 2.2 Dimensionen ökonomischer Globalisierung
- 2.2.1 Standortfaktoren
- 2.2.2 Arbeitskosten und Produktivität
- 2.2.3 Finanzmärkte
- 2.2.4 Direktinvestitionen
- 3 Auswirkungen ökonomischer Globalisierung auf staatliche Politik
- 3.1 Souveränitätsverlust in der Makroökonomie?
- 3.2 Einschränkung sozialpolitischer Gestaltungsfähigkeit?
- 3.4 Fraktionierung und Regionalisierung?
- 3.5 Fazit zu staatlicher Politik
- 4 Schlussbetrachtung
- 5 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen ökonomischer Globalisierung auf staatliche Politik, insbesondere im Kontext des Standortwettbewerbs. Sie analysiert, inwieweit nationale Politikgestaltung durch die Globalisierung eingeschränkt wird und welche Strategien Staaten entwickeln, um die Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs zu bewältigen.
- Begriffsbestimmung und Dimensionen der ökonomischen Globalisierung
- Einfluss der Globalisierung auf staatliche Souveränität und makroökonomische Politik
- Auswirkungen auf die sozialpolitische Gestaltungsfähigkeit nationaler Regierungen
- Die Rolle von nationaler Wirtschaftspolitik im Standortwettbewerb
- Fraktionierung und Regionalisierung als Folge der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Debatte um die Konsequenzen der Globalisierung dar, wobei insbesondere die gegensätzlichen Positionen eines radikal marktwirtschaftlichen Lagers und anderer Positionen, die die Bedeutung nationaler Politik betonen, herausgearbeitet werden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Globalisierung als Rechtfertigung für alte Interessen dient und ob freie Märkte tatsächlich die effizientesten und sozialgerechtesten Allokationsmechanismen sind. Der Fokus liegt auf der Kritik an nationalstaatlichen Interventionen und deren vermeintlich negativen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit.
2 Grundelemente und Merkmale von Globalisierung: Dieses Kapitel liefert eine begriffliche Abgrenzung des Globalisierungsphänomens und beleuchtet seine verschiedenen ökonomischen Dimensionen. Es werden zentrale Faktoren wie Standortfaktoren, Arbeitskosten und Produktivität, Finanzmärkte und Direktinvestitionen analysiert und deren Bedeutung für die Dynamik der Globalisierung erläutert. Der Abschnitt bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren Kapitel, indem er den Kontext für die Analyse der Auswirkungen der Globalisierung auf die staatliche Politik schafft.
3 Auswirkungen ökonomischer Globalisierung auf staatliche Politik: In diesem zentralen Kapitel wird die Kernfrage der Arbeit behandelt: Wie beeinflusst die ökonomische Globalisierung die staatliche Politik im Kontext des Standortwettbewerbs? Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter der potenzielle Souveränitätsverlust in der Makroökonomie, die Einschränkung der sozialpolitischen Gestaltungsfähigkeit, und die Tendenz zu Fraktionierung und Regionalisierung. Das Kapitel analysiert, wie nationale Regierungen auf den internationalen Wettbewerb reagieren und welche Handlungsspielräume ihnen verbleiben.
Schlüsselwörter
Ökonomische Globalisierung, Standortwettbewerb, Staatliche Politik, Nationale Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Souveränität, Makroökonomie, Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Fraktionierung, Regionalisierung, Deregulierung, Marktkräfte.
Häufig gestellte Fragen zu: Auswirkungen ökonomischer Globalisierung auf staatliche Politik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der ökonomischen Globalisierung auf staatliche Politik, insbesondere im Kontext des Standortwettbewerbs. Sie analysiert, inwieweit nationale Politikgestaltung durch die Globalisierung eingeschränkt wird und welche Strategien Staaten entwickeln, um die Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs zu bewältigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Begriffsbestimmung und Dimensionen der ökonomischen Globalisierung, den Einfluss der Globalisierung auf staatliche Souveränität und makroökonomische Politik, die Auswirkungen auf die sozialpolitische Gestaltungsfähigkeit nationaler Regierungen, die Rolle nationaler Wirtschaftspolitik im Standortwettbewerb sowie Fraktionierung und Regionalisierung als Folge der Globalisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundelementen und Merkmalen der Globalisierung, ein zentrales Kapitel zu den Auswirkungen der ökonomischen Globalisierung auf staatliche Politik, eine Schlussbetrachtung und ein Literaturverzeichnis. Zusätzlich werden Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Aspekte der Globalisierung werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene ökonomische Dimensionen der Globalisierung, wie Standortfaktoren, Arbeitskosten und Produktivität, Finanzmärkte und Direktinvestitionen. Im Hinblick auf staatliche Politik werden der potenzielle Souveränitätsverlust in der Makroökonomie, die Einschränkung der sozialpolitischen Gestaltungsfähigkeit und die Tendenz zu Fraktionierung und Regionalisierung untersucht.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet: Wie beeinflusst die ökonomische Globalisierung die staatliche Politik im Kontext des Standortwettbewerbs?
Welche gegensätzlichen Positionen werden in der Einleitung diskutiert?
Die Einleitung stellt die Debatte um die Konsequenzen der Globalisierung dar und arbeitet insbesondere die gegensätzlichen Positionen eines radikal marktwirtschaftlichen Lagers und anderer Positionen heraus, die die Bedeutung nationaler Politik betonen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Globalisierung als Rechtfertigung für alte Interessen dient und ob freie Märkte tatsächlich die effizientesten und sozialgerechtesten Allokationsmechanismen sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Ökonomische Globalisierung, Standortwettbewerb, Staatliche Politik, Nationale Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Souveränität, Makroökonomie, Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Fraktionierung, Regionalisierung, Deregulierung, Marktkräfte.
Welche Schlussfolgerung wird in der Arbeit gezogen (ohne detaillierte Ausarbeitung)?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine Gesamtschau der Auswirkungen der ökonomischen Globalisierung auf staatliche Politik im Kontext des Standortwettbewerbs (genaue Inhalte sind im Dokument selbst zu finden).
- Quote paper
- Martin Würfel (Author), 2003, Auswirkungen ökonomischer Globalisierung auf staatliche Politik: Die Rolle nationaler Politik im Standortwettbewerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10438