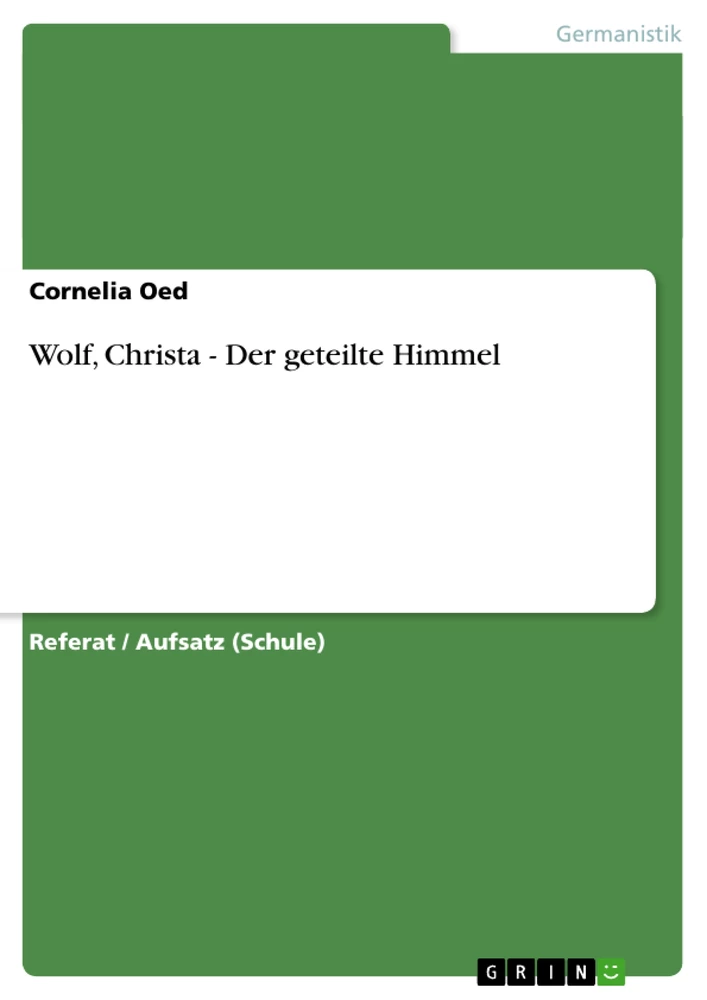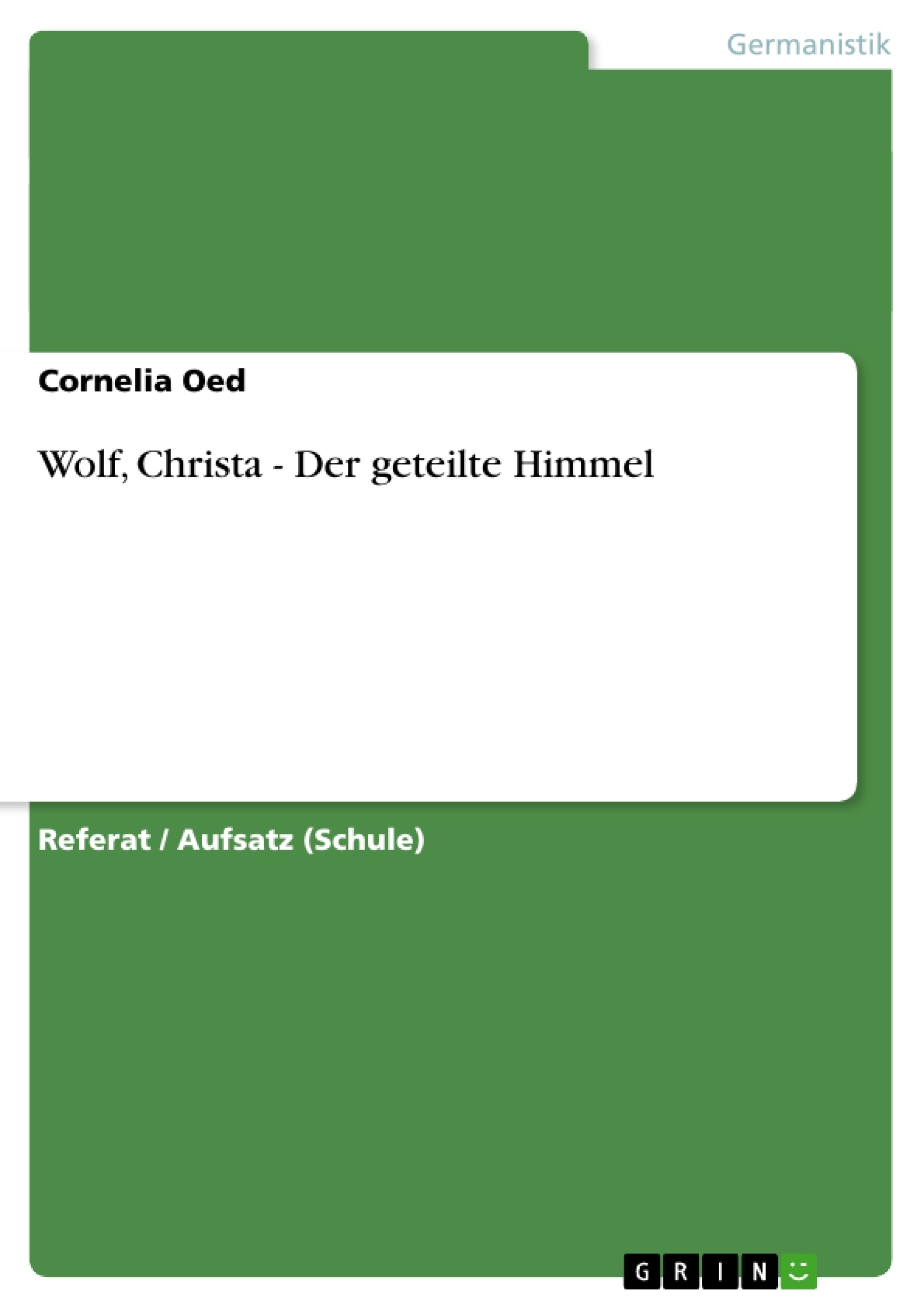Was bedeutet es, zwischen zwei Welten zu stehen, wenn die Liebe selbst zum Schlachtfeld ideologischer Differenzen wird? Christa Wolfs Werk entführt in das Deutschland der frühen 1960er Jahre, eine Zeit des politischen Umbruchs und persönlicher Zerreißproben, in dem die junge Rita zwischen Ost und West, zwischen zwei Männern und vor allem zwischen zwei Lebensentwürfen hin- und hergerissen wird. Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch ringt Rita im Sanatorium mit ihren Erinnerungen, die uns zurückführen zu den Anfängen ihrer leidenschaftlichen Beziehung zu Manfred, einem intellektuellen Einzelgänger, und ihrem Engagement in einem Waggonwerk, wo sie unter dem Mentorat von Rolf Meternagel die Ideale des Sozialismus kennenlernt. Doch während Rita sich mit Enthusiasmus dem Aufbau einer neuen Gesellschaft widmet, hadert Manfred mit den starren Strukturen und flieht schließlich in den Westen, was Rita vor die schmerzhafte Entscheidung stellt: Bleiben und an eine bessere Zukunft glauben oder der Liebe folgen und alles hinter sich lassen? Die Erzählung seziert auf bewegende Weise die inneren Konflikte einer jungen Generation, die zwischen politischem Idealismus und persönlicher Freiheit, zwischen Anpassung und Rebellion ihren eigenen Weg sucht. Themen wie Entfremdung, die Suche nach Identität und die Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Teilung werden dabei auf eine zutiefst menschliche und nachvollziehbare Weise verhandelt. Es ist eine Geschichte von Hoffnung und Enttäuschung, von Liebe und Verrat, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt und zum Nachdenken über die großen Fragen des Lebens anregt, eingebettet in den historischen Kontext des Mauerbaus und der damit verbundenen Zerreißprobe für ein ganzes Volk. Eine Reise in die Vergangenheit, die uns die Augen für die Gegenwart öffnet und uns daran erinnert, wie wichtig es ist, für seine Überzeugungen einzustehen, auch wenn der Preis hoch ist. Der Roman ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Frage, wie politische Systeme das persönliche Glück beeinflussen und wie der Einzelne in einer von Ideologien geprägten Welt seinen eigenen Standpunkt finden kann. Ein zeitloses Werk über die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, das auch heute noch seine Relevanz besitzt.
Christa Wolf: Der geteilte Himmel
1. Informationen zur Autorin
- Geb. am 18.März 1929 in Landsberg/Warthe (Schlesien, heute polnisch) als Tochter von Kaufleuten (kleinbürgerliche Verhältisse) ---Schulbesuch
- 1945 Flucht nach Mecklenburg
- 1949 Abitur---Germanistikstudium, Beitritt zur SED
- 2 Jahre nach Beginn: Heirat---2 Töchter
- Verschiedene Berufe im schrifstellerischen Bereich---Vorstandsmitglied im Bund dt. Schriftsteller
- 1962 Umzug in die Nähe von Berlin---Freie Schriftstellerin---1. Erzählung erscheint
- Jahr darauf: Der geteilte Himmel---Anerkennung in Ost und West---Verfilmung
- 1968 Roman: Nachdenken über Christa T. (kritischer als Himmel)
- 1976 Protest gegen die Ausbügerung von Wolf Biermann---erste offene Kritik--- Verschärfte Beobachtung durch Stasi---nach der Wende: Erzählung: Was bleibt (Beschreibung 24 Stunden unter Dauerüberwachung)
- 1983 Erzählung: Kassandra
- Insgesamt 17 Veröffentlichungen, große Anerkennung in Ost und West
- noch nicht gestorben
2. Historischer und gesellschaftlicher Hintergrund
- Hintergrund der Handlung der Erzählung
- Um 1960 in der DDR
- DDR im Stadium des Aufbau des Sozialismus
- Entstalinisierung --- ideologische Lockerung, Größere Freiheit
- Bodenreform: Land wird zu LPGs zusammengefasst
- Problem durch viele Flüchtlinge in den Westen (Mangel an Arbeitskräften)
- Zuspitzung der Berlin-Krise im Sommer 61
- Kriegsgefahr
- BRD kündigt Handelsabkommen---Wirtschaftskrise
- 13. Aug. 61 Mauerbau: Beendigung der Konflikte
- danach Optimismus---Erweiterter Ausbau des Sozialismus
- neue „Gegener“ innerhalb der Grenzen: Rückschrittliche Genossen---Grundthema der Literatur
- „Bitterfelder Weg“ Betriebspraktika für Anghörige der Intelligenz, also auch Schriftsteller (auch Christa Wolf)
3.Inhalt der Erzählung
- Beginn: Ende August 61: Rita erwacht nach Selbstmordveruch aus Ohnmacht
- Nervenzusammenbruch (weint ohne Ende)
- Einweisung ins Sanatorium
- Erinnerungen (eigentliche Handlung, Zwischeneinblendungen/ Sanatorium)
- 2 Jahre vorher
- Rita (19) lebt mit Tante und Mutter in kleinem Dorf auf dem Land ---Schulbesuch nach Geldmangel beendet---langweilige Arbeit im Kreisstadtbüro einer kleinen Versicherung
- 2 Veränderungen:
- Beim Tanzen Kennenlernen des hochmütigen Manfred (29) aus der Stadt--- große Liebe auf den ersten Blick
- Erwin Schwarzenbach, Bevollmächtigter für Lehrerwerbung kommt in die Kleinstadt und wirbt Rita an
- R. zieht in die Großstadt (Halle an der Saale) und bei M. und seinen Eltern ein
- R. arbeitet (auf Schw. Rat) in Waggonwerk----Brigade Ermisch--- Rolf Meternagel als „Lehrer“ (anfangs sehr ungeschickt) und Ansprechperson---Hilfe bei der Integration
- Keine Integration in M.s „toter“ Familie---Atmosphäre immer sehr angspannt (schlechtes Verhältnis M./seinen Eltern)---Explosion
- Festlicher Anlass---R. lernt Wendland kennen (neuer Werksleiter)
- Durch Fehlorganisation und Privategoismus Krise im Werk
- Meternagel beginnt Kampf für mehr Einsatz von jedem (erst kein Mut, 2 Degradierungen) --- Gewinnt in Brigade Ermisch ( 10 Fenster pro Schicht)
- Studienanfang am Lehrerinstitut---Schwarzenbach = Dozent--- oft einsam
- 1. Besuch bei Schwarzenbachs (gefällt ihr gut)---Streit mit M.
- R. spricht von Mangold (soll Vobildfunktion haben, riesiges Wissen---Dogmatiker)
- M. arbeitet mit einem Studenten an neuer Maschine---sehr wichtig für ihn
- Wendland besucht M. --- Wendland vertraut M. seine Probleme an---1. Gespräch von Vorteilen des Westens
- Weihnachten: missglückte Abendgesellschaft beim Professor
- M. erfährt das Projekt abgelehnt---Hoffnungen zerstört
- R. mischt sich in politische Diskussion ein
- M. fährt zum schuldigen Werk
- Eltern von Kommolitonin Ritas fliehen in den Westen---R. hilft ihr---Mangold will für Exmatrikulation sorgen--- kann mit niemanden über ihn reden
- ist am Ende---flieht in ihr Dorf---Veränderungen und Unruhe durch Bodenreform--- R. bekommt neue Kraft
- R. und auch M. (erfolgslos) kehren zurück---mit Schwarzenbachs Hilfe Kampf gg Mangold---bekommen Recht---seine verletzlichen Seiten kommen zum Vorschein
- Fahrt mit neuem Leichtbauwagen (Steckenpferd von Wendland)---politische Diskussion M.-Wendland---Nachricht vom ersten russischen Kosmonauten im All- --großer Jubel---Wendland erzählt M. von Degradierung seines Vaters --- Streit
- M.s Verhältnis zur Umwelt verschlechtert sich immer mehr (offener Haß auf Eltern)---immer schlecht gelaunt--- sucht noch Sicherheit in R.--- R. hat Angst um Liebe (Entfremdung)
- R. besteht Prüfung---M. nicht da---geht mit Wendland Essen---M. hat‘s gesehen--- macht Szene---R. sagt ihm offen ihre Meinung---M. verspricht Besserung
- 2-3 Wochen später:
- M. fährt zu Chemikerkongress nach West-Berlin---kommt nicht zurück---R. zerstört, wird zur Hülle ihrer selbst---Brief mit Aufforderung zum Nachkommen
- M. Mutter stirbt--- Wendland bei Beerdigung
- Allg. Kriegsangst
- Leichtmetallwagen wird auch nicht gebaut (kein Metall aus W.)
- Extrem heißer Sonntag: R. fährt zu M. (wohnt in W. bei Tante in kleinem Zimmer, unglücklich, guter Job)---gehen in vertrockneten Park---M. will, daß R. bleibt--- Streit---langsames Loslösen voneinander---R. fährt zurück
- Mauerbau: R. in Werk
- Unbewußter Selbstmordversuch im Werk (weil Liebe vergänglich Zusammenbruch zwischen auf sie zurollenden Waggons)
- Sanatorium: viel Besuch und bedeutungsvolle Träume
- R. bekommt von Freund Brief von M. (Rechtfertigung)
- Meternagel: 12 Fenster pro Schicht
- Schwarzenbach: Fragt R. Immer Wahrheit? (Artikel gg Dogmatiker, Ärger)
- Entlassung:
- R. läuft durch Stadt
- Besuch bei schwerkrankem Meternagel (Kampf nie aufgegeben, 14 Fenster)
4. Einordnung, Aufbau und Sprache
a) Einordnug:
- Entwicklungsroman oder Ankunftsroman (DDR): Hauptfigur verwirklicht sich selbst, findet Weg in die sozialistische Gesellschaft
- Allg. Kunsttheorie: Funktion der Literatur als ideologische Massenerziehung--- Auseinandersetzung mit Sozialistischem Realismus (Grundsätze auf sozialistischer Basis: Vorbildlichkeit, Optimismus, Parteilichkeit)---Zensur
b) Aufbau:
- Erzählung (Untertitel)
- Prolog und Epilog: Ausblick über Geschichte hinaus, Bezug auf Geschichte
- P: Einleitung, abgewendete Kriegsgefahr und Zuwenden zum Alltag
- E: R. sieht Freundlichkeit der Menschen, vermittelt Zuversicht
- Gegenwarts- und Reflexionseben (Krankenhaus/Sanatorium) --- Vergangenheits-und Ereigniseben
- Analyse der Entfremdung mit M. / Gründe für Entscheidung für DDR
- Erzählung aus auktorikaler Sicht, aber geringer Gebrauch des Allwissens
- Subjektive Erfahrung R.s, innere Monologe
- Optimistische Grundhaltung, subjektive Authenzität
c) Sprache:
- Im wesentlichen gesprochene Sprache
- Viele realistische Dialoge
- Naturmetaphorik zum Ausdruck von Empfindungen
- Oft sehr konventionell verwendet (z. B. Wetter = Gefühlslage)
- Überzeichnet (z. B. Zur Beschreibung des Westens: heißer, trockener Park)
- Zum Umgehen von Zensur
- kein Humor oder Ironie
- Überfrachtete Bedeutung jeder Szene
- Sprache und Metaphorik lediglich Instrument
5. Interpretation:
- Problem: Unterschiedliche Sichten von Ost und West, gewollte vielfältige Möglichkeiten
- Nichts zufällig gewählt
a) Orte:
- Arbeiten, Lernen, Leben
- Werk: Mittelpunkt im sozialistischen Alltag
- Gegensatz Stadt-Land
- Sanatorium: Ort zur Eingewöhnug in die Normalität, in den Alltag
- Westen:
- Keine richtige Auseinandersetzung mit dieser Thematik
- Verschwommene Darstellung und Argumentation (Natur)
- Ort ohne Hoffnung und Zukunft, der Sinnlosikeit und Verschwendung, gegründet auf kapitalistischen Betrug
- Fremde Welt, kein Sinn
b) Personen:
Rita:
- Hauptfigur
- Vertreterin der ersten DDR-Generation (geb. 1940)---keine Vorbelastung durch 2. Weltkrieg
- Kindheit auf Dorf (Vakuum)---keine politische Erfahrung, keine Vorbehalte
- Sehr lernbegierig, Wunsch nach großer Veränderung
- optimale Voraussetzung für Einleben in sozialistischer Gesellschaft
- Handelt sehr selbstständig, sehr intuitiv (Manfred, Lehrervertrag, Meternagel), optimistisch, starke Emotionalität, will aus dem vollen Leben,
- Glaube an große Liebe mit Manfred--- unbewußter Selbstmord, weil Liebe vergänglich
- Fortschrittsglauben---Begeisterung für Reformkommunismus, auf Meternagels Seite---will alles verändern, auch Manfred
- Betonung auf Entwicklung im Laufe des Buches (naives Dorfmädchen—reife Frau)
- Sanatorium: Relativierung ihrer Ansichten, Verkraften der Trennung, geringere Ansprüche---will Freundlichkeit sehen und daraus Kraft schöpfen
- Rückkehr aus Berlin = Bekennung für DDR
- Verkörperung der DDR (Optimismus trotz Rückschläge, am Ende Sieg, mit Hilfe von Sozialismus)---Genialität des Werkes
Manfred:
- Gegenpol zu Rita
- Aus gutbügerlichem Stadtmilieu--- Maßregelung durch Eltern (Aussenseiter)
- Negative Vorbelastung durch 2. WK und Stalinzeit---geringe Chancen für Entwicklung zum Sozialismus--- Individualist, keine Unterordnung
- Politisch abstinent nach Studium (Engagement, bester Freund in Rücken gefallen)
- Pessimist, Arroganz, Gleichgültigkeit gegenüber Mitmenschen(keine Freunde)
- Liebe zu R. löst ein wenig innerliche Erstarrung---liebt an ihr die Eigenschaften, die er nicht hat
- Scheitern des Projekts (Versuch zur Eingliederung, Orakel)+Entfremdung--- Erkennen des eigene Unnutzes---Resignation, Zynismus
- Flucht aus Gleichgültigkeit (ohne politische Überzeugung)
Wendland:
- Gegenspieler von Manfred (kompliziertes Beziehungsgeflächt, Eifersucht)
- Ruhig, gelassen, sozialistisch Eingestellt
- Vorbildlicher Werksleiter (Einsatz zur Bewältigung der Krise)
- Fester Bezugspunkt, Ruhepol---an entscheidenden Situationen für R. da
Meternagel:
- Der neue Arbeiter
- Vorkämpfer für Sozialismus --- Selbstloser Kampf gegen Privategoismus, gegen mangelndes Pflichtbewußtsein--- jeder Teil des Ganzen
- Starke Wirkung auf R. (Heldenfigur, Vaterfigur), Vorbild---Kritik an bestehender Haltung
- Am Ende Zusammenbruch---Kritik an mangelnder Hilfe, auch durch Partei Brigadier Ermisch: Negatives Gegenbeispiel (Privategoismus, Geltungssucht)
Schwarzenbach:
- Wirbt R. , fester Anhaltspunkt für sie an Institut---Hilfe bei der Einfindung in sozialistische Ideen
- überzeugter Reformkommunist ---Kampf für Sozialismus auf Vertrauensbasis, gegen Kontrollen+Dogmatiker---Meinung: Jeder vernünftige Mensch= Sozialist
- Sieht Zeit für Veränderung da (die Zeit ist reif, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen)
- Am Ende Unsicherheit (mangelnde Unterstützung)---Bestätigung durch R. Politische Gegner = Spießer (Mangold, Manfreds Eltern)
- rückständige Ideen, Hemmung des Fortschritts
- Oppprtunisten (Reden nach Mund des Herrschers zum eigenen Vorteil)
- Mangold = Dogmatiker, strikte stalinistische Ideen, Kontrolle statt Vertauen--- Hemmt Arbeit am Lehrerinstitut
- M. Mutter: alte Faschistin (--unbewältigte Nazivergangenheit, Parteiabzeichen- tausch), Spießbürger
- R. sieht sie als Menschen --- Relativierung der Kritik
c) Gesamtwerk:
- Kritik an bestehenden Verhältnissen, Ansporn zur Veränderung---Relativierung zur Beschwichtigung---Zensur
- Trauer und Bitterkeit über Situation Deutschlands
- Bekennung für DDR und Sozialismus
- Grundfrage: Liegt der Sinn des Lebens im einzelnen oder im Kollktiv?
6. Rezeption
- besonders hoher Stellenwert in Geschichte der DDR-Literatur (rege Debatten)
- Westen: - 1. „lesbares“ Buch aus Osten
- Die „neue“ Stimme von drüben (DDR-Nationalliteratur)---neuer Realismus
- Osten: - breite Zustimmung des Publikums (Wiedererkennung, Offenheit)
- Literaturstreit (Anhänger der Orthodoxie---Modern Eingestellte)
- Verstoß gegen das „Typische“ (Meternagel, Manfred), ungenügende Behandlung der „nationalen Frage“ (nicht gegen Westen), ...
- Entscheidung zugunsten der Autorin (Heinrich-Mann- Preis)
- Kritik an Sprache (Naturmetaphorik)
- Heute:
- „historisches Dokument“ (DDR gehört Vergangenheit an)
- eins der wichtigsten Werkes
- Himmel signalisierte Anfang
- Kritik: vorschnelle Kompromisse, Bedürfnis nach Harmonie, Versöhnugsutopie
- Wichtigste DDR-Autorin
7. Schluß
- Gut gefallen (aktuelle Thematik, Auseinandersetzung mit DDR (interessant))
- Teilweise zu langatmig, Kunstruiert, Naturbeschreibungen
- Quellen: - Buch: dtv-Ausgabe
- Grundlagen und Gedanken zum Verständnis Erzählender Literatur (Ingeborg Gerlach)
- Umschlagbild von Köpfe des 20. Jahrhunderts (Franz Baumer)
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Christa Wolf?
Christa Wolf wurde am 18. März 1929 in Landsberg/Warthe geboren und ist eine deutsche Schriftstellerin. Sie wuchs in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf und floh 1945 nach Mecklenburg. Nach dem Abitur studierte sie Germanistik und trat der SED bei. Sie arbeitete in verschiedenen schrifstellerischen Bereichen und wurde später freie Schriftstellerin. Bekannt wurde sie durch ihre Erzählung "Der geteilte Himmel".
Was ist der historische Hintergrund der Erzählung "Der geteilte Himmel"?
Die Handlung der Erzählung spielt um 1960 in der DDR, einer Zeit des Aufbaus des Sozialismus. Es gab eine Entstalinisierung, die zu ideologischer Lockerung und größerer Freiheit führte. Die Bodenreform führte zur Zusammenfassung von Land zu LPGs. Ein Problem war die hohe Zahl von Flüchtlingen in den Westen, was zu einem Mangel an Arbeitskräften führte. Die Berlin-Krise spitzte sich im Sommer 1961 zu, und es bestand Kriegsgefahr. Der Mauerbau am 13. August 1961 beendete die Konflikte.
Worum geht es in der Erzählung "Der geteilte Himmel"?
Die Erzählung beginnt Ende August 1961, als Rita nach einem Selbstmordversuch aus der Ohnmacht erwacht. Sie befindet sich in einem Sanatorium und erinnert sich an die Ereignisse der letzten zwei Jahre. Rita lernt Manfred kennen und lieben und zieht nach Halle an der Saale, um dort zu arbeiten und zu studieren. Sie erlebt die Krise im Werk und die politischen Diskussionen. Manfred fährt nach West-Berlin und kehrt nicht zurück. Rita versucht, sich das Leben zu nehmen, und findet im Sanatorium wieder zu sich selbst.
Wie ist die Erzählung aufgebaut?
"Der geteilte Himmel" ist eine Erzählung mit einem Prolog und Epilog. Es gibt eine Gegenwarts- und Reflexionsebene (Krankenhaus/Sanatorium) und eine Vergangenheits- und Ereignisebene. Die Erzählung wird aus auktorikaler Sicht erzählt, aber mit subjektiven Erfahrungen Ritas und inneren Monologen. Es herrscht eine optimistische Grundhaltung und subjektive Authentizität vor.
Wie ist die Sprache in "Der geteilte Himmel"?
Die Sprache ist im Wesentlichen gesprochene Sprache mit vielen realistischen Dialogen. Es gibt Naturmetaphorik zum Ausdruck von Empfindungen, die aber oft konventionell verwendet wird. Die Sprache ist überzeichnet, um Zensur zu umgehen. Es gibt keinen Humor oder Ironie, und jede Szene hat eine überfrachtete Bedeutung. Sprache und Metaphorik dienen lediglich als Instrumente.
Wie wird der Westen in "Der geteilte Himmel" dargestellt?
Der Westen wird nicht richtig thematisiert. Die Darstellung und Argumentation sind verschwommen (Natur). Es ist ein Ort ohne Hoffnung und Zukunft, der Sinnlosigkeit und Verschwendung, gegründet auf kapitalistischem Betrug. Es ist eine fremde Welt ohne Sinn.
Welche Rolle spielt Rita in der Erzählung?
Rita ist die Hauptfigur und Vertreterin der ersten DDR-Generation. Sie ist lernbegierig, wünscht sich eine große Veränderung und hat optimale Voraussetzungen für ein Einleben in der sozialistischen Gesellschaft. Sie handelt selbstständig und intuitiv, ist optimistisch und emotional. Im Laufe des Buches entwickelt sie sich von einem naiven Dorfmädchen zu einer reifen Frau. Ihre Rückkehr aus Berlin ist ein Bekenntnis zur DDR. Sie verkörpert die DDR (Optimismus trotz Rückschläge, am Ende Sieg, mit Hilfe von Sozialismus).
Wer sind die wichtigsten Personen in "Der geteilte Himmel" neben Rita?
Manfred ist ein Gegenpol zu Rita, pessimistisch und gleichgültig. Wendland ist ein Gegenspieler von Manfred und ein Vorbild als Werksleiter. Meternagel ist ein Vorkämpfer für den Sozialismus. Schwarzenbach hilft Rita, sich in die sozialistischen Ideen einzufinden. Mangold ist ein Dogmatiker und politische Gegner.
Welche Kritik übt Christa Wolf in "Der geteilte Himmel"?
Christa Wolf übt Kritik an den bestehenden Verhältnissen und spornt zur Veränderung an. Sie zeigt Trauer und Bitterkeit über die Situation Deutschlands, bekennt sich aber zur DDR und zum Sozialismus. Eine Grundfrage ist, ob der Sinn des Lebens im Einzelnen oder im Kollektiv liegt.
Wie wurde "Der geteilte Himmel" aufgenommen?
"Der geteilte Himmel" hatte einen besonders hohen Stellenwert in der Geschichte der DDR-Literatur und löste rege Debatten aus. Im Westen wurde es als erstes "lesbares" Buch aus dem Osten wahrgenommen. Im Osten gab es breite Zustimmung des Publikums, aber auch Literaturstreitigkeiten. Heute gilt es als "historisches Dokument" und eines der wichtigsten Werke der DDR-Literatur. Kritik gibt es an vorschnellen Kompromissen und dem Bedürfnis nach Harmonie.
- Quote paper
- Cornelia Oed (Author), 1998, Wolf, Christa - Der geteilte Himmel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104316