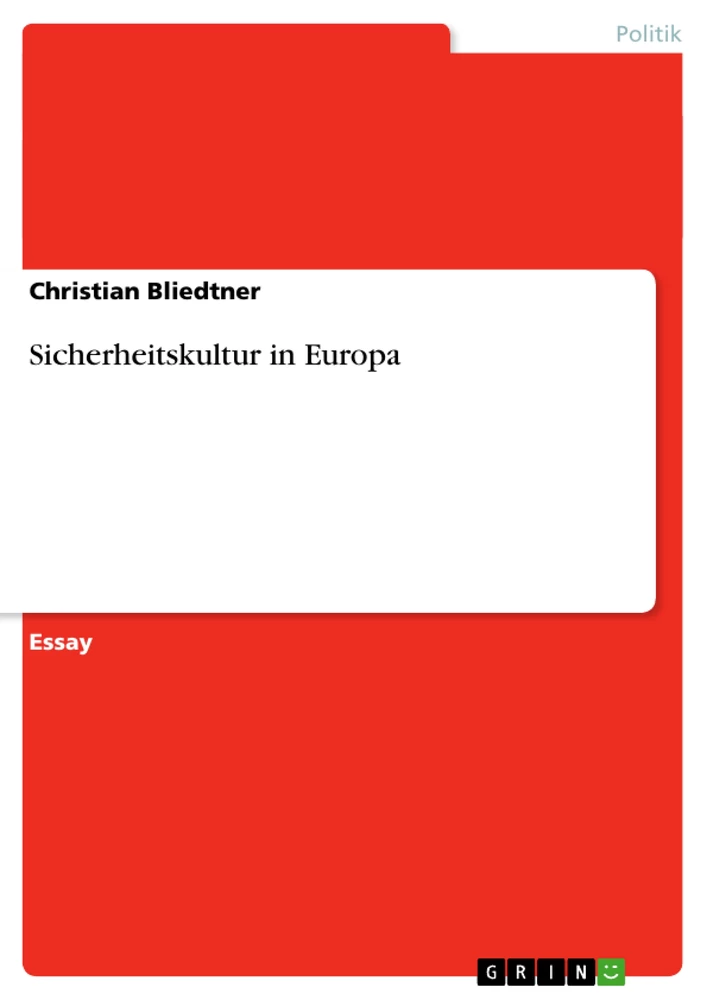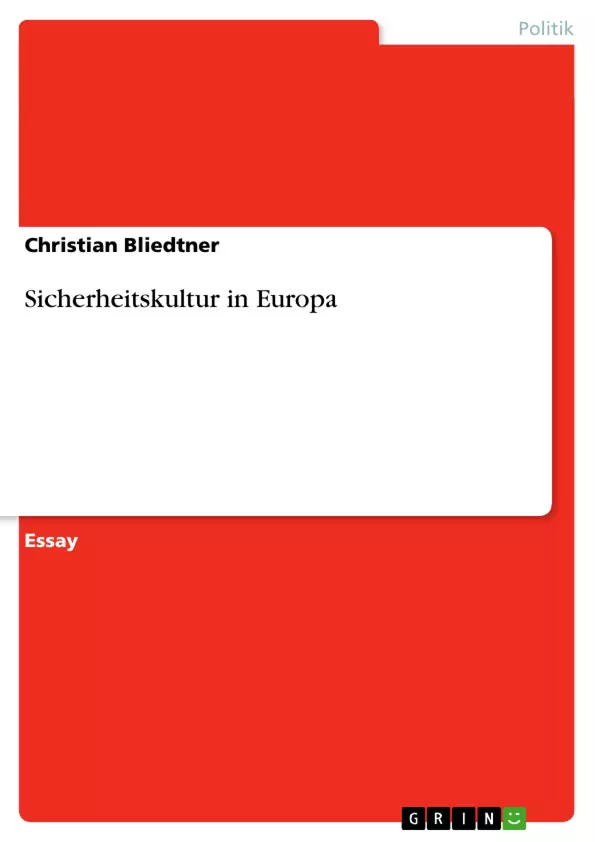Gibt es eine Sicherheitskultur in Europa ?
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges war jede Form von Sicherheitskultur in Europa zerstört. Diese Aussage impliziert, das es überhaupt eine irgendwie geartete Sicherheitskultur gab. Wie diese aussah, soll hier nicht näher beschrieben werden, denn letztendlich wurde deswegen ein weltumspannender Krieg nicht verhindert und kann aufgrunddessen als gescheitert betrachtet werden. Mich interessiert eher die Frage, ob danach eine Änderung stattfand bzw. sich etwas neues etablierte. Zunächst muß die Rolle Europas betrachtet werden. Aus der “alten Welt”, welche jahrhundertelang Weltpolitik betrieb und dadurch eine subjektive Rolle inne hatte, wurde ein Europa, daß zunehmend durch die UDSSR und die USA, d.h. durch den “kalten Krieg”, von Außen bestimmt wurde und somit eine objektive Rolle einnahm.
Von einer konfrontativen Sicherheitskultur...
Fakt ist, das während dieser fünfundvierzigjährigen Teilung Europas jegliche Form von gewalttätiger und aggressiver Konfliktaustragung zwischen Ost und West verhindert werden konnte. Dies wurde vor allem durch Abschreckung und Wettrüsten erreicht. Besonders das Sicherheitskonzept des Zweitschlages war hierbei von immenser Bedeutung, so daß es zu einer Stabilisierung des Status Quo kam. Die USA verfolgten stets eine Strategie der Eindämmung der UDSSR, wobei sie zugleich die ”gefährlichen Deutschen“ einbinden und kontrollieren konnten. Die UDSSR versuchten wiederum auf die USA einzuwirken und konnten zugleich interne Konfliktpotentiale in ihrem Herrschaftsbereich unter Kontrolle halten. Doch zu Beginn der sechziger Jahre ging die Konfrontation allmählich - über Rüstungskontrolle, Détente, politische Durchdringung und Lernprozesse - in ein europäisches Sicherheitssystem über, das Selbstbeschränkung und begrenzte Kooperation von Kontrahenten kennzeichneten. Uwe Nerlich begreift dies als eine Sicherheitskultur, welche einen dreifachen Test bestand: die sowjetische Preisgabe Osteuropas, die Wiedervereinigung Deutschlands und der Zusammenbruch der UDSSR.
...zu einer kooperativen Sicherheitskultur
Die Schlußakte von Helsinki stellt den ersten Beweis für die Annahme Nerlichs dar, wobei der “Korb III” besondere Beachtung finden sollte. Durch unterschiedliche Interessen angetrieben, gelang es den verfeindeten Staaten sich auf einen gemeinsamen Prinzipien- und Wertekatalog zu einigen. Zwar brach diese annähernd kooperative Kommunikation zu Beginn der Achtziger Jahre abrupt ab, doch ab ca. 1988 geschah das auch aus heutiger Sicht noch unfaßbare.
Dieser tiefgreifende politische Wandel, welcher übrigens gewaltfrei ablief, fand seinen Höhepunkt in der Pariser KSZE-Gipfelkonferenz. Nicht umsonst wurde die Charta von Paris als neue Magna Charta für ein gemeinsames Europa gehandelt. In ihr läßt sich zunächst erkennen, wodurch eine neue europäische Sicherheitskultur geprägt ist: Kooperation aufgrund gemeinsamer Werte und Normen. Dies klingt im ersten Moment sehr bedeutungsvoll, ist es aber erst dann, wenn es auch dementsprechend ausgefüllt wird. Souveränität, Selbstbestimmungsrecht der Völker, Minderheitenschutz, vertrauensbildende Maßnahmen und der gesamte Bereich der menschlichen Dimension wirken jedoch recht blaß mit Blick auf den Balkankrieg.
Postkonfrontative Konflikte: Unfall oder Katastrophe?
Vieles zeigte uns dieser Krieg Mitten im Herzen Europas. Europäische Sicherheitskultur läßt sich nicht deswegen bewirken, indem Institutionen übergestülpt werden. Diesen Begriff geographisch einordnen zu wollen ist ebenso schier unmöglich. Falls der Versuch unternommen wird, Regionen auszugrenzen, zeugt dies von einer Verzweiflungstat. Man sollte deshalb nicht verfrüht behaupten, eine neue Sicherheitsordnung sei deswegen gescheitert, weil sich nicht ihre Wirkung entfalteten konnte. Viel eher will ich folgende Aspekte betonen: Erstens kam der Balkankonflikt zu Früh, denn die Mechanismen waren noch nicht gut eingeübt und verinnerlicht. Zweitens funktionierten die wenigen Mechanismen die es gab, aus institutionalistischer Sichtweise sehr gut. Aus eben diesem Blickwinkel läßt sich das Verhalten der EU scharf kritisieren. Es gab einen Profilierungsdrang, welcher das Agieren der KSZE erschwerte. Somit war die Diskussion um ein Institutionengerangel durchaus berechtigt. Doch der wichtigste und dritte Punkt ist jener, das ein Lernprozeß einsetzte, welcher sich später in dem Verhalten der Institutionen untereinander und in neuen Verfahrensregeln der KSZE/OSZE widerspiegelte. Daraus lassen sich die nächsten wichtigen Schritte für eine europäische Sicherheitskultur ableiten: Selbstbeschränkung als politische Verhaltensweise muß als Leitbild erhalten bleiben, doch parallel dazu muß der Bogen so weit gespannt werden, das Konflikte, wie auf dem Balkan, zu einer europäischen Angelegenheit gemacht werden und das es ein Selbstverständnis besonders der größeren Staaten sein muß, sich verpflichtet gegenüber Dritten zu fühlen. Insofern ist der bisherige Ausgang der Baltikumkonflikte doppelt positiv zu werten: Zum einen fand ein erfolgreicher Lernprozeß statt, d.h. die neugeschaffenen Mechanismen konnten das Ausbrechen eines Konfliktes verhüten. Zum anderen haben wir erfahren, das Begriffe wie präventive Diplomatie und Früherkennung nicht nur leere Formeln sind.
Politische Kultur und Evolution
Letztendlich zeigen uns die postkonfrontativen Konflikte, das Europa heute noch geteilt ist; und zwar mit völlig neuer Qualität. Dies liegt an der Diskontinuität der Entwicklungen, wodurch eine tiefverwurzelte Heterogenität politischer Kulturen entstand. Paradoxerweise versuchte westeuropäische Sicherheitskultur immer die Teilung Europas mit friedlichen Mitteln zu überwinden, was ihr bekanntermaßen gelang. Doch genau diese Kultur ist heute gefährdet, wenn sie es nicht schafft, Osteuropa zu stabilisieren, so wie zu Zeiten der konfrontativen Teilung. Somit muß an dieser Stelle eines offen gesagt werden: Wenn ich (und vor allem Nerlich) über europäische Sicherheitskultur spreche, meine ich damit eine stark westlich geprägte Sicherheitskultur. Um so ironischer fällt das Urteil aus, daß die Menschen im Osten ein substantielleres Gefühl dafür behielten, was ein gemeinsames Europa bedeutet, als jene auf der westlichen Wohlstandsinsel. Doch dies sollte Westeuropa als eine Chance betrachten.
Der Schlüssel zum Erfolg für eine gemeinsamen (Sicherheits-)Kultur liegt darin zu erkennen, das alle Staaten Europas sich in ihrer Eigenentwicklung auf unterschiedlichen Evolutionsniveaus befinden. Die einen geben Teile ihrer Souveränität ab, wohingegen andere sie vor kurzem erst erhielten. Gerade das Beispiel Baltikum zeigte uns, wohin ein falsches Souveränitätsverständnis führen kann. Deswegen muß es gelingen in Europa übergreifende Strukturen zu errichten, auch wenn dies erschwert wird durch unterschiedliche Aufgaben der einzelnen Länder. Nur so kann die europäische Gemeinsamkeit Wirklichkeit werden, wofür europäische politische Kultur gefordert wäre.
Europäische Kultur wird vielmehr in der praktischen Anerkennung des Zusammenhangs und der Gemeinsamkeit der politischen Entwicklungsaufgaben im Westen und Osten Europas lebendig. In diesem Verständnis muß man die Äußerungen Javier Solanas verstehen, wenn er dazu aufruft: Europa braucht Visionen. Dies führt letztendlich zu der wichtigsten Frage: Wo wollen wir hin? Was ist unser Gestaltungsziel? Ist gerade dies nicht momentan eines der Hauptprobleme der Europäischen Union?
Europäische Sicherheitskultur als Bezugsrahmen
Damit stellt Uwe Nerlich meines Erachtens folgerichtig fest: Europäische Sicherheitskultur ist nur im Kontext einer politischen Kultur Europas vorstellbar, in der es aufgeklärtes Eigeninteresse der Staaten ist, sich von übernationalen Gestaltungszielen leiten zu lassen. Doch diese Kultur verlangt von den Staaten Selbstbeschränkung und Schutzbereitschaft aus übergeordneten Interessen, denn nur so werden Instrumente und Mechanismen von multinationalen Sicherheitsinstitution wirksam. Somit muß man Sicherheitskultur als eine Ebene zwischen Konstellationen und Instrumenten der Sicherheitspolitik begreifen. ”Das Entsehen von Instrumenten erfordert Konstellationen und ihre Wirksamkeit eine Sicherheitskultur, die sich wiederum im Wirksamwerden der Instrumente - Institutionen, Verträge, Regime usw. - manifestiert. Insofern läßt sich Sicherheitskultur umschreiben als ein politischer Referenzrahmen mit gemeinsamen Normen und Werten, mit der kollektiven Bereitschaft, Obligationen einzugehen, und dem Konsensus der handlungsfähigen Mächte, in einer gegeben Situation kollektiv zu handeln”. Schöner kann man es einfach nicht ausdrücken.
Wenn ich nun zu meinem Ausgangsgedanken des II. Weltkrieges zurückkehre, so möchte ich einiges hinzufügen. Es gab auch vor 1939 schon einen gemeinsamen Werte- und Normenbestand in Europa. Nur war dieser nicht so groß wie heute und drei Ideen waren nicht besonders ausgeprägt: Die Bereitschaft kollektiv zu handeln, Obligationen gegenüber Dritten einzugehen und das wichtigste nämlich, präventive Diplomatie bzw. eine Art Früherkennungssystem (zumindest so, wie wir dies heute verstehen).Vielleicht war gerade der ”kalte Krieg“ mit der Möglichkeit einer mehrfachen Zerstörung der Erde von Nöten, um die Einsicht der Staaten dahingehend zu bewirken, das kooperative Sicherheit durchaus ein besserer Weg sein könnte.
Fazit
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine Sicherheitskultur in Europa?
Der Text untersucht, ob nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa eine Sicherheitskultur entstanden ist, nachdem diese durch den Krieg zerstört wurde. Er betrachtet die Rolle Europas im Kontext des Kalten Krieges und die Einflüsse der UDSSR und der USA.
Was war die konfrontative Sicherheitskultur während des Kalten Krieges?
Während der Teilung Europas wurde eine gewalttätige Konfliktaustragung zwischen Ost und West durch Abschreckung und Wettrüsten verhindert. Das Sicherheitskonzept des Zweitschlages stabilisierte den Status Quo. Die USA verfolgten eine Eindämmungsstrategie gegenüber der UDSSR, während die UDSSR versuchte, die USA zu beeinflussen und interne Konflikte zu kontrollieren. Ab den 1960er Jahren entwickelte sich dies zu einem europäischen Sicherheitssystem mit Selbstbeschränkung und begrenzter Kooperation.
Wie entwickelte sich eine kooperative Sicherheitskultur?
Die Schlussakte von Helsinki wird als erster Beweis für eine kooperative Sicherheitskultur gesehen, insbesondere der "Korb III". Trotz unterschiedlicher Interessen einigten sich verfeindete Staaten auf gemeinsame Prinzipien und Werte. Die Charta von Paris wurde als neue Magna Charta für ein gemeinsames Europa gehandelt, geprägt von Kooperation aufgrund gemeinsamer Werte und Normen.
Was waren die Herausforderungen nach dem Ende der Konfrontation?
Der Balkankrieg zeigte, dass europäische Sicherheitskultur nicht einfach durch die Schaffung von Institutionen bewirkt werden kann. Der Konflikt kam zu früh, bevor Mechanismen ausreichend eingeübt waren. Es gab einen Profilierungsdrang der EU, der das Agieren der KSZE erschwerte. Allerdings setzte ein Lernprozess ein, der sich in neuen Verfahrensregeln der KSZE/OSZE widerspiegelte.
Welche Schritte sind für eine europäische Sicherheitskultur notwendig?
Selbstbeschränkung als politische Verhaltensweise muss erhalten bleiben. Konflikte wie auf dem Balkan müssen als europäische Angelegenheit betrachtet werden, und größere Staaten müssen sich Dritten gegenüber verpflichtet fühlen. Die Baltikumkonflikte zeigten, dass präventive Diplomatie und Früherkennung funktionieren können.
Wie ist Europa heute geteilt?
Europa ist durch die Diskontinuität der Entwicklungen und eine Heterogenität politischer Kulturen geteilt. Westeuropäische Sicherheitskultur muss Osteuropa stabilisieren, so wie zu Zeiten der konfrontativen Teilung. Die Menschen im Osten haben möglicherweise ein substantielleres Gefühl für ein gemeinsames Europa behalten als die im Westen.
Wie kann eine gemeinsame Sicherheitskultur erreicht werden?
Alle Staaten Europas befinden sich auf unterschiedlichen Evolutionsniveaus. Es muss gelingen, übergreifende Strukturen zu errichten, auch wenn dies durch unterschiedliche Aufgaben der einzelnen Länder erschwert wird. Europäische Kultur wird durch die praktische Anerkennung des Zusammenhangs und der Gemeinsamkeit der politischen Entwicklungsaufgaben im Westen und Osten Europas lebendig.
Was ist europäische Sicherheitskultur als Bezugsrahmen?
Europäische Sicherheitskultur ist nur im Kontext einer politischen Kultur Europas vorstellbar, in der es aufgeklärtes Eigeninteresse der Staaten ist, sich von übernationalen Gestaltungszielen leiten zu lassen. Dies erfordert Selbstbeschränkung und Schutzbereitschaft aus übergeordneten Interessen.
Welche Rolle spielen Normen und Werte?
Ab Ende der Achtziger spielen Normen eine wichtige Rolle. Der Gedanke einer Normen- und Wertegemeinschaft hat Einzug in die politische Alltagswelt gefunden. Gleichzeitig gibt es ein Comeback des Neorealismus mit Gewichtung von Macht und Nationalstaatlichkeit. Eigeninteresse und Machtsteigerung haben Konjunktur.
Was ist das Fazit des Textes?
Es hat sich einiges verändert, aber der Balkankrieg und die NATO-Osterweiterung waren Rückschläge. Der Gedanke einer Normen- und Wertegemeinschaft hat Einzug in die politische Alltagswelt gefunden. Eigeninteresse und Macht werden jedoch nie ganz aus der Politik zu verdrängen sein. Eine Synthese dieser Widersprüchlichkeiten ist möglicherweise erstrebenswert.
- Quote paper
- Christian Bliedtner (Author), 2000, Sicherheitskultur in Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104266