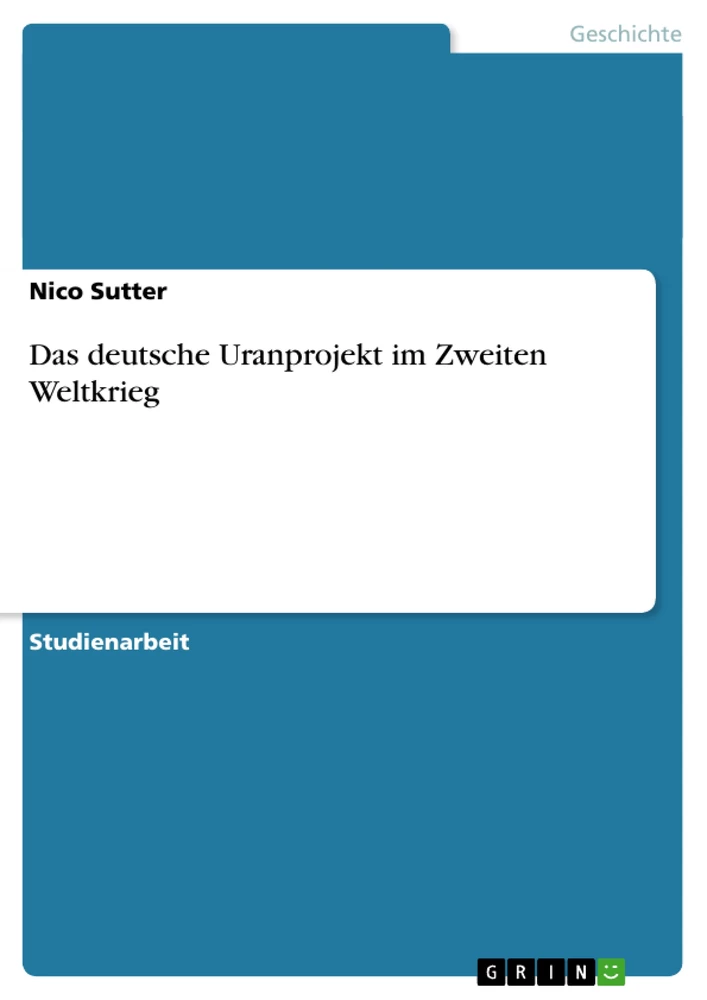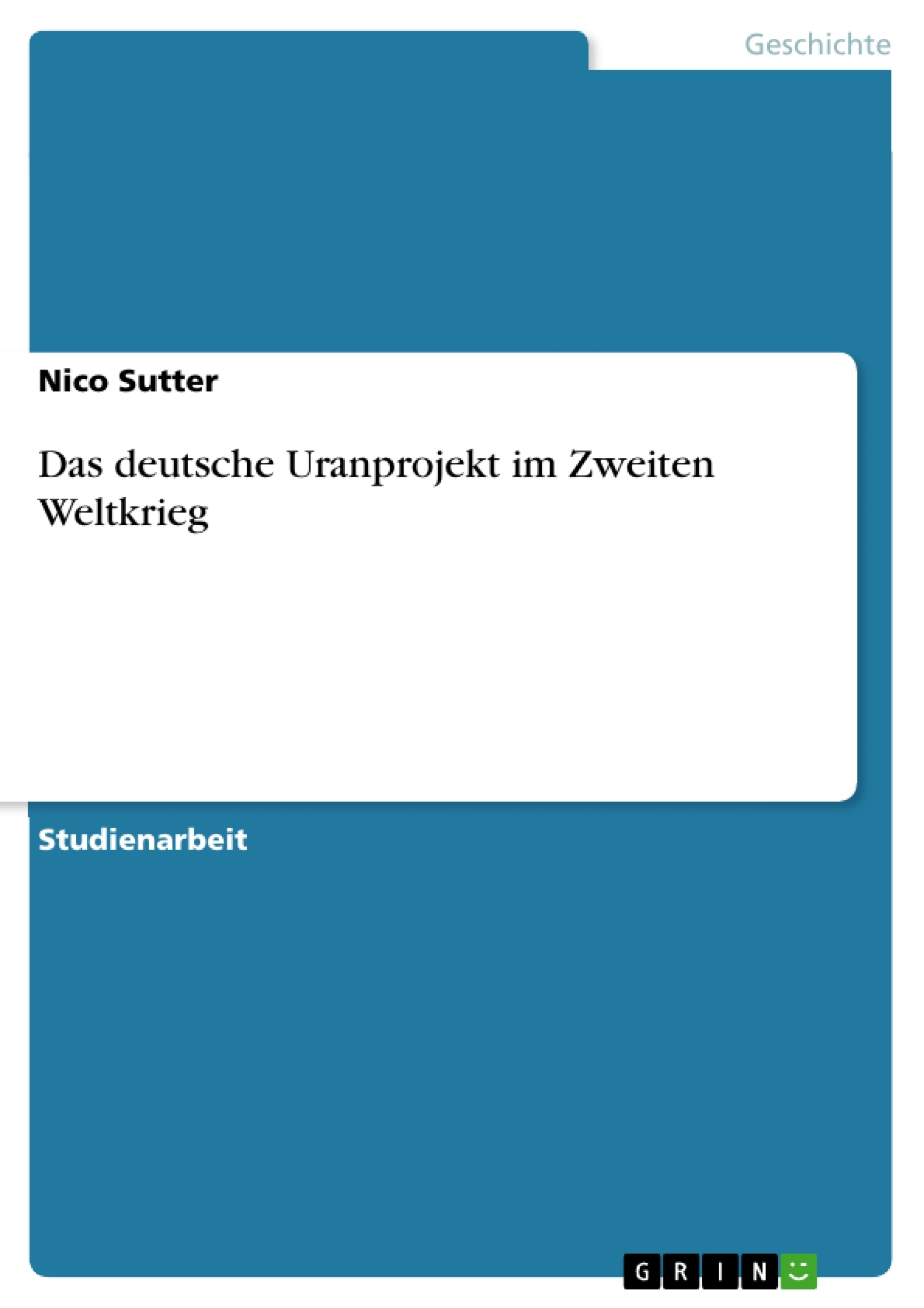Bereits unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg haben sich Forscher weltweit unabhängig voneinander bemüht, die 1938 entdeckte Kernenergie auf ihre militärische Anwendbarkeit zu prüfen. Damit einher ging die Idee von der Entwicklung einer völlig neuartigen Waffe. Dieser Auffassung ist jedenfalls Mark Walker, dessen 1989 erschienenes Buch „die Uranmaschine“1 den Verfassern dieser Arbeit als Hauptquelle gilt. Walker relativiert in seinem Werk den in seinen Augen von den deutschen Forschern um Heisenberg und von Weizsäcker selbst eingesetzten Nachkriegsmythos, die Deutschen hätten während des Krieges lediglich an der ’friedlichen’ Nutzung der Kernenergie jenseits ihrer militärischen Anwendungsmöglichkeiten geforscht. Darüber hinaus wendet er sich entschieden gegen die von deutschen Forschern nach dem Krieg aufgestellte Schutzbehauptung, sie hätten sogar aufgrund von persönlichen moralischen Bedenken die mögliche Konstruktion einer Atombombe verhindert, beziehungsweise deren Entwicklung bewusst verschleppt. Dem amerikanischen Historiker Walker waren dazu erstmals auch die von den Siegermächten beschlagnahmten und lange unter Verschluss gehaltenen Akten der NS - Zeit zugänglich, in denen die enge Korrespondenz von am Kernenergieprojekt beteiligten Wissenschaftlern mit dem Heereswaffenamt deutlich zutage tritt. Bezeichnenderweise ist die Richtigstellung der deutschen Nachkriegsapologie in diesem Punkt einem Amerikaner überlassen worden, der das deutsche Uranprojekt mit einigem Verständnis für deutsche Wissenschaftler unter dem Regime der Nationalsozialisten beschreibt, aber auch dezidiert das Hand-in-Hand-Arbeiten von Wissenschaft und Politik und die wahren Gründe für das Scheitern des Kernenergieprojektes offenlegt. Vielleicht bedurfte es dazu des ’Blickes von außen’, wobei der Einwand von Zeitzeugen Walker gegenüber, die “Bedrohungen und Erpressungen einer übermächtigen und brutalen Staatsmacht” nicht am eigenen Leib erlebt zu haben und damit auch nicht in der Lage zu sein, sie ganz zu begreifen, von ihnen benutzt wird, um sich dem nachträglichen Urteil Walkers zu entziehen. Als weitere Orientierungshilfe, besonders hinsichtlich der wissenschaftspolitischen Konflikte zwischen Vertretern der “deutschen Physik” und der theoretischen Physik im Nationalsozialismus ist das Buch von Gabriele Metzler: “Internationale Wissenschaft und nationale Kultur anzusehen [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen
- Die Entdeckung der Kernspaltung
- Die internationale Ausgangslage zu Beginn des Zweiten Weltkrieges
- Die Entwicklung des deutschen Uranprojekts
- 'Deutsche Physik' contra theoretische Physik
- Die Phase des 'Blitzkrieges'
- Das Heereswaffenamt gibt das Projekt ab
- Alsos-Mission und Farm-Hall
- Die Gründe für das Scheitern des deutschen Uranprojekts
- Der Vergleich mit dem 'Manhattan-District-Project' der Amerikaner
- Der Mythos über die deutsche Atombombe
- Rechtfertigung der Wissenschaftler nach dem deutschen Zusammenbruch
- Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und dem Scheitern des deutschen Uranprojekts während des Zweiten Weltkriegs. Dabei werden die Gründe für dieses Scheitern untersucht und die komplexe Beziehung zwischen Wissenschaft und nationalsozialistischer Politik beleuchtet.
- Entwicklung und Scheitern des deutschen Uranprojekts
- Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik im Nationalsozialismus
- Die Rolle von Wissenschaftlern im Kontext des Projekts
- Der Vergleich mit dem amerikanischen 'Manhattan-District-Project'
- Der Mythos über die deutsche Atombombe und dessen Entstehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Hauptschlussfolgerung des Buches von Mark Walker dar, wonach die deutsche Forschung während des Krieges nicht ausschließlich auf die "friedliche" Nutzung der Kernenergie ausgerichtet war. Die Relevanz der von Walker offen gelegten Korrespondenz zwischen beteiligten Wissenschaftlern und dem Heereswaffenamt wird betont. Das erste Kapitel widmet sich der Entdeckung der Kernspaltung im Jahre 1938, wobei die Beiträge von Fritz Strassmann, Lise Meitner und Otto Hahn ausführlich erläutert werden. Das zweite Kapitel thematisiert die Entwicklung des deutschen Uranprojekts unter der NS-Herrschaft, einschließlich der Konflikte zwischen "deutscher Physik" und theoretischer Physik.
Schlüsselwörter
Deutsches Uranprojekt, Kernenergie, Zweiter Weltkrieg, "Deutsche Physik", theoretische Physik, Nationalsozialismus, Verhältnis von Wissenschaft und Politik, "Manhattan-District-Project", Atombombe, Nachkriegsmythos.
Häufig gestellte Fragen
Woran forschte das deutsche Uranprojekt im Zweiten Weltkrieg wirklich?
Entgegen dem Nachkriegsmythos der rein "friedlichen" Nutzung belegen Akten eine enge Korrespondenz mit dem Heereswaffenamt zur Prüfung militärischer Anwendungen der Kernenergie.
Wer waren die Schlüsselfiguren bei der Entdeckung der Kernspaltung?
Die Entdeckung im Jahr 1938 wird Otto Hahn, Fritz Straßmann und Lise Meitner zugeschrieben.
Warum scheiterte das deutsche Kernenergieprojekt?
Gründe waren unter anderem mangelnde Ressourcen, wissenschaftspolitische Konflikte ("Deutsche Physik" vs. theoretische Physik) und die fehlende Priorisierung im Vergleich zum US-Manhattan-Projekt.
Was war der Nachkriegsmythos der beteiligten Wissenschaftler?
Forscher wie Heisenberg und von Weizsäcker behaupteten nach dem Krieg oft, sie hätten die Entwicklung einer Atombombe aus moralischen Bedenken bewusst verzögert.
Welche Rolle spielten die Farm-Hall-Protokolle?
Diese Aufzeichnungen abgehörter Gespräche deutscher Wissenschaftler in britischer Gefangenschaft gaben wichtige Einblicke in deren tatsächlichen Kenntnisstand und ihre Reaktionen auf die Atombombenabwürfe.
- Arbeit zitieren
- Nico Sutter (Autor:in), 2001, Das deutsche Uranprojekt im Zweiten Weltkrieg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10418