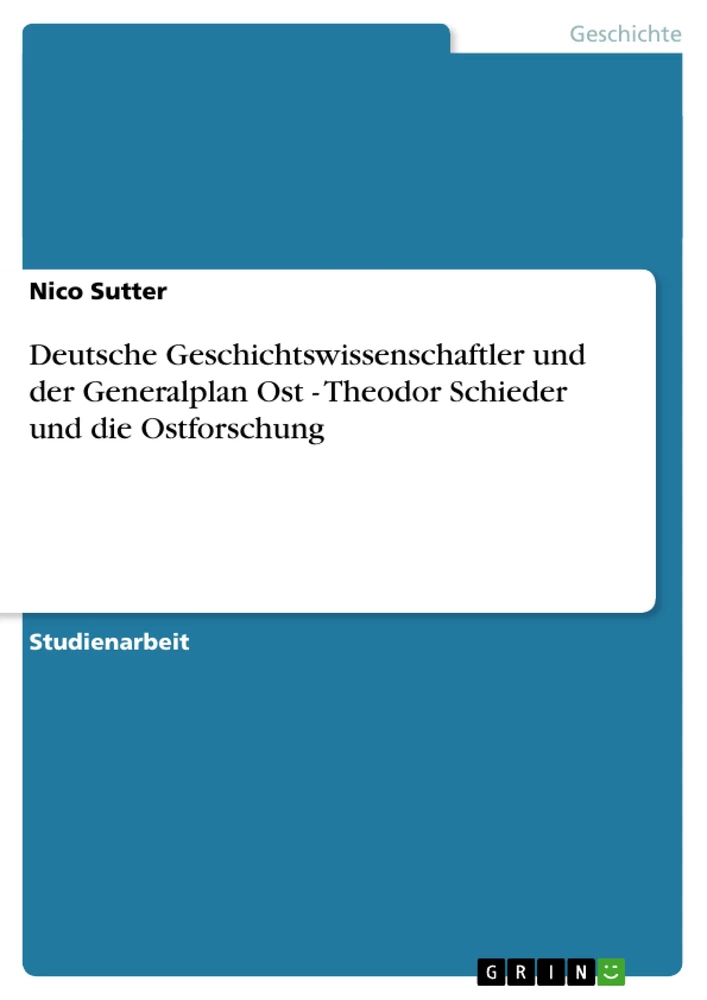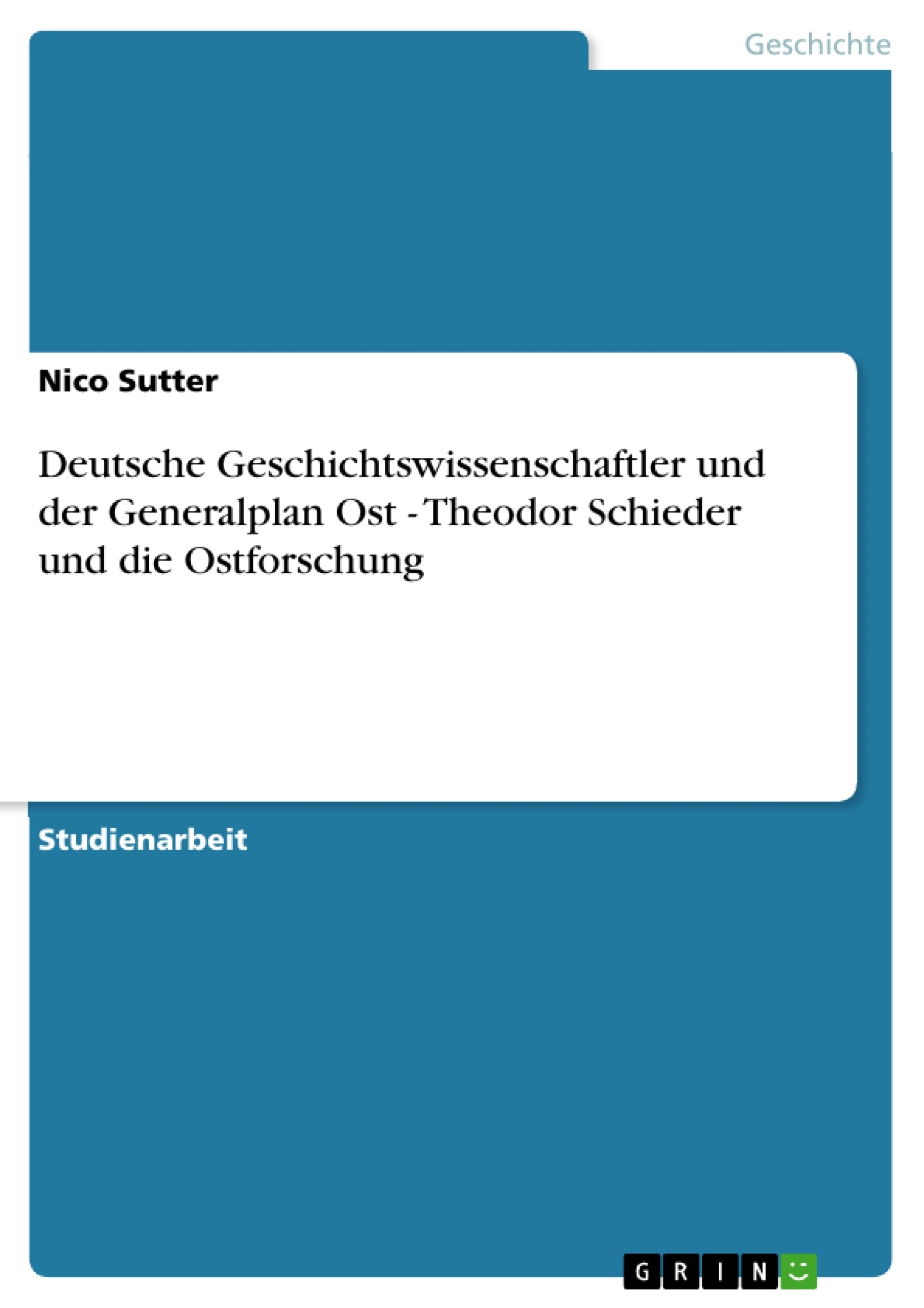Es verging viel Zeit, bis sich die Zunft der deutschen Historiker öffentlich eingehender mit ihrer jüngsten Vergangenheit zu beschäftigen begann. Genauer gesagt dauerte es 53 Jahre, bis auf dem 42. deutschen Historikertag, der vom 8. bis zum 11. September 1998 in Frankfurt abgehalten wurde, erstmals offen und kontrovers über die mittelbare oder unmittelbare Beteiligung deutscher Geschichtswissenschaftler an der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik diskutiert wurde.1 „Schließlich hatten an der imperialistischen Theorie des Nazismus zahllose Historiker mitgearbeitet und zuvor oder gleichzeitig definiert, wo deutscher ‚Volksboden’ und Lebensraum zu finden, wer minderwertig oder höherwertig sei.“2 Dabei konzentrierten sich die Konferenzteilnehmer nicht nur auf jene Geschichtswissenschaftler, die im Zuge der Entnazifizierungen aus öffentlichen Ämtern suspendiert worden waren,3 sondern speziell auf diejenigen, die nach 1945 das bundesrepublikanische Bild der Geschichtswissenschaft entscheidend mitgeprägt hatten. Theodor Schieder ist dabei nur ein Beispiel für die Kontinuitäten im geschichtswissenschaftlichen Betrieb nach 1945. Er war nach Aussage eines seiner ehemaligen Studenten, „in den fünfundzwanzig Jahren vor seinem Tod 1984 die einflußreichste Persönlichkeit in der westdeutschen Geschichtswissenschaft“4 und verdient daher besondere Aufmerksamkeit. Der späte Zeitpunkt, an dem die Debatte über die braune Vergangenheit deutscher Historiker aufkam und eine breitere Öffentlichkeit erreichte, ist auch insofern interessant, weil Angelika Ebbinghaus und Karl-Heinz Roth bereits 1992 ein bevölkerungspolitisches Geheimgutachten Schieders – die sogenannte Polendenkschrift - vom September 1939 editierten.5 Die deutsche Historikerschaft, unter ihnen nicht wenige Schüler Schieders, wie z.B. Hans Ulrich Wehler, ignorierten diese Funde jahrelang – bis zum besagten Historikertag in Frankfurt. Die von Roth und Ebbinghaus erforschten Quellen zeichnen ein neues Bild vom Vater der Sozialgeschichte in der BRD: Schieder hatte sich während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland besonders für den vor 1918 ehemals deutschen Osten interessiert und war auf dem Gebiet revisionistisch orientierter ‚Ostforschung’ einer der vielversprechensten Nachwuchsakademiker [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der "Generalplan Ost"
- Vorgeschichte
- Volkstums- und Ostforschung in der Weimarer Republik
- Ostforschung im NS
- Angewandte "Ostforschung"
- Die "Polendenkschrift" und der "Generalplan Ost"
- Ost- und Volkstumsforscher im Feld
- Verantwortlichkeit und Nachkriegskarriere am Beispiel Schieders
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle deutscher Geschichtswissenschaftler, insbesondere Theodor Schieder, im Zusammenhang mit dem "Generalplan Ost". Ziel ist es aufzuzeigen, wie die "Ostforschung" und "Volkstumsforschung" zum "Generalplan Ost" beitrugen und welche Kontinuitäten zwischen der Forschung vor und nach 1945 bestanden. Die Arbeit beleuchtet die Verantwortung der beteiligten Wissenschaftler nach dem Krieg.
- Die Entwicklung der "Ostforschung" und "Volkstumsforschung" im 20. Jahrhundert.
- Der Beitrag der "Ostforschung" zur Konzeption des "Generalplan Ost".
- Die Rolle von Theodor Schieder und seiner "Polendenkschrift".
- Die Nachkriegskarrieren beteiligter Wissenschaftler und ihre Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
- Kontinuitäten in der deutschen Geschichtswissenschaft zwischen Weimarer Republik, NS-Zeit und Bundesrepublik.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den späten Beginn der öffentlichen Debatte über die Beteiligung deutscher Historiker am Nationalsozialismus und stellt Theodor Schieder als einflussreiche Persönlichkeit der westdeutschen Geschichtswissenschaft vor, dessen Rolle im Kontext des "Generalplan Ost" untersucht werden soll. Die Veröffentlichung der "Polendenkschrift" Schieders im Jahr 1992 und deren anfängliche Ignoranz durch die Fachwelt werden hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Kontinuitäten in der Geschichtswissenschaft nach 1945 und der Rolle Schieders darin.
Der "Generalplan Ost": Dieses Kapitel stellt den "Generalplan Ost" (GPO) als detaillierten Plan zur bevölkerungspolitischen und geopolitischen Behandlung der eroberten Gebiete im Osten vor. Es wird betont, dass der vollständige Plan bis heute verschollen ist, aber anhand von vorhandenen Quellen rekonstruiert werden kann. Der Fokus liegt auf den Ursprüngen des Plans und seiner Umsetzung.
Vorgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der "Volkstums-" und "Ostforschung" in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Es zeigt die ideologischen Grundlagen und die zunehmend radikalisierende Ausrichtung der Forschung auf, die schließlich in den Genozid mündete. Es werden die inhärenten Kontinuitäten zwischen diesen Forschungsbereichen und dem "Generalplan Ost" herausgestellt, die den Weg für die späteren Verbrechen ebneten.
Angewandte "Ostforschung": Dieses Kapitel konzentriert sich auf die "Polendenkschrift" Schieders als ein wichtiges Dokument, das Handlungsanweisungen und Vorschläge für die bevölkerungspolitische Behandlung Polens enthielt. Es wird der Einfluss dieser Schrift auf die Ausarbeitung des "Generalplan Ost" durch Konrad Meyer untersucht und die Beteiligung von Ost- und Volkstumsforschern an der Umsetzung des Plans im Feld beschrieben. Die Kapitel betonen den Zusammenhang zwischen akademischer Forschung und der nationalsozialistischen Politik.
Verantwortlichkeit und Nachkriegskarriere am Beispiel Schieders: Dieses Kapitel untersucht die Nachkriegskarriere von Theodor Schieder und anderer beteiligter Wissenschaftler. Es analysiert, wie diese trotz ihrer Beteiligung am "Generalplan Ost" oder ähnlichen Projekten hohe Positionen in der westdeutschen Geschichtswissenschaft erreichten und wie sie mit ihrer Vergangenheit umgingen. Der Fokus liegt auf der fehlenden Aufarbeitung der eigenen Rolle im Nationalsozialismus.
Schlüsselwörter
Generalplan Ost, Ostforschung, Volkstumsforschung, Theodor Schieder, Polendenkschrift, Nationalsozialismus, Geschichtswissenschaft, Kontinuität, Verantwortung, Nachkriegszeit, Genozid, Bevölkerungspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Der Generalplan Ost und die Rolle deutscher Geschichtswissenschaftler"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle deutscher Geschichtswissenschaftler, insbesondere Theodor Schieder, im Zusammenhang mit dem "Generalplan Ost". Der Fokus liegt auf der Analyse des Beitrags von "Ostforschung" und "Volkstumsforschung" zum "Generalplan Ost" und der Untersuchung von Kontinuitäten in der Forschung vor und nach 1945. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beleuchtung der Verantwortung der beteiligten Wissenschaftler nach dem Krieg.
Was ist der "Generalplan Ost"?
Der "Generalplan Ost" (GPO) war ein detaillierter Plan der Nationalsozialisten zur bevölkerungspolitischen und geopolitischen Behandlung der eroberten Gebiete im Osten Europas. Obwohl der vollständige Plan verschollen ist, lässt er sich anhand vorhandener Quellen rekonstruieren. Er umfasste weitreichende Pläne zur Umsiedlung und Vernichtung slawischer Bevölkerungsgruppen.
Welche Rolle spielte die "Ostforschung" und "Volkstumsforschung"?
Die Arbeit zeigt auf, wie die "Ostforschung" und "Volkstumsforschung" in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus ideologisch vorbereitet und zunehmend radikalisiert wurden, bis hin zum Genozid. Sie beschreibt die inhärenten Kontinuitäten zwischen diesen Forschungsbereichen und dem "Generalplan Ost", welche den Weg für die späteren Verbrechen ebneten. Diese Forschung lieferte die wissenschaftliche Legitimation für die nationalsozialistische Politik.
Welche Bedeutung hat die "Polendenkschrift" Schieders?
Die "Polendenkschrift" von Theodor Schieder ist ein zentrales Dokument dieser Arbeit. Sie enthielt Handlungsanweisungen und Vorschläge für die bevölkerungspolitische Behandlung Polens und hatte Einfluss auf die Ausarbeitung des "Generalplan Ost". Die Arbeit untersucht den Einfluss dieser Schrift und die Beteiligung von Ost- und Volkstumsforschern an der Umsetzung des Plans.
Wie wird die Nachkriegskarriere von Theodor Schieder behandelt?
Die Arbeit analysiert die Nachkriegskarriere Schieders und anderer beteiligter Wissenschaftler. Sie untersucht, wie diese trotz ihrer Beteiligung am "Generalplan Ost" oder ähnlichen Projekten hohe Positionen in der westdeutschen Geschichtswissenschaft erreichten und wie sie mit ihrer Vergangenheit umgingen. Ein Schwerpunkt liegt auf der fehlenden Aufarbeitung der eigenen Rolle im Nationalsozialismus und den damit verbundenen Kontinuitäten in der deutschen Geschichtswissenschaft.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der "Ostforschung" und "Volkstumsforschung", den Beitrag der "Ostforschung" zur Konzeption des "Generalplan Ost", die Rolle von Theodor Schieder und seiner "Polendenkschrift", die Nachkriegskarrieren beteiligter Wissenschaftler und deren Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sowie Kontinuitäten in der deutschen Geschichtswissenschaft zwischen Weimarer Republik, NS-Zeit und Bundesrepublik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Generalplan Ost, Ostforschung, Volkstumsforschung, Theodor Schieder, Polendenkschrift, Nationalsozialismus, Geschichtswissenschaft, Kontinuität, Verantwortung, Nachkriegszeit, Genozid, Bevölkerungspolitik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, zum "Generalplan Ost", zur Vorgeschichte (Volkstums- und Ostforschung in der Weimarer Republik und im NS), zur angewandten "Ostforschung" (inkl. der "Polendenkschrift"), und zur Verantwortung und Nachkriegskarriere am Beispiel Schieders.
- Citar trabajo
- Nico Sutter (Autor), 2003, Deutsche Geschichtswissenschaftler und der Generalplan Ost - Theodor Schieder und die Ostforschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10417