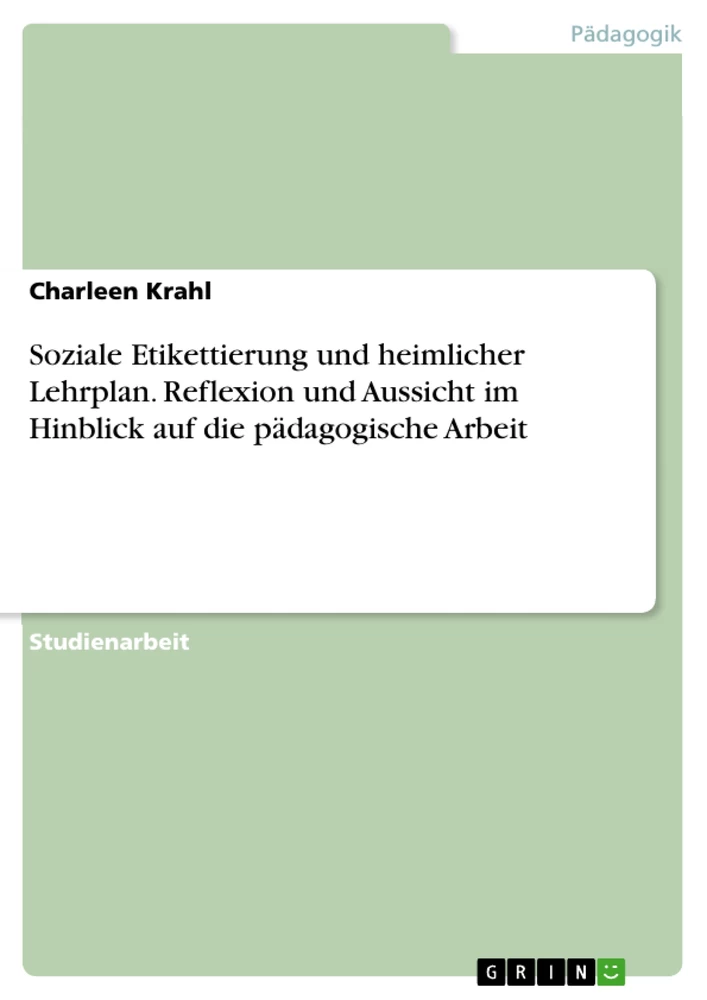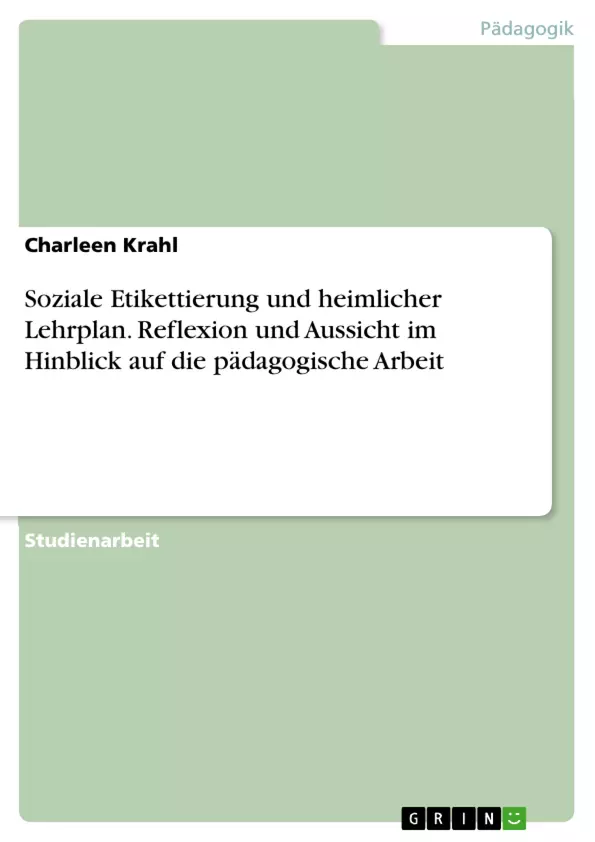In dieser Arbeit geht es um die Frage, wie die soziale Herkunft der Schüler*innen ihre schulischen Leistungen sowie ihr Sozialverhalten im Klassenzimmer beeinflusst.
Eine Antwort auf die Frage „What really goes on in classrooms?" könnte sein: Ein Grundlegungskurs im Sozialverhalten. Festgelegte – zum Teil unausgesprochene – Regeln und Routinen sind in diesem Grundlegungskurs inbegriffen, um den (offensichtlichen) Ansprüchen der Gesellschaft gewappnet zu sein und ihnen zu „genügen“. Warum sonst hängen Belohnungen nicht selten weniger mit den Leistungen als viel mehr mit einem konformen Umgang des heimlichen Lehrplans zusammen? Warum sonst werden Schüler*innen dafür belohnt, dass sie es überhaupt versuchen? Wird dabei der Versuch belohnt, den Erwartungen der Institution an das Handeln nachzukommen? .
Trotz fehlenden guten Schulleistungen werden diese Schüler*innen nur in den seltensten Fällen genauso behandelt, wie Schüler*innen mit gleichen Schulleistungen und mangelndem Sozialverhalten. Auf dem ersten Blick scheinen diese Erwartungen auch nichts Umstrittenes zu sein, aber auffälliger als die gute Führung, die sich auszahlt, ist die Beziehung zwischen dem heimlichen Lehrplan und Schülerschwierigkeiten. Lehrer*in-Schüler*in-Beziehungen werden mehr durch die Verletzung von Regeln als durch geistige Fehlleistungen gefährdet.
In diesem Sinne lernen Schüler*innen in der Schule auch, wie sie mithilfe bürokratischer Ordnungen an ein Leistungsziel kommen, ohne den geforderten Leistungen des Lernziels zu genügen – sei es mit Bluffen oder dem Schmeicheln des Lehrpersonals. Schüler*innen wissen, dass sie nicht für das Leben lernen, sondern für die Gesetzmäßigkeiten der Institution Schule wie beispielsweise für einen Leistungstest. Ist dieses Korrelieren der beiden Lehrpläne miteinander ergänzend oder widersprechend? Ist es notwendig oder hemmend?
Inhaltsverzeichnis
- „WHAT REALLY GOES ON IN CLASSROOMS”? (JACKSON) (ZINNECKER, 1975, S. 8)
-
DER HEIMLICHE LEHRPLAN: EIN VERSUCH ZUR REFLEXION FÜR DIE PÄDAGOGISCHE ARBEIT
- DER HEIMLICHE LEHRPLAN: ES WERDEN MINDERWERTIGKEITSGEFÜHLE ENTWICKELT
- DER HEIMLICHE LEHRPLAN: SOZIAL SCHWACHE SCHÜLER*INNEN HABEN AUCH SCHLECHTERE SCHULLEISTUNGEN
- DER HEIMLICHE LEHRPLAN: DIE ENTSTEHUNG DES GEFÜHLS VOM ANDERSSEIN
- AUSBLICKSMÖGLICHKEITEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des "heimlichen Lehrplans" auf die pädagogische Praxis. Der Fokus liegt auf der Reflexion der Bedeutung von institutionellen Normen und Werten im Vergleich zu den individuellen Bedürfnissen und Lernmöglichkeiten von Schüler*innen.
- Die Interaktion zwischen dem offiziellen und dem "heimlichen" Lehrplan
- Die Entwicklung von Minderwertigkeitsgefühlen durch den "heimlichen" Lehrplan
- Der Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und schulischer Leistung
- Die Rolle der Heterogenität und Inklusion in der pädagogischen Praxis
- Die Bedeutung von Selbstentfaltung und individueller Förderung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Frage, was im Klassenzimmer tatsächlich passiert. Es wird argumentiert, dass der "heimliche" Lehrplan eine zentrale Rolle bei der Sozialisierung von Schüler*innen spielt. Kapitel zwei untersucht die Auswirkungen des "heimlichen" Lehrplans auf die Entwicklung von Minderwertigkeitsgefühlen bei Schüler*innen. Es wird gezeigt, wie der "heimliche" Lehrplan dazu beitragen kann, dass Schüler*innen sich den Werten der Institution anpassen, anstatt ihren eigenen Werten zu folgen.
Schlüsselwörter
Heimlicher Lehrplan, Sozialisation, Minderwertigkeitsgefühle, Heterogenität, Inklusion, Selbstentfaltung, Institutionelle Normen, Pädagogische Praxis, Leistungsentwicklung, Sozial Benachteiligung.
- Citar trabajo
- Charleen Krahl (Autor), 2020, Soziale Etikettierung und heimlicher Lehrplan. Reflexion und Aussicht im Hinblick auf die pädagogische Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040613