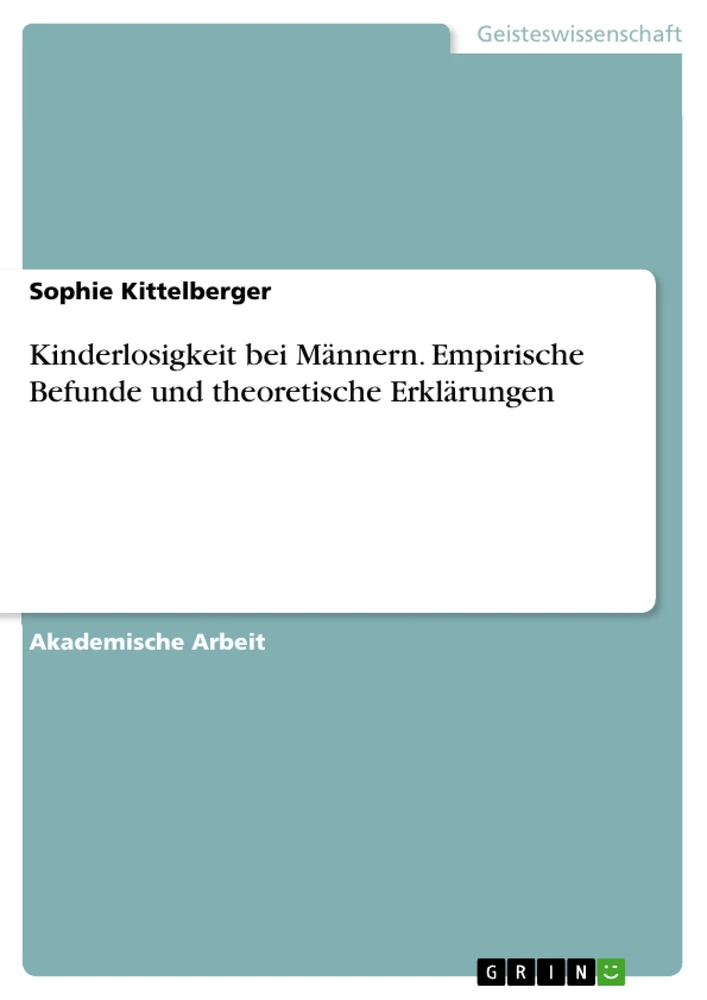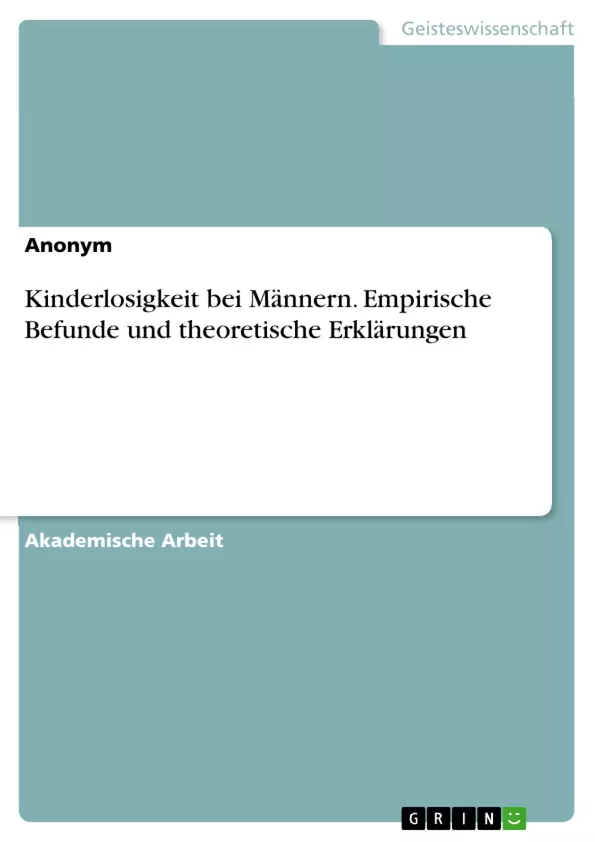Ziel dieser Arbeit ist ein Überblick zum Forschungsstand des Themas Kinderlosigkeit bei Männern. Nicht geliefert werden kann der volle Umfang der bisherigen Forschung. Die genannten Studien sollen dabei lediglich rezipiert, nicht jedoch in ihrem methodischen Vorgehen ausführlich und kritisch beurteilt werden.
Kinderlosigkeit ist seit Langem ein in der empirischen Sozialforschung beobachtetes Phänomen. Im soziologischen Diskurs finden sich häufig Studien, welche die sozioökonomischen Merkmale von Kinderlosen untersuchen. Die Ursachen für Kinderlosigkeit werden zumeist in handlungstheoretische Konzepte generativen Handelns eingebettet. Der Fokus liegt dabei häufig auf dem generativen Verhalten von Frauen. Nur selten wird das Phänomen Kinderlosigkeit von Männern untersucht.
Die marginale Berücksichtigung der Kinderlosigkeit bei Männern wird zum Teil auf biologische Gründe geschoben. Die fruchtbare Phase von Männern sei unbestimmbar, was die Einstufung als endgültig kinderlos für Männer quasi unmöglich macht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand
- 2.1 Quantitative Studien
- 2.2 Qualitative Studien
- 2.3 Ausländische Studien
- 2.4 Spezifische Studien
- 2.5 Interdisziplinäre Forschung
- 2.6 Zusammenfassung und kritische Beurteilung
- 3 Theoriebezug und Schlussbetrachtung
- 3.1 Konzepte der Normativität
- 3.2 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen komprimierten Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Kinderlosigkeit bei Männern. Sie beleuchtet verschiedene Studien, die sich mit den sozioökonomischen Merkmalen kinderloser Männer, Einstellungen zu Elternschaft, institutionellen Rahmenbedingungen sowie biologischen und psychologischen Faktoren befassen. Die Arbeit soll den Fokus auf die Ergebnisse der bisherigen Forschung legen und Forschungslücken aufzeigen.
- Sozioökonomische Merkmale kinderloser Männer
- Einstellungen zu Elternschaft bei Männern
- Institutionelle Rahmenbedingungen von Elternschaft
- Biologische und psychologische Faktoren, die Kinderlosigkeit beeinflussen
- Normative gesellschaftliche Erwartungen und ihre Auswirkungen auf die Entscheidung für oder gegen Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema Kinderlosigkeit bei Männern in den Kontext der empirischen Sozialforschung und erläutert, warum die Kinderlosigkeit von Männern bisher in der Forschung weniger Aufmerksamkeit erhalten hat. Sie beleuchtet die Ursachen für diese Vernachlässigung, die sowohl biologischer, ideologischer als auch praktischer Natur sind. Die Einleitung führt außerdem aktuelle Daten zum Anteil kinderloser Männer in Deutschland ein und stellt die Ziele und den Umfang der Arbeit dar.
2 Forschungsstand
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den bisherigen Forschungsstand zum Thema Kinderlosigkeit bei Männern. Es werden verschiedene Studien vorgestellt, die sowohl quantitative als auch qualitative Ansätze verfolgen. Die Studien befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten der Kinderlosigkeit, darunter die sozioökonomischen Merkmale kinderloser Männer, ihre Einstellungen zu Elternschaft, die institutionellen Rahmenbedingungen von Elternschaft sowie biologische und psychologische Faktoren.
2.1 Quantitative Studien
Dieser Abschnitt behandelt quantitative Studien, die die Charakteristika kinderloser Männer anhand großer Datensätze wie dem SOEP oder dem Bamberger-Ehepaar-Panel untersuchen. Die Studien zeigen, dass die Erklärungskraft für Kinderlosigkeit bei Männern in Faktoren wie dem Bildungsniveau, dem Erwerbsstatus, dem Einkommen, dem Partnerschaftsstatus, dem Wunsch nach einem autonomen Lebensstil und dem Einfluss sozialer Druck durch die eigenen Eltern liegt.
2.2 Qualitative Studien
Dieser Abschnitt beleuchtet qualitative Studien, die Einblicke in die Lebenswelten und Entscheidungen kinderloser Männer bieten. Sie untersuchen die Einstellungen, Motivationen und Erfahrungen von Männern, die sich gegen Elternschaft entscheiden, und analysieren die individuellen und gesellschaftlichen Faktoren, die diese Entscheidungen beeinflussen.
2.3 Ausländische Studien
Dieser Abschnitt stellt Studien aus dem Ausland vor, die vergleichende Einblicke in die Situation kinderloser Männer in anderen Ländern bieten. Sie zeigen, wie sich kulturelle, gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen auf die Entscheidungen von Männern in Bezug auf Elternschaft auswirken.
2.4 Spezifische Studien
Dieser Abschnitt beleuchtet Studien, die spezielle Aspekte des Forschungsgegenstandes genauer untersuchen. Hierzu gehören Studien, die sich mit den Auswirkungen von Kinderlosigkeit auf die Karriereentwicklung von Männern, mit den Auswirkungen von Kinderlosigkeit auf die Beziehungen zu Partnerinnen oder mit den Auswirkungen von Kinderlosigkeit auf die psychische Gesundheit von Männern befassen.
2.5 Interdisziplinäre Forschung
Dieser Abschnitt stellt Studien vor, die interdisziplinäre Ansätze verfolgen und Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen wie Soziologie, Psychologie, Demografie und Ökonomie zusammenführen, um ein umfassenderes Verständnis der Ursachen und Auswirkungen von Kinderlosigkeit bei Männern zu entwickeln.
2.6 Zusammenfassung und kritische Beurteilung
Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Ergebnisse der vorgestellten Studien zusammen und bietet eine kritische Beurteilung der jeweiligen Methoden und der gewonnenen Erkenntnisse. Er identifiziert Forschungslücken und zeigt, welche weiteren Forschungsansätze notwendig sind, um das Thema Kinderlosigkeit bei Männern umfassender zu verstehen.
Schlüsselwörter
Kinderlosigkeit, Männer, Soziologie, Forschungsstand, quantitative Studien, qualitative Studien, sozioökonomische Merkmale, Einstellungen zu Elternschaft, institutionelle Rahmenbedingungen, biologische Faktoren, psychologische Faktoren, Normativität, gesellschaftliche Erwartungen, Male-Breadwinner-Modell.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Kinderlosigkeit bei Männern. Empirische Befunde und theoretische Erklärungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1039273