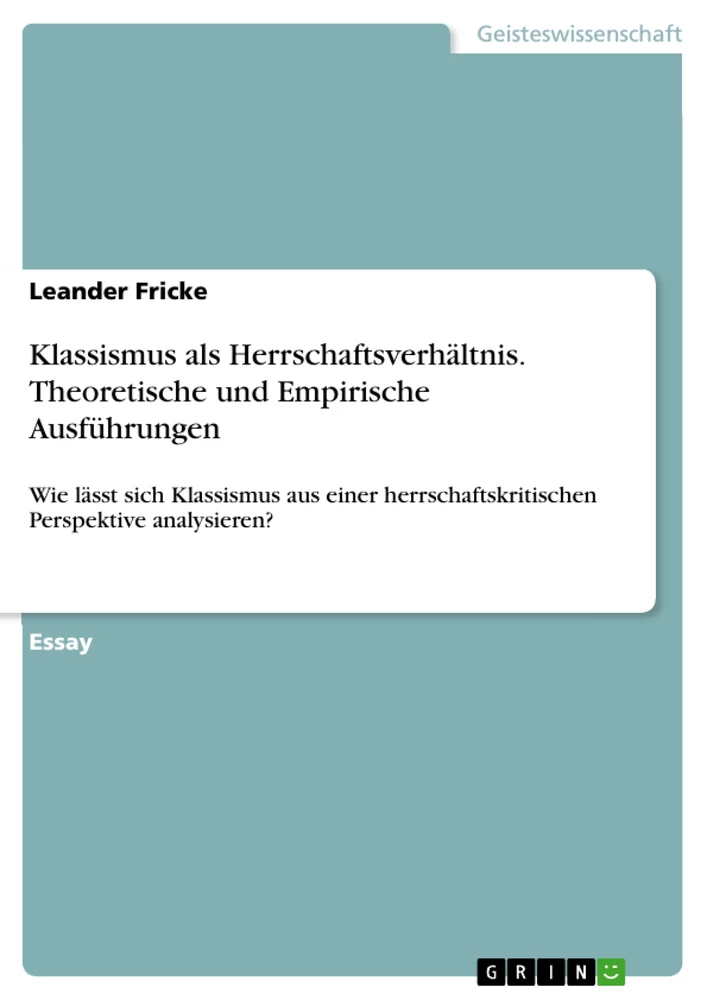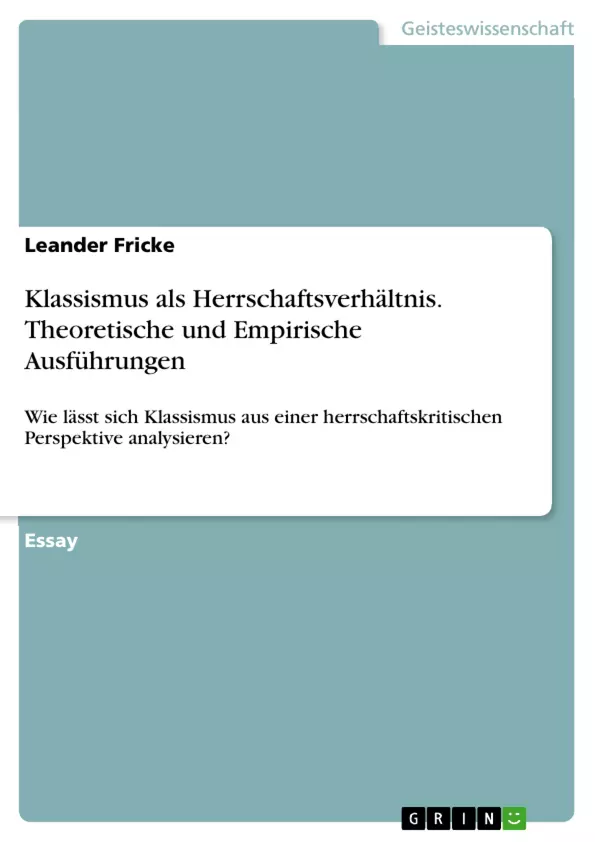Diskussionsstränge, die sich mit Feldern der Gleichberechtigung und Vielfalt beschäftigen, gehören in der BRD, zumal in akademischen Kreisen, zum festen Bestanteil der gesamtgesellschaftlichen Diskussionskultur. Zyklisch wird in mehr oder weniger reflektierten Debatten mit dem Oberbegriff der „Diversität“ um Nationalität, Geschlecht und Ethnizität gestritten. Ohne in diesem Essay genannte soziale Differenzkonstruktionen und dessen Wichtigkeit der Diskussion zu torpedieren, soll nun auf eine, oft vergessene jedoch grundsätzliche, und mit „race“ und „gender“ ineinandergreifende, Dimension des gesellschaftlichen Trennungsprinzips, der Hierarchisierung und Strukturierung eingegangen werden, dessen Analysen und Diskriminierungsformen unter dem Begriff „Klassismus“ subsumiert und diskutiert werden.
Auch wenn sich der Terminus, zumindest in Deutschland, noch eher wenig Bekanntheit erfreut, denke ich, ist davon auszugehen, dass das inhaltliche Wissen über klassistische Strukturen, zumindest in ihrer Grundsätzlichkeit, wie das Wissen über soziale Herkunft bedingte Bildungsverläufe, weit verbreiteter ist als der theoretisch und analytisch zugänglich machende Begriff. Eine Vermittlung scheint hier also dringend von Nöten.
Inhaltsverzeichnis
- 4. Klassismus als Herrschaftsverhältnis
- 4.1 Klassismus als gesellschaftliches Trennungsprinzip
- 4.2 Klassismus und die Herstellung sozialer Status
- 4.3 Habitus: Vermittlung und Internalisierung von Herrschaftsstrukturen
- 4.4 Symbolische Gewalt: Die Legitimation von Klassismus
- 4.5 Klassismus und das Bildungssystem: Kulturelle Reproduktion und symbolische Gewalt
- 4.6 Klassismus und die Diskriminierung aufgrund der sozialen Position
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert den Begriff des Klassismus als ein unterschätztes und oft vergessenes gesellschaftliches Trennungsprinzip. Er untersucht die Mechanismen und Prozesse, die zur Reproduktion von Klassismus führen, insbesondere durch die Verinnerlichung von Herrschaftsstrukturen im Habitus. Die Analyse konzentriert sich auf die symbolische Gewalt, die eine zentrale Rolle bei der Legitimierung und Verschleierung klassistischer Herrschaftsverhältnisse spielt.
- Klassismus als gesellschaftliches Trennungsprinzip und Diskriminierungsform
- Die Rolle des Habitus bei der Vermittlung und Internalisierung von Herrschaftsstrukturen
- Symbolische Gewalt als zentrale Legitimationsstrategie von Klassismus
- Die Bedeutung des Bildungssystems für die Reproduktion von Klassismus
- Klassismus und die Diskriminierung aufgrund der sozialen Position
Zusammenfassung der Kapitel
- 4.1 Klassismus als gesellschaftliches Trennungsprinzip: Der Essay führt den Begriff des Klassismus ein und beschreibt ihn als eine diskriminierende Haltung gegenüber Personen oder Gruppen, die auf ihrer sozialen Herkunft oder Position basiert. Er argumentiert, dass Klassismus ein grundlegendes Element der gesellschaftlichen Strukturierung und Hierarchisierung darstellt.
- 4.2 Klassismus und die Herstellung sozialer Status: Hier werden die Mechanismen der Herstellung von sozialem Status im Kontext von Klassismus erläutert. Dabei werden die sozialen Indikatoren soziale Herkunft und soziale Position sowie die ihnen zugrundeliegenden Kriterien wie Vermögen, Macht und Einkommen betrachtet. Die Analyse unterstreicht die Bedeutung der sozialen Bewertung und der damit verbundenen Stereotypisierungen und Herabsetzungen.
- 4.3 Habitus: Vermittlung und Internalisierung von Herrschaftsstrukturen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das Konzept des Habitus nach Pierre Bourdieu. Der Habitus wird als ein verinnerlichtes System von Wahrnehmungs- und Handlungsschemata verstanden, das durch die soziale Position und Erfahrung geprägt ist. Der Essay argumentiert, dass der Habitus eine wichtige Rolle bei der Reproduktion von Herrschaftsstrukturen spielt, indem er die internalisierte Akzeptanz und Legitimierung von Ungleichheiten ermöglicht.
- 4.4 Symbolische Gewalt: Die Legitimation von Klassismus: Der Essay beschreibt die symbolische Gewalt als eine Form der Machtausübung, die auf der Ebene des Sinnhaften und Selbstverständlichen operiert. Er zeigt auf, wie symbolische Gewalt durch kulturelle Aspekte und Denkstrukturen die Verinnerlichung und Legitimierung von Klassismus fördert. Als Beispiel dafür werden die „herrschenden Gedanken“ der herrschenden Klasse nach Marx angeführt.
- 4.5 Klassismus und das Bildungssystem: Kulturelle Reproduktion und symbolische Gewalt: In diesem Abschnitt wird das Bildungssystem als ein wichtiges soziales Feld der Reproduktion von Klassismus und Herrschaftsstrukturen betrachtet. Der Essay argumentiert, dass die soziale Herkunft durch die kulturelle Passung Einfluss auf den Bildungserfolg hat und somit zu einer Ungleichheit der Bildungschancen führt. Der Habitus wird als Vermittlungsinstanz der sozialen Position innerhalb des Bildungssystems dargestellt. Als Beispiel wird die unterschiedliche Schulformempfehlung für Kinder aus privilegierten und benachteiligten Schichten angeführt.
- 4.6 Klassismus und die Diskriminierung aufgrund der sozialen Position: Dieser Abschnitt beleuchtet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Position, die sich von der Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft abgrenzen lässt. Als Beispiele werden Obdachlose und Langzeitarbeitslose genannt, die aufgrund ihrer sozialen Position ausgegrenzt und diskriminiert werden. Der Essay zeigt, wie sich Klassismus in Form von Einstellungen und institutionellen Praktiken äußert und zu einer Verachtung und Stigmatisierung dieser Gruppen führt.
Schlüsselwörter
Klassismus, Habitus, symbolische Gewalt, soziale Herkunft, soziale Position, Bildungssystem, Diskriminierung, soziale Ungleichheit, Herrschaftsstrukturen, Reproduktion von Klassismus, Obdachlosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, gesellschaftliche Strukturen.
- Citar trabajo
- Leander Fricke (Autor), 2020, Klassismus als Herrschaftsverhältnis. Theoretische und Empirische Ausführungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1038607