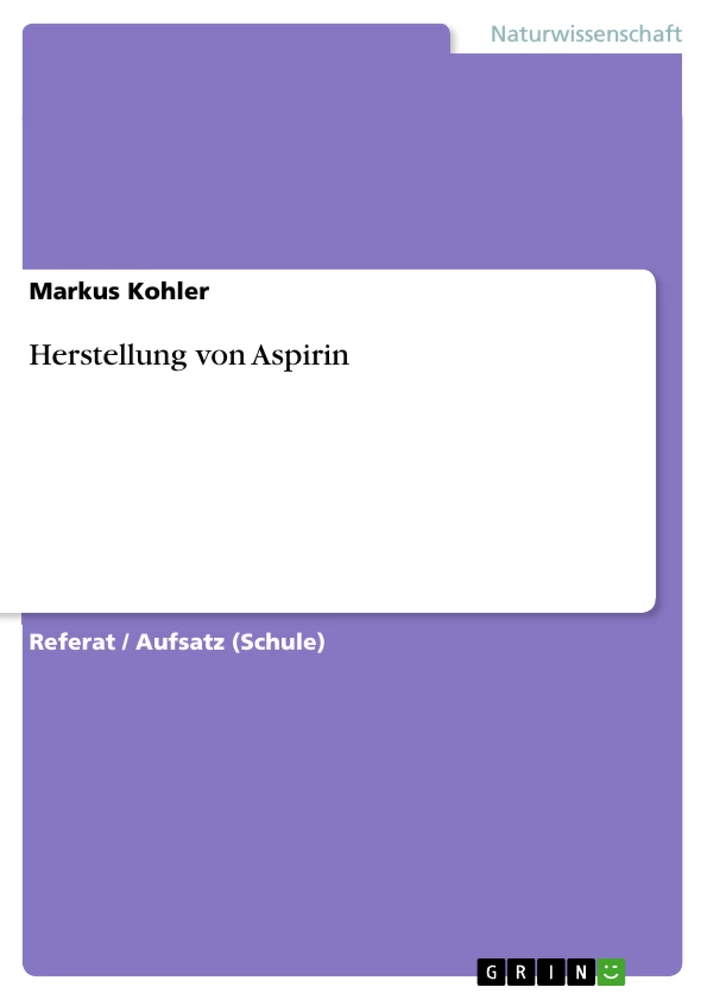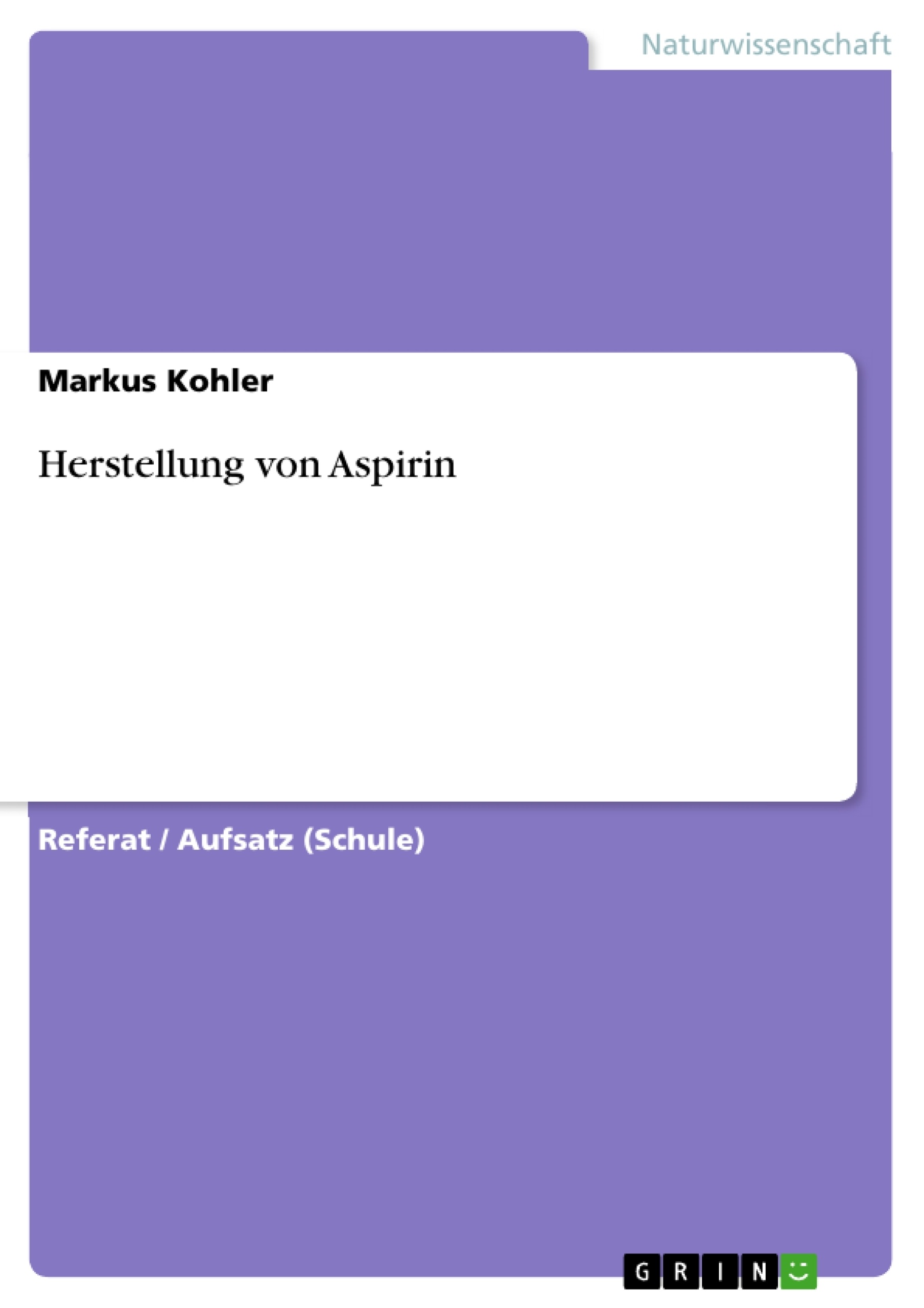Enthüllen Sie die faszinierende Geschichte hinter einem der weltweit bekanntesten Medikamente! Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die chemischen Prozesse, die zur Herstellung von Aspirin führen. Von den anfänglichen Suspensionen aus Salicylsäure und Essigsäureanhydrid bis hin zur entscheidenden Rolle der Schwefelsäure bei der Veresterung, werden alle Schritte detailliert und verständlich erklärt. Erfahren Sie, wie Essigsäureanhydrid die Reaktion vor dem Stillstand bewahrt und wie die anschließende Kühlung zur Bildung der charakteristischen feuchten Masse führt. Doch diese Lektüre ist mehr als nur eine wissenschaftliche Abhandlung. Tauchen Sie ein in die vielseitigen Anwendungsbereiche von Aspirin, von der Schmerzlinderung und Fiebersenkung bis hin zu seiner Rolle als Schlafmittel und Entzündungshemmer. Entdecken Sie, wie Aspirin im Leistungssport eingesetzt wird, sowohl legal zur Fettreduktion in Kombination mit anderen Substanzen als auch illegal als Dopingmittel zur Erhöhung der Schmerzgrenze. Doch Vorsicht: Das Buch beleuchtet auch die Risiken und Alternativen zur Einnahme von Aspirin und plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten. Abschließend wird die Bedeutung von Ausdauersport an der frischen Luft als natürliche Alternative zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Beschwerden hervorgehoben. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für Chemie, Pharmazie, Gesundheit und die Geschichte eines wahren "Allhilfe-Heilmittels" interessieren. Dieses Buch bietet einen tiefen Einblick in die Herstellung, Anwendung und die oft unterschätzten Gefahren eines Medikaments, das unser Leben seit über einem Jahrhundert begleitet. Lassen Sie sich von der Komplexität und den überraschenden Fakten rund um Aspirin fesseln und erweitern Sie Ihr Wissen über dieses vielseitige Molekül. Werden auch Sie zum Experten und verstehen Sie die wissenschaftlichen Hintergründe und ethischen Fragen rund um Aspirin.
Autor: Markus Kohler
Herstellung von Aspirin
Allgemein
Der Wirkstoff von Aspirin ist der Salicylsäureethylester. Er entsteht, wenn Salicylsäure mit Essigsäure verestert wird, dabei entsteht auch Wasser.
Durchführung und Beobachtungen
-
In einen Erlenmeyerkolben werden Salicylsäure (flüssig) und Essigsäureanhydrid (fest) gegeben. Danach wird 2 Minuten geschüttelt. Es entsteht dabei eine Suspension, da die Salicylsäure wegen der Hydroxylgruppen polar ist und das Essigsäureanhydrid unpolar wegen der Kettenlängen unpolar ist. Die beiden Stoffe lösen sich also nicht. Es entsteht eine milchige Flüssigkeit.
Das Essigsäureanhydrid wird aus folgendem Grund benötigt: Bei jeder Reaktion reagieren die Edukte solange miteinander, bis eine bestimmte Konzentration an Produkten entstanden ist. Z.B. reagieren HCl + H20 zu Cl und H3O. Dieser Reaktion findet auch umgekehrt statt. Die Reaktion kommt annähernd zur Ruhe, wenn ein bestimmte Konzentration erreicht ist.
Ähnliches geschieht bei der Reaktion zu Salicylsäureethylester. Bei dieser Reaktion entsteht Wasser, das die Reaktion irgendwann zum Stillstand bringt. Das Essigsäureanhydrid reagiert nun mit dem Wasser zu Essigsäure, das zur weiteren Reaktion benötigt wird. Die Reaktion wird also erst später gestoppt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Wasser kann natürlich auch von anderen Flüssigkeiten in kleinen Anteilen stammen.
-
Nun wird Eisessig (100% Essigsäure) und laut Anleitung 3 Tropfen konz. Schwefelsäure zugeführt. Danach wird laut Anleitung kräftig geschüttelt.
In der Praxis stellte es sich als erfolgreicher heraus, 6-7 Tropfen Schwefelsäure zuzufügen und danach mit einem Magnetrührer zu rühren.
Bei dieser Reaktion entsteht dann der Wirkstoff Salicylsäureethylester. Die Schwefelsäure hat die gleiche Funktion wie die Essigsäure(geändert 07.03.01). Sie ist sehr hydrophil, reagiert also auch mit dem bei der Veresterung entstandenem Wasser.
Beim Schüttel wird die Flüssigkeit wieder klar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
-
Nun wird 100 ml Wasser hinzugegeben, da dann die Säure abfällt, weil sie nicht Wasserlöslich ist. Die anderen Stoffe, die noch vorhanden sind lösen sich dagegen im Wasser. Das die Veresterung abgeschlossen ist, deshalb beeinflußt das hinzugegebene Wasser auch nicht mehr den Reaktionsprozeß.
-
Jetzt wird das Gemisch abgekühlt. Es bildet sich dabei eine sehr feuchte Masse.
-
Nun wird aus der Suspension das Wasser abfiltriert. Dabei entsteht ein Pulver. Sehr viel Wasser ist im Filtrat enthalten.
Mit der Schmelzpunktbestimmung könnte man zum Beispiel die Reinheit des Esters feststellen.
Der Name Aspirin ist ein Kunstwort, das auf dem alten Namen Spirsäure für Salicylsäure zurückgeht. Die Spirsäure wurde nach dem Spierstrauch benannt – einer Pflanze, in der die Salicylsäure vorkommt. Bei uns ist die Pflanze auch unter dem Namen Mädesüß bekannt.
Aspirin hat folgende Anwendungsgebiete: Alle Arten von Schmerzen, fiebersenkende Wirkung, Schlafmittel, wirkt entzündungshemmend, fördert Durchblutung des Herzmuskels, setzt Gerinnungsfaktor herab.
Es ist also im Haushalt ein „Allhilfe-Heilmittel“. Aber auch im Leistungssport wird Aspirin verwendet:
-
Es wird in Mittel zur Fettreduktion (z.B. wie Hydroxycut) mit anderen Stoffen verwendet. Allgemein sind diese Stoffe wie folgt zusammengesetzt:
Zum ECA-Stack. Eine dreimal tägliche Einnahme von 25mg Ephedrin, 200mg Koffein und 500 mg Acetylsalicylsäure soll optimal sein, um Körperfett zu verbrennen.
Diese Zusammensetzung kommt auch im Ephedra vor, das ein seit Jahrhunderten bekanntes chinesisches Heilmittel ist. Auch gegen Asthma wurde lange Zeit erfolgreich eingesetzt (war in Sprays enthalten). Die Wirkung tritt hier besonders wegen des Ephedrins ein.
-
Aspirin ist auch bei Profitriathleten und Amateurradrennfahrern eine beliebte Dopingsubstanz. Das Mittel wird hier gerne eingesetzt um die Schmerzgrenze höher zu setzten, dem Sportler ist es also möglich länger im sauren Bereich zu fahren. Auch im Zeitfahren ist Aspirin eine beliebte Substanz. Hier werden auch Dosen von 10-15 Tabletten auf einmal eingenommen. Aus medizinischer Sicht sollte man auf keinen Fall eine Dosis von 2 Tabletten übersteigen.
-
Auch im Profisport wird unter Verwendung von EPO, versucht mit Aspirin das Blut flüssig zu halten. Natürlich gilt dies auch für alle Dialysepatienten.
Häufig gestellte Fragen zu "Herstellung von Aspirin"
Was ist der Wirkstoff von Aspirin und wie entsteht er?
Der Wirkstoff von Aspirin ist Salicylsäureethylester. Er entsteht durch die Veresterung von Salicylsäure mit Essigsäure, wobei auch Wasser entsteht.
Warum wird Essigsäureanhydrid bei der Herstellung von Aspirin verwendet?
Essigsäureanhydrid wird verwendet, um das bei der Reaktion entstehende Wasser zu binden. Wasser kann die Reaktion zum Stillstand bringen, da es die umgekehrte Reaktion begünstigt. Das Essigsäureanhydrid reagiert mit dem Wasser zu Essigsäure und ermöglicht so eine vollständigere Reaktion.
Welche Rolle spielt die Schwefelsäure bei der Herstellung von Aspirin?
Die Schwefelsäure wirkt als Katalysator und hilft, die Reaktion zu beschleunigen. Sie ist sehr hydrophil und reagiert ebenfalls mit dem bei der Veresterung entstandenem Wasser.
Warum wird Wasser zum Gemisch hinzugefügt?
Nach der Reaktion wird Wasser hinzugefügt, damit die Säure ausfällt, da sie nicht wasserlöslich ist. Die anderen Stoffe lösen sich dagegen im Wasser.
Was passiert beim Abkühlen des Gemisches?
Beim Abkühlen des Gemisches bildet sich eine feuchte Masse.
Was kann man mit der Schmelzpunktbestimmung feststellen?
Mit der Schmelzpunktbestimmung kann man die Reinheit des hergestellten Salicylsäureethylesters feststellen.
Woher stammt der Name Aspirin?
Der Name Aspirin ist ein Kunstwort, das auf dem alten Namen Spirsäure für Salicylsäure zurückgeht. Die Spirsäure wurde nach dem Spierstrauch benannt, einer Pflanze, in der die Salicylsäure vorkommt.
Welche Anwendungsgebiete hat Aspirin?
Aspirin hat vielfältige Anwendungsgebiete: Schmerzlinderung, Fiebersenkung, als Schlafmittel, entzündungshemmende Wirkung, Förderung der Durchblutung des Herzmuskels und Herabsetzung des Gerinnungsfaktors.
Wird Aspirin im Sport verwendet und wenn ja, warum?
Ja, Aspirin wird im Sport verwendet, z.B. zur Fettreduktion in Kombination mit anderen Stoffen (ECA-Stack). Auch bei Ausdauersportlern wird es eingesetzt, um die Schmerzgrenze zu erhöhen und länger im sauren Bereich fahren zu können. Im Profisport wird Aspirin auch in Verbindung mit EPO verwendet, um das Blut flüssig zu halten.
Welche Alternativen gibt es zu Medikamenten wie Aspirin?
Eine Alternative zu Medikamenten ist Ausdauersport an der frischen Luft. Dies kann bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Übergewicht, Schlaflosigkeit usw. helfen.
- Quote paper
- Markus Kohler (Author), 2001, Herstellung von Aspirin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103834