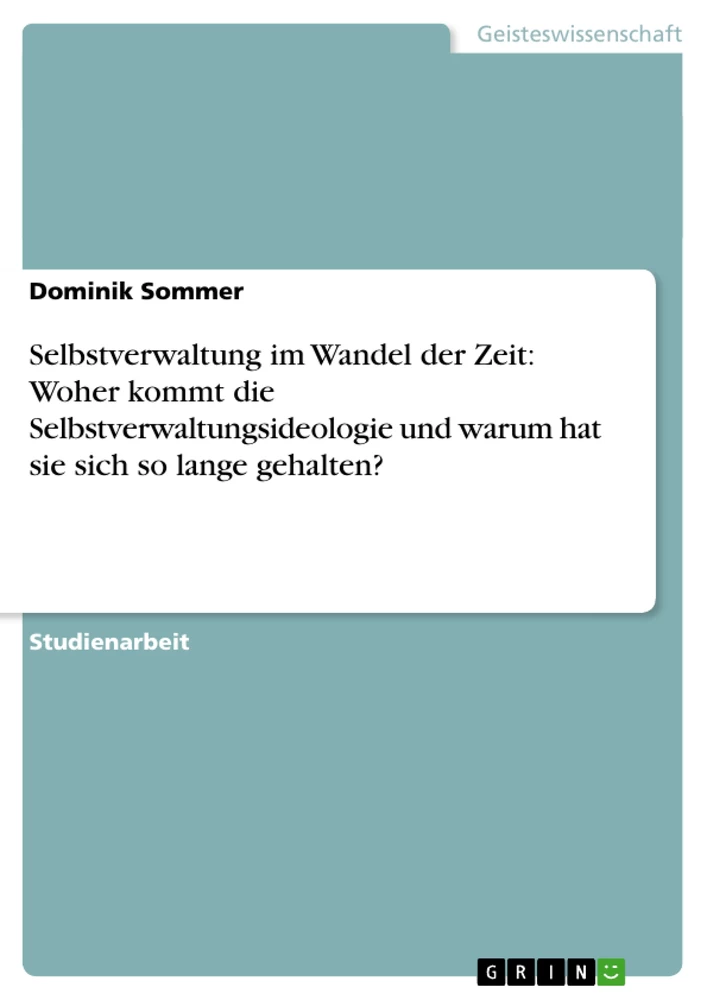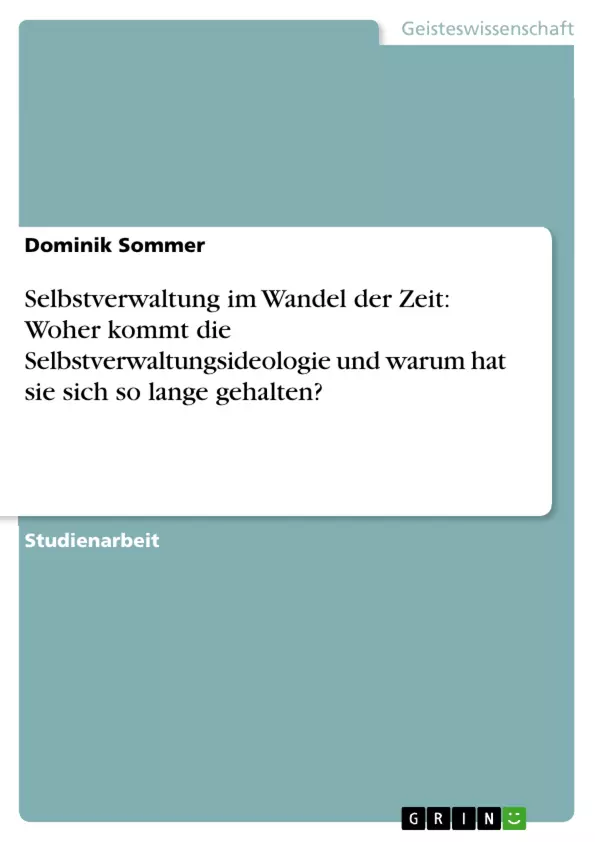Durch die Lektüre von Alexis de Tocquvilles "Über die Demokratie in Amerika" kam ich zu diesem Thema. Hauptmotiv für Tocquville, als er dieses Buch verfaßte, war die Freiheit. An Hand der in Amerika vorgefundenen Demokratie untersuchte er die Funktionsweisen dieser, für diese Zeit neuen, Regierungsform und ihre Auswirkungen auf die Freiheit des Individuums.
Grundsätzlich geht Tocqueville von einer natürlichen und unabwendbaren Entwicklung ("Vorsehung") zur Gleichheit aus. Das ist für ihn in der Welt der Politik mit einer Demokratisierugsentwicklung verbunden. Demokratie an sich ist für ihn nicht von vornherein etwas positives. Tocqueville hat die Vorstellung, dass sich auch eine Gesellschaft grundsätzlich zwischen Gut und Böse entscheiden muß, wenn sie dem Menschen Glück, d.h. die freie Entwicklung des menschlichen Willens, ermöglichen will. In dieser Dichotomie zwichen Gut und Böse ist die böse Variante die Entwicklung zur Gleichheit ohne Berücksichtigung der Freiheit. Tocquville spricht dann von "demokratischem Despotismus" und meint damit eine weitgehende Zentralisierung des Gemeinwesens unter Abgabe der Verantwortung der Einzelnen an eine Zentralmacht, den Staat. Die gute Variante jedoch, also die Möglichkeit, der Freiheit einen Platz neben der Gleichheit zu sichern, sieht Tocquville in vertikaler Gewaltenteilung. Hier spielt die Gemeinde eine zentrale Rolle. Diese "Schule der Demokratie" lehrt den Bürgern durch Selbstverwaltung und Selbstregierung politische Klugheit und hilft ihnen damit, innerhalb der Demokratie freiere und "bessere" Willensentscheidungen zu treffen. Es gibt also klare Grenzen zwischen Staat und Gemeinde, die Gemeinde handelt weitgehend autonom.
Diese Demokratievertändnis hat mich begeistert. Jedoch sind seit der "Demokratie in Amerika" fast 200 Jahre vergangen und politische Probleme scheinen heute komplexer denn je. Immernoch gibt es aber Anhänger einer auf Autonomie und Selbstverwaltung basierenden Gemeinde, die den fundamentalen Grundstock eines auf verstärkt vertikal gewaltengeteilten Staates darstellt. Woher kommt die Forderung nach einer selbstverwalteten, staatsunabhängigen Gemeinde?1
Inhaltsverzeichnis
- 1. Selbstverwaltung und Selbstregierung bei Alexis de Tocqueville
- 2.1 Problemstellung, Thesen…
- 2.2 “Recht der Selbstverwaltung”..
- 2.3 Geschichte der Selbstverwaltung.
- 2.4 Der Liberalismus und der Mythos der Selbstverwaltung.…………………………….
- 2.5 Liberalistische Prägung..
- 3. Synthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Selbstverwaltung und untersucht dessen historische Entwicklung und ideologische Grundlagen anhand der Schriften von Alexis de Tocqueville. Die Arbeit analysiert die Rolle der Selbstverwaltung in der Entwicklung des Liberalismus und untersucht die Debatte um die Abgrenzung zwischen staatlicher Verwaltung und kommunaler Selbstverwaltung.
- Die Entwicklung der Selbstverwaltungsideologie im Kontext des französischen Liberalismus
- Das Verhältnis zwischen staatlicher Verwaltung und kommunaler Selbstverwaltung
- Die Rolle der Gemeinde als "Schule der Demokratie" und deren Bedeutung für die politische Bildung der Bürger
- Die Kontinuität und die Herausforderungen der Selbstverwaltungsideologie im modernen Kontext
- Die Bedeutung von vertikaler Gewaltenteilung für die Sicherung der Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Alexis de Tocqueville
Die Einleitung stellt Alexis de Tocqueville und seine Arbeit „Über die Demokratie in Amerika“ vor und erläutert sein Interesse an der Freiheit als zentrales Motiv für seine Untersuchungen der Funktionsweise der Demokratie. Tocquevilles Analyse der Demokratie in Amerika bildet den Ausgangspunkt für die Diskussion über die Selbstverwaltung in dieser Arbeit. - Kapitel 2.1: Problemstellung
In diesem Kapitel wird die Frage nach der Beziehung zwischen staatlicher Verwaltung und kommunaler Selbstverwaltung erörtert. Die Arbeit stellt unterschiedliche Perspektiven auf dieses Verhältnis vor und beleuchtet die Debatte um die Rolle der Gemeinde im Kontext des Staates. - Kapitel 2.2: Recht der Selbstverwaltung
Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland. Es wird auf Artikel 28 Absatz 1 des Grundgesetzes eingegangen und die Bedeutung des "Rechts auf Selbstverwaltung" im Sinne der kommunalen Selbstverwaltungsrechte erklärt. Die Arbeit analysiert die Definition des Selbstverwaltungsbegriffs und beleuchtet die Spannungen zwischen staatlicher Gesetzgebung und kommunaler Autonomie. - Kapitel 2.3: Geschichte
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der historischen Entwicklung der Selbstverwaltungsideologie. Die Arbeit beleuchtet die Ursprünge der Selbstverwaltungsidee bei den französischen Physiokraten im 18. Jahrhundert und deren Kritik am staatlichen Zentralismus.
Schlüsselwörter
Selbstverwaltung, Selbstregierung, Alexis de Tocqueville, Liberalismus, Demokratie, Gemeinde, Staat, Verwaltung, Gewaltenteilung, Freiheit, Gleichheit, französischer Liberalismus, Physiokraten, kommunale Selbstverwaltung, Grundgesetz, Bundesverfassungsgericht.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Alexis de Tocqueville unter „demokratischem Despotismus“?
Es beschreibt eine Entwicklung zur Gleichheit ohne Freiheit, bei der ein zentralisierter Staat die Verantwortung der Bürger übernimmt und diese in eine passive Abhängigkeit führt.
Warum nennt Tocqueville die Gemeinde eine „Schule der Demokratie“?
In der kommunalen Selbstverwaltung lernen Bürger politische Klugheit und Verantwortung, was sie befähigt, innerhalb einer Demokratie freiere und bessere Entscheidungen zu treffen.
Wo liegen die historischen Wurzeln der Selbstverwaltungsidee?
Die Idee geht unter anderem auf die französischen Physiokraten des 18. Jahrhunderts zurück, die den staatlichen Zentralismus kritisierten und lokale Autonomie forderten.
Wie ist das Recht auf Selbstverwaltung im Grundgesetz verankert?
Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes garantiert den Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.
Welche Rolle spielt die vertikale Gewaltenteilung?
Sie sichert die Freiheit, indem Macht nicht nur horizontal (Legislative, Exekutive, Judikative), sondern auch vertikal zwischen Staat, Ländern und autonomen Gemeinden aufgeteilt wird.
- Arbeit zitieren
- Dominik Sommer (Autor:in), 1999, Selbstverwaltung im Wandel der Zeit: Woher kommt die Selbstverwaltungsideologie und warum hat sie sich so lange gehalten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10376