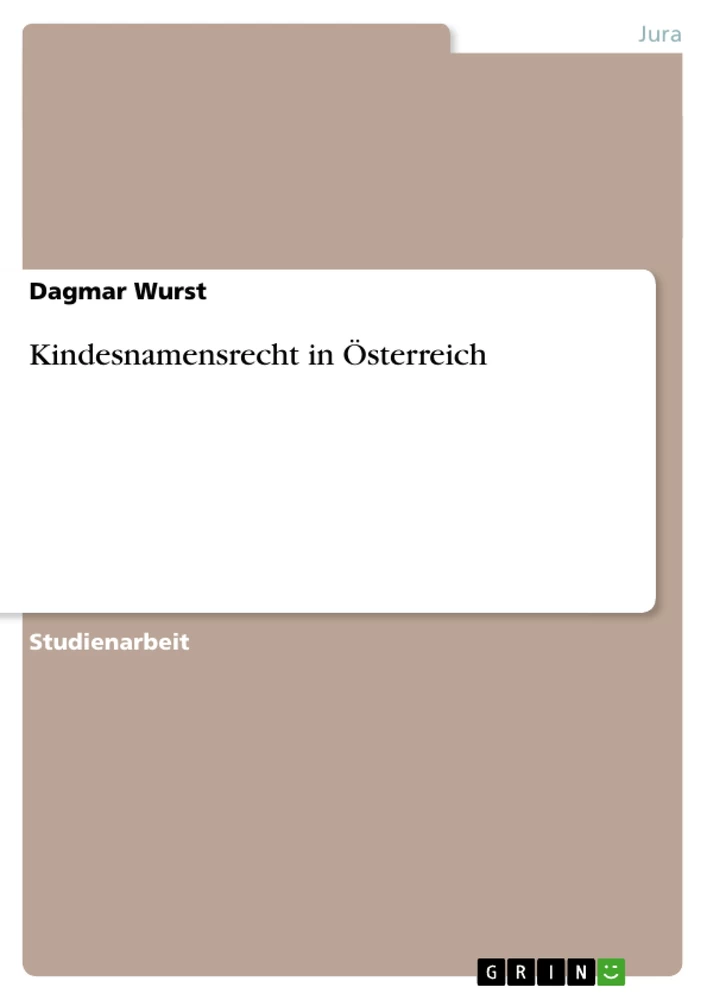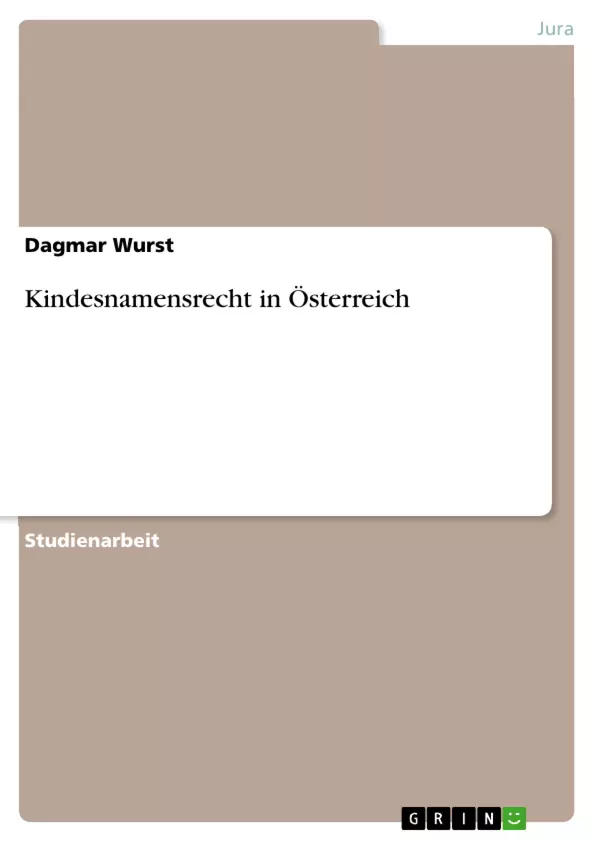Am 1. April 1994 ist in Deutschland das Familiennamensrechtsgesetz in Kraft getreten. Fast genau ein Jahr später, nämlich mit 1. Mai 1995, trat in Österreich das Namensrechtsänderungsgesetz (NamRÄG ) in Kraft. Kern beider Gesetze ist eine Neuregelung des Rechts des Ehe- und des Kindesnamens, in Österreich begleitet von einer großzügigen Liberalisierung des Rechts der verwaltungsbehördlichen Namensänderung.
Ziel der Reform war die Verbesserung der Rechte des Kindes, bestmögliche Förderung des Kindeswohls, Abbau bestehender rechtlicher Unterschiede zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern sowie die Stärkung der Rechtspositionen der Eltern vor unnötigen staatlichen Eingriffen.(1) Auslöser dafür war die Ratifizierung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes im Jahre 1992,(2) das der Sicherung der Rechte von Kindern dienen sollte.
[...]
1 Walter, FamRZ, 1995, 1538
2 Ebert, JBl., 1995, 69 ff.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Namenserwerb
- I. Der Name des ehelichen Kindes
- 1. Der Familienname
- 2. Der Vorname
- II. Der Name des unehelichen Kindes
- C. Namensänderung
- I. Familienname nach Legitimation
- II. Aufhebung der Namensgebung
- III. Familienname nach Annahme an Kindesstatt
- IV. Übergangsrecht
- V. Änderungen im NÄG
- 1. § 21 Nr. 8 NamRÄG
- 2. § 21 Nr. 9 NamRÄG
- 3. § 21 Nr. 11 NamRÄG
- D. Vergleich zum deutlichen Wandel im deutschen Namensrecht
- E. Abschließende Bewertung der Reform in Österreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die österreichische Namensrechtsreform von 1995, insbesondere die Neuregelung des Ehe- und Kindesnamensrechts. Ziel ist es, die Ziele der Reform, ihre Auswirkungen und den Vergleich zum deutschen Namensrecht darzustellen.
- Namenserwerb ehelicher und unehelicher Kinder
- Namensänderung nach Legitimation und Adoption
- Vergleich des österreichischen und deutschen Rechts
- Bewertung der Reform im Hinblick auf Kindeswohl und Elternrechte
- Analyse der Änderungen im Namensrechtsänderungsgesetz (NamRÄG)
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Namensrechtsreformen in Deutschland (1994) und Österreich (1995), die eine Neuregelung des Ehe- und Kindesnamensrechts zum Ziel hatten. Die Reformen zielten auf die Verbesserung der Kinderrechte, die Beseitigung rechtlicher Unterschiede zwischen ehelichen und unehelichen Kindern und die Stärkung der Elternrechte. Die Ratifizierung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes im Jahr 1992 diente als wesentlicher Auslöser dieser Entwicklungen. Die Einleitung legt den Fokus auf die grundlegenden Ziele und den Kontext der österreichischen Reform.
B. Namenserwerb: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Erwerb des Namens durch ein Kind bei der Geburt. Es wird zwischen Vorname und Familienname unterschieden. Der Vorname wird gemäß § 21 PStG zugewiesen. Der Familienname wird bei der Geburt erworben und kann gegebenenfalls auch Begleitnamen gemäß § 93 II ABGB, § 1355 III BGB umfassen. Das Kapitel legt die grundlegenden Bestimmungen des österreichischen Rechts zum Namenserwerb dar und schafft eine Grundlage für die detailliertere Analyse in den folgenden Kapiteln.
C. Namensänderung: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte der Namensänderung. Es umfasst die Namensänderung nach Legitimation, die Aufhebung der Namensgebung, die Namensänderung nach Annahme an Kindesstatt sowie das Übergangsrecht und spezifische Änderungen im NÄG (§ 21 Nr. 8, 9, und 11 NamRÄG). Die verschiedenen Szenarien der Namensänderung werden detailliert beschrieben und analysiert, um das volle Ausmaß der Reform zu erfassen. Dieses Kapitel zeigt die Flexibilität und die Möglichkeiten des neuen Gesetzes im Umgang mit Namensänderungen.
Schlüsselwörter
Kindesnamensrecht, Namensrechtsänderungsgesetz (NamRÄG), Österreich, Familienrecht, Ehenamen, Kindeswohl, Namensänderung, Rechtsvergleichung, Deutschland, Legitimation, Adoption, Übereinkommen über die Rechte des Kindes.
Häufig gestellte Fragen zur Österreichischen Namensrechtsreform von 1995
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die österreichische Namensrechtsreform von 1995. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Neuregelung des Ehe- und Kindesnamensrechts und einem Vergleich zum deutschen Namensrecht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die österreichische Namensrechtsreform von 1995, insbesondere die Neuregelung des Ehe- und Kindesnamensrechts. Konkret werden folgende Themen behandelt: Namenserwerb ehelicher und unehelicher Kinder, Namensänderung nach Legitimation und Adoption, ein Vergleich des österreichischen und deutschen Rechts, eine Bewertung der Reform im Hinblick auf Kindeswohl und Elternrechte sowie eine Analyse der Änderungen im Namensrechtsänderungsgesetz (NamRÄG).
Wie ist der Namenserwerb nach der Reform geregelt?
Das Kapitel „Namenserwerb“ befasst sich mit dem Erwerb des Namens durch ein Kind bei der Geburt. Es wird zwischen Vor- und Familiennamen unterschieden. Der Vorname wird gemäß § 21 PStG zugewiesen. Der Familienname wird bei der Geburt erworben und kann gegebenenfalls auch Begleitnamen umfassen (§ 93 II ABGB, § 1355 III BGB). Die Arbeit erläutert die grundlegenden Bestimmungen des österreichischen Rechts zum Namenserwerb.
Welche Arten von Namensänderungen werden behandelt?
Das Kapitel „Namensänderung“ behandelt verschiedene Aspekte der Namensänderung, inklusive Namensänderung nach Legitimation, Aufhebung der Namensgebung, Namensänderung nach Annahme an Kindesstatt, Übergangsrecht und spezifische Änderungen im NÄG (§ 21 Nr. 8, 9, und 11 NamRÄG). Die verschiedenen Szenarien werden detailliert beschrieben und analysiert.
Wie wird die österreichische Reform mit dem deutschen Namensrecht verglichen?
Die Arbeit beinhaltet einen Vergleich der österreichischen Reform mit dem deutschen Namensrecht (Reform von 1994), um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und die österreichische Reform im internationalen Kontext zu verorten.
Welche Ziele verfolgte die Reform?
Die Reform zielte auf die Verbesserung der Kinderrechte, die Beseitigung rechtlicher Unterschiede zwischen ehelichen und unehelichen Kindern und die Stärkung der Elternrechte ab. Die Ratifizierung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes im Jahr 1992 diente als wesentlicher Auslöser.
Wie wird die Reform bewertet?
Die Arbeit enthält eine abschließende Bewertung der Reform in Österreich, die sich unter anderem auf das Kindeswohl und die Elternrechte konzentriert. Die Bewertung berücksichtigt die Auswirkungen der Reform und ihre Umsetzung in der Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kindesnamensrecht, Namensrechtsänderungsgesetz (NamRÄG), Österreich, Familienrecht, Ehenamen, Kindeswohl, Namensänderung, Rechtsvergleichung, Deutschland, Legitimation, Adoption, Übereinkommen über die Rechte des Kindes.
- Citar trabajo
- Dagmar Wurst (Autor), 1998, Kindesnamensrecht in Österreich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10336