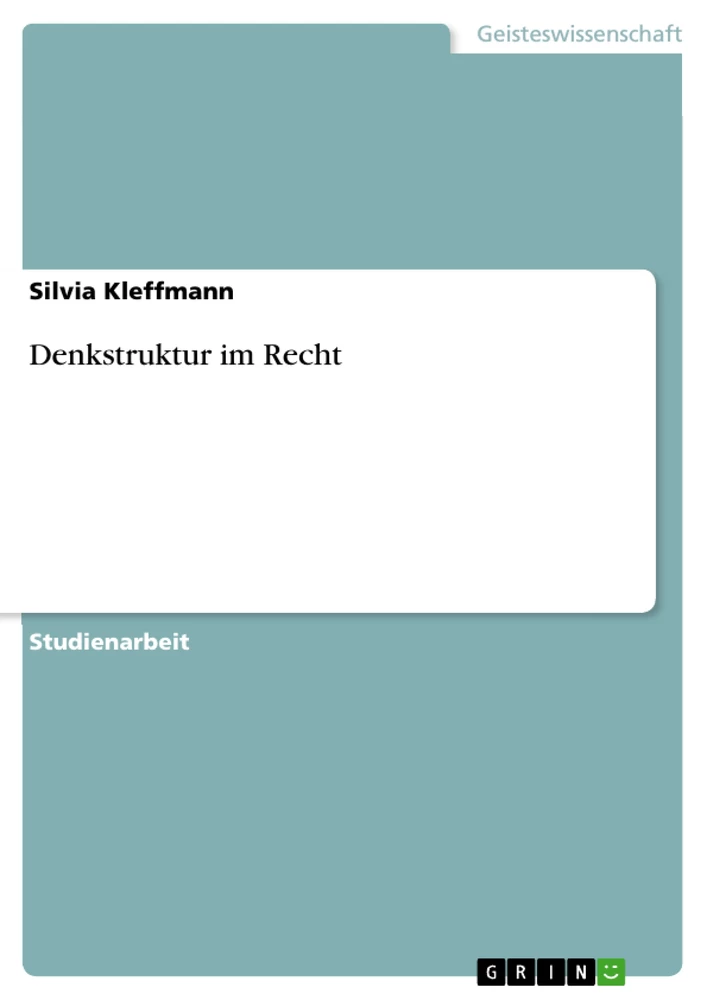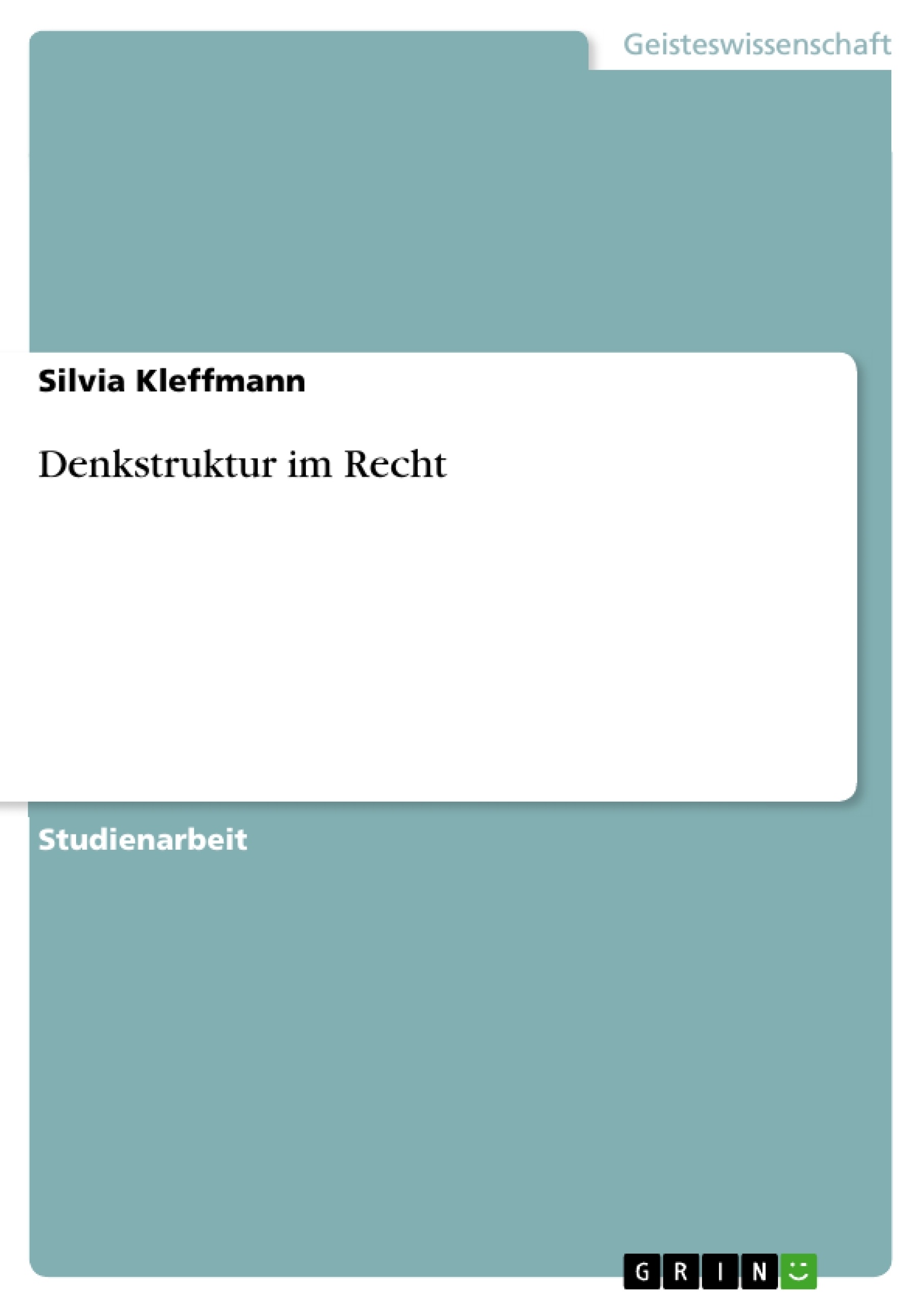Haben Sie sich jemals gefragt, wie das Recht wirklich funktioniert? Jenseits von Paragraphen und Urteilen verbirgt sich eine faszinierende Denkstruktur, die unser Handeln und Zusammenleben maßgeblich prägt. Diese tiefgründige Analyse enthüllt die verborgenen Mechanismen des juristischen Denkens und nimmt Sie mit auf eine erkenntnisreiche Reise durch die Welt des Rechts. Zunächst wird der Begriff "Denken" selbst aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Wie verstehen wir Denken im Alltag, in der Philosophie und in der Psychologie? Diese vielschichtige Betrachtung bildet die Grundlage für das Verständnis der spezifischen Denkweise im Recht. Anschließend widmet sich die Arbeit dem Recht selbst und seiner ureigenen Denkstruktur. Im Zentrum steht die Frage, wie juristische Entscheidungen gefällt werden, welche Rolle Kausalität spielt und welche Kategorien dabei von Bedeutung sind. Entdecken Sie die fundamentalen Bausteine des juristischen Denkens: Tatbestand, Rechtsfolge, Feststellungsverfahren und Vollstreckung. Lernen Sie, wie diese Elemente zusammenspielen und welche Konsequenzen sich daraus für die Anwendung des Rechts ergeben. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für die Grundlagen des Rechts interessieren, sei es aus akademischem Interesse, beruflicher Notwendigkeit oder persönlicher Neugier. Es bietet einen klaren und verständlichen Einblick in die komplexe Welt des juristischen Denkens und hilft Ihnen, die Logik hinter Gesetzen und Urteilen zu verstehen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Rechtsphilosophie und entwickeln Sie ein tieferes Verständnis für die Prinzipien, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Lassen Sie sich von der Klarheit und Präzision der Argumentation überzeugen und erweitern Sie Ihren Horizont im Bereich Recht und Denken. Ideal für Jurastudenten, Rechtsanwälte, Richter und alle, die sich für die Funktionsweise unseres Rechtssystems interessieren. Erhellen Sie die Denkstrukturen, die unser Rechtssystem prägen, und gewinnen Sie neue Einsichten in die Grundlagen unserer Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Zum Begriff Denken
1.1 Denken im alltäglichen Verständnis
1.2 Denken aus philosophischer Sicht
1.3 Denken aus psychologischer Sicht
2. Recht
2.1 Ein Definitionsversuch
2.2 Doppeldeutigkeiten und Begriffsbestimmungen
2.2.1 Öffentliches Recht – Privatrecht
2.2.2 Objektives Recht – Subjektives Recht
2.2.3 Recht als Verhaltensnorm
2.2.4 Rechtsquellen
2.2.5 Selbständige und unselbständige Rechtssätze
3. Denkstruktur im Recht
3.1 Tatbestand
3.2 Rechtsfolge
3.2.1 Verbindlichkeitsgrad
3.2.2 Kategorie der Rechtsfolgen
3.3 Feststellungsverfahren
3.4 Vollstreckung
Anhang:
Literaturverzeichnis
Einleitung
Ein Rechtssystem als Regelwerk für menschliches Verhalten wirkt immer auch auf die M enschen, die in dem Rechtsraum, für den es gemacht ist, leben. Es besteht aus Regeln und konzentriert sich dabei auf menschliches Handeln – die Gedanken sind frei, einem rechtswidrigen Gedanken folgt keine rechtliche Sanktion.
Anders ist dies bei einer rechtswidrigen Handlung (sofern sie denn bekannt wird) – was aber wirkt da auf den Menschen, wie wird im Recht gedacht, nach welcher Struktur wird vorgegangen? Diese Seminararbeit soll sich mit diesem Thema, der Denkstruktur im Recht, befassen.
Dazu halte ich es für notwendig, zunächst einmal mit einer Art Ausflug in die Welt des D enkens zu beginnen. Es soll verdeutlicht werden, was denn unter dem Begriff Denken, der ja durchaus bekannt ist, aus verschiedenen Sichtweise verstanden wird. Anschließend wende ich mich dem Recht als solchem und seiner Denkstruktur zu.
Recht ist geprägt von kausalem Wenn-Dann-Denken. Einfach ausgedrückt: Wenn dieses gegeben ist, dann resultiert daraus jenes. Auf dieser Basis habe ich im Folgenden die D enkstruktur im Recht mit ihren Kategorien Tatbestand, Rechtsfolge, Feststellungsverfahren und V ollstreckung beleuchtet.
1. Zum Begriff Denken
1. 1 Denken im alltäglichen Verständnis
Denken wird umgangssprachlich gleichgesetzt mit Begriffen wie z.B. Gedankenarbeit, K opfarbeit oder geistige Arbeit. Wird vom Prozess des Denkens gesprochen, werden synonym Ausdrücke wie etwa seinen Verstand gebrauchen, seinen Geist anstrengen, sich etwas vorstellen, etwas meinen, etwas annehmen, nachdenken oder grübeln verwendet – um nur einige der vielfältigen Beschreibungen zu nennen, die mit dem Vorgang des Denkens gleichgesetzt werden.
Im Alltag spricht man vom Denken als Vorgang eines Individuums, Lösungsstrategien und
Verhaltensweisen zu entwickeln bzw. zu erinnern, um mit ihrer Hilfe eine Situation meistern zu können. Zum anderen meint Denken aber auch etwas bedenken, ohne dass eine E ntwicklung von Strategien und Verhaltensweisen das Ziel bzw. die Folge sein muss oder soll.
1.2 Denken aus philosophischer Sicht
Aus philosophischer Sicht ist Denken bewusster und reflektierter Umgang mit Begriffen als solchen, u.a. mit dem Begriff des Denkens selbst. Dies ist zugleich Anfang und Gegenstand philosophischen Denkens.[1]
Ich wende mich exemplarisch dem Ansatz Immanuel Kants im Hinblick auf das Denken zu, um einen kurzen Einblick in Denken aus philosophischer Sicht zu vermitteln:
Nach Kant ist Denken eine „aktive, vereinheitlichende, synthetische, im Urteil zum Ausdruck kommende Tätigkeit“.[2] Diese Funktion ist aktive Verstandestätigkeit und vollzieht sich als
„Erkenntnis durch Begriffe, wobei zwischen ‚reinem’ (Gegenstände völlig ... erkennendem) und ‚empirischen’ D. unterschieden werden muß.“[3] Der Prozess vollzieht sich dialektisch, also über den Weg von These und Antithese hin zur Verknüpfung der einzelnen Teile zu einem höheren Ganzen, der Synthese.
Erkennen ist für Kant subjektiv. Er ist der Ansicht, jeder Mensch bringe von sich aus V orstellungen von Raum und Zeit sowie die Grundbegriffe des Verstandes in den Erkenntnisprozess mit ein, sodass sich dem Menschen die Wirklichkeit als Erscheinung abbildet. Der Mensch erfasst also die Dinge nur als Erscheinungen und nicht die Dinge an sich.[4]
1. 3 Denken aus psychologischer Sicht
Aus psychologischer Sicht fasst „Der Begriff des Denkens (...) sämtliche kognitive Aktivitäten
(...) zusammen, die im Rahmen des Lebensvollzugs wirksam werden.“[5]
Die Individualpsychologie - und mit ihr Alfred Adler - postuliert die gegenseitige Abhä ngigkeit der kognitiven, emotionalen und aktionalen Dimensionen des Individuums. Aus diesem Grund untersucht sie das eigentliche Denkgeschehen grundsätzlich im Zusammenhang mit der umfassenden Einheit der Person.[6] Adler unterscheidet dabei zwischen Denken im primä- ren Bezugssystem und Denken im gesellschaftlich durchschnittlichen Bezugssystem:
Denkprozessen im primären Bezugssystem liegt eine Logik zugrunde, die „nach Adler ‚ primitiven’ und ‚privaten’ Prinzipien folgt.“[7] Beim Erfassen von Inhalten wird dem Individuum eine ganz spezifische, private Wirklichkeit widergespiegelt. Kognitive Voraussetzungen dafür wurden bereits in frühen Phasen der Persönlichkeitsentwicklung geschaffen. Ein wichtiges Kriterium dieser privaten Logik, die sich im Denkprozess konkret-bildhaften Materials bedient, ist die Verabsolutierungstendenz. Sie ist Grundlage für extreme Urteilsschlüsse, sodass Denkoperationen im primären Bezugssystem in typischer Weise emotional eingefärbt sind.[8]
Denkabläufe im gesellschaftlich durchschnittlichen Bezugssystem folgen demgegenüber „ logischen Prinzipien, die allgemeinverbindlicher und damit regelhaft sind.“[9] Sie ermöglichen Denkoperationen, die weit weniger primitiv sind als die auf primärer Bezugsebene. V oraussetzungen dafür werden erst in zeitlich sekundären Phasen der Entwicklung vermittelt. A ufgrund einer ausgleichenden Tendenz zur Objektivierung und Relativierung ist diese Art des Denkens weitgehend frei von Gefühlen. Sprache ist auf dieser Ebene des Denkens unabding-
bar. Sie schafft die Möglichkeit zur Abstraktion und Begriffsbildung, sodass auf dieser Ebene Reflexion möglich ist.[10]
[...]
[1] Vgl. Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie. Bd. 1, Hamburg, 1999, S. 225
[2] Erpenbeck, John.: Denken, in: Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Bd. 1, Hamburg, 1990, S. 535
[3] Erpenbeck a.a.O., S. 535
[4] Vgl. Weischedel, Wilhelm: Die philosophische Hintertreppe, München, 200030, S. 185
[5] Titze, Michael: Denken, in: Brunner, Reinhard / Titze, Michael (Hrsg.): Wörterbuch der Individualpsychologie, München/Basel, 19952, S. 79
[6] Vgl. Titze a.a.O., S. 80
[7] Titze a.a.O., S. 80
[8] Vgl. Titze a.a.O., S. 80
[9] Titze a.a.O., S. 80
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine Seminararbeit, die sich mit der Denkstruktur im Recht befasst. Es untersucht, wie im Recht gedacht und nach welcher Struktur vorgegangen wird, und zwar unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven auf den Begriff "Denken".
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert die Arbeit in folgende Abschnitte: Einleitung, Zum Begriff Denken (mit Unterpunkten zu alltäglichem, philosophischem und psychologischem Verständnis), Recht (mit Definitionen, Begriffsbestimmungen und Rechtsquellen), Denkstruktur im Recht (mit Tatbestand, Rechtsfolge, Feststellungsverfahren und Vollstreckung) und Anhang mit Literaturverzeichnis.
Was wird unter dem Begriff "Denken" im alltäglichen Verständnis verstanden?
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird Denken mit Begriffen wie Gedankenarbeit, Kopfarbeit oder geistige Arbeit gleichgesetzt. Es beschreibt den Prozess, Lösungsstrategien und Verhaltensweisen zu entwickeln oder sich daran zu erinnern, um Situationen zu meistern. Es kann auch bedeuten, etwas zu bedenken, ohne dass eine Strategieentwicklung das Ziel ist.
Wie wird Denken aus philosophischer Sicht betrachtet?
Aus philosophischer Sicht ist Denken ein bewusster und reflektierter Umgang mit Begriffen. Die Arbeit erwähnt den Ansatz Immanuel Kants, der Denken als eine "aktive, vereinheitlichende, synthetische, im Urteil zum Ausdruck kommende Tätigkeit" beschreibt. Erkennen ist für Kant subjektiv und der Mensch erfasst die Dinge nur als Erscheinungen, nicht die Dinge an sich.
Welche Perspektive bietet die Psychologie auf das Denken?
Aus psychologischer Sicht umfasst der Begriff Denken sämtliche kognitiven Aktivitäten. Die Individualpsychologie (Alfred Adler) betont die gegenseitige Abhängigkeit von kognitiven, emotionalen und aktionalen Dimensionen. Adler unterscheidet zwischen Denken im primären Bezugssystem (privat, emotional eingefärbt) und Denken im gesellschaftlich durchschnittlichen Bezugssystem (logisch, objektiv, sprachbasiert).
Was sind die zentralen Elemente der Denkstruktur im Recht?
Die Denkstruktur im Recht basiert auf kausalem Wenn-Dann-Denken. Die Arbeit beleuchtet die Kategorien Tatbestand (die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen), Rechtsfolge (die Konsequenz, die eintritt, wenn der Tatbestand erfüllt ist), Feststellungsverfahren (wie der Tatbestand festgestellt wird) und Vollstreckung (wie die Rechtsfolge durchgesetzt wird).
Was ist der Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Recht?
Dieser Punkt wird im Inhaltsverzeichnis erwähnt, aber im bereitgestellten Textausschnitt nicht näher erläutert.
Was ist der Unterschied zwischen objektivem und subjektivem Recht?
Dieser Punkt wird im Inhaltsverzeichnis erwähnt, aber im bereitgestellten Textausschnitt nicht näher erläutert.
Was sind Rechtsquellen?
Dieser Punkt wird im Inhaltsverzeichnis erwähnt, aber im bereitgestellten Textausschnitt nicht näher erläutert.
Was sind selbstständige und unselbstständige Rechtssätze?
Dieser Punkt wird im Inhaltsverzeichnis erwähnt, aber im bereitgestellten Textausschnitt nicht näher erläutert.
- Quote paper
- Silvia Kleffmann (Author), 2001, Denkstruktur im Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103363