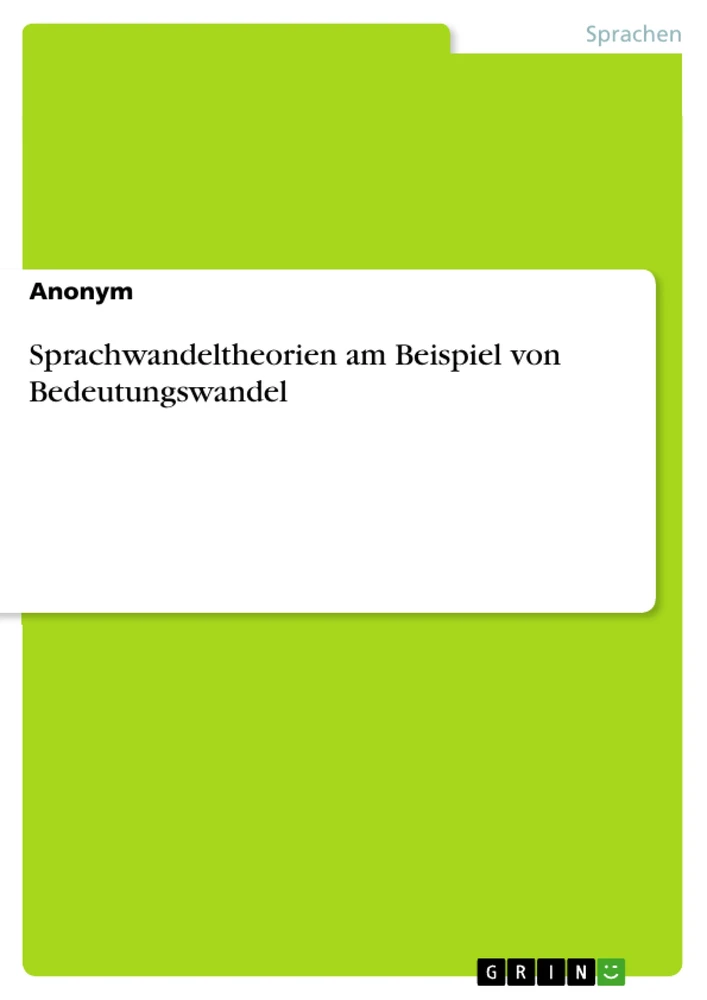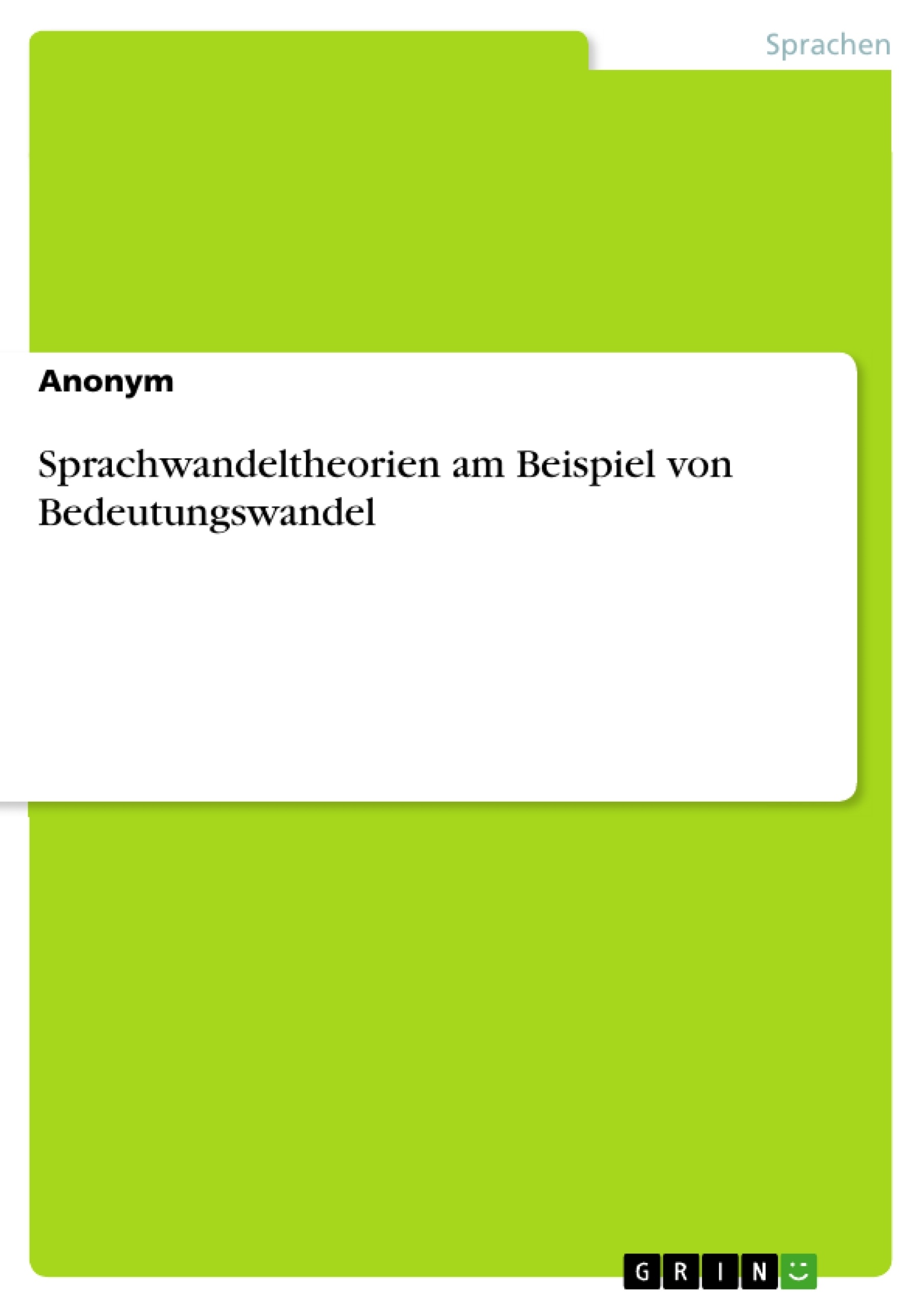Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des Sprachwandels. Dazu wurde der Frage nachgegangen, wie Sprachwandel erfolgt und welche Folgen daraus entstehen. Nach Betrachtungen zum semantischen Wandel, wurden anhand von Forschungsliteratur verschiedene Sprachwandeltheorien nachvollzogen. Durch das Erstellen eines semantischen Logbuches wurde eine Methode erlernt, an der die Verbreitung des Sprachwandels sichtbar gemacht werden kann.
Zunächst wird das semantische Logbuch bearbeitet, indem die geprüften Daten qualitativ und quantitativ ausgewertet werden. Bestimmte Verfahren semantischer Innovationen und Resultate von Bedeutungswandel werden im darauffolgenden Kapitel an Beispielen überprüft und zugeordnet. Die Texte von Damaris Nübling (2011), Rudi Keller (1995), Péter Maitz (2014) und Horst Haider Munske (2001), werden im Anschluss analysiert. Neben einer Rezension zu Nüblings Aufsatz bilden die Ergebnisse zu den Texten den größten Bestandteil der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auswertung des Semantische Logbuchs
- Übungsergebnisse
- Verfahren semantischer Innovationen
- Resultate von Bedeutungswandel
- Lektüreblock I: Keller: Sprachwandel, ein Zerrspiegel des Kulturwandels?
- Beispiel der Verwandtschaftsbezeichnungen
- Innovation Ü-30 Party
- Lektüreblock II: Nübling: Die Pejorisierung der Frauenbezeichnungen als Zerrspiegel der Kultur und als Effekt männlicher Galanterie?
- Die Bedeutungsentwicklung der Bezeichnung Frauenzimmer
- Zusammenhang der Ergebnisse mit Damaris Nüblings Text
- Theorien zum Pejorisierungs-Phänomen
- Rezension zu Damaris Nübling
- Lektüreblock III: Anglizismen im Deutschen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar „Von sichtbaren und unsichtbaren Händen in der Sprache - Sprachwandeltheorien am Beispiel Bedeutungswandel“ im Wintersemester 2017/2018 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg beschäftigte sich mit dem Sprachwandel. Ziel des Seminars war es, die Prozesse des Sprachwandels zu untersuchen und die Folgen dieser Prozesse zu beleuchten. Die Studierenden analysierten verschiedene Sprachwandeltheorien und erstellten ein semantisches Logbuch, um die Verbreitung des Sprachwandels sichtbar zu machen.
- Semantischer Wandel und dessen Folgen
- Verfahren semantischer Innovationen
- Theorien zum Sprachwandel
- Analyse von Beispielen für Sprachwandel
- Die Methode des semantischen Logbuchs
Zusammenfassung der Kapitel
Die vorliegende Arbeit präsentiert die Ergebnisse des Seminars „Sprachwandel am Beispiel Bedeutungswandel“. Sie beginnt mit einer Auswertung des semantischen Logbuchs, das von elf Studierenden erstellt wurde und 50 verschiedene Belege für Sprachwandel enthält. Die Belege werden anhand von Kriterien wie „neue Verwendungsweisen“ und „neuer Ausdruck“ analysiert, um zu bestimmen, ob sie eine semantische Innovation darstellen. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Auswertung werden vorgestellt, wobei Aspekte wie Verbreitungsweg, Erstkontaktperson und Weiterverwendung betrachtet werden.
Die Arbeit analysiert anschließend die Texte von Damaris Nübling (2011), Rudi Keller (1995), Péter Maitz (2014) und Horst Haider Munske (2001). Diese Texte dienen als Diskussionsgrundlagen für verschiedene Sprachwandeltheorien, die im Seminar behandelt wurden. Neben einer Rezension zu Nüblings Aufsatz werden die Ergebnisse zu den Texten vorgestellt, die den Hauptteil der Arbeit bilden. Die Arbeit schließt mit einem Resümee, in dem das Seminar kurz reflektiert wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Sprachwandeltheorien am Beispiel des Bedeutungswandels. Zentrale Themen sind semantische Innovationen, die Auswertung von Belegen im semantischen Logbuch, die Analyse von Fachtexten zur Sprachwandelforschung sowie die Erörterung von Theorien zum Sprachwandel.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Sprachwandeltheorien am Beispiel von Bedeutungswandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033317