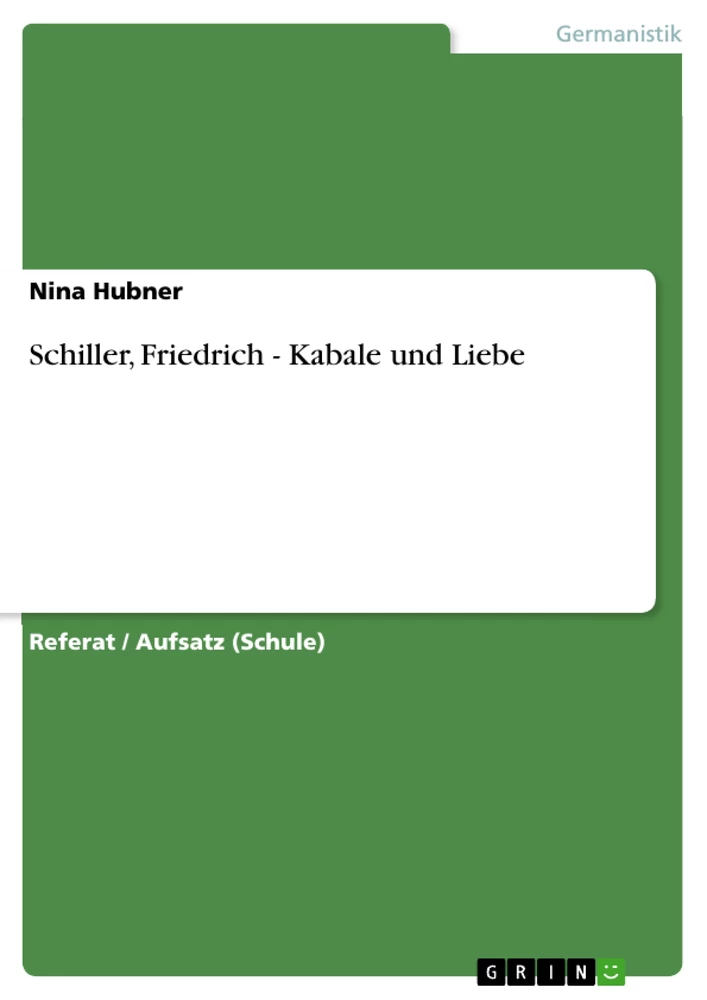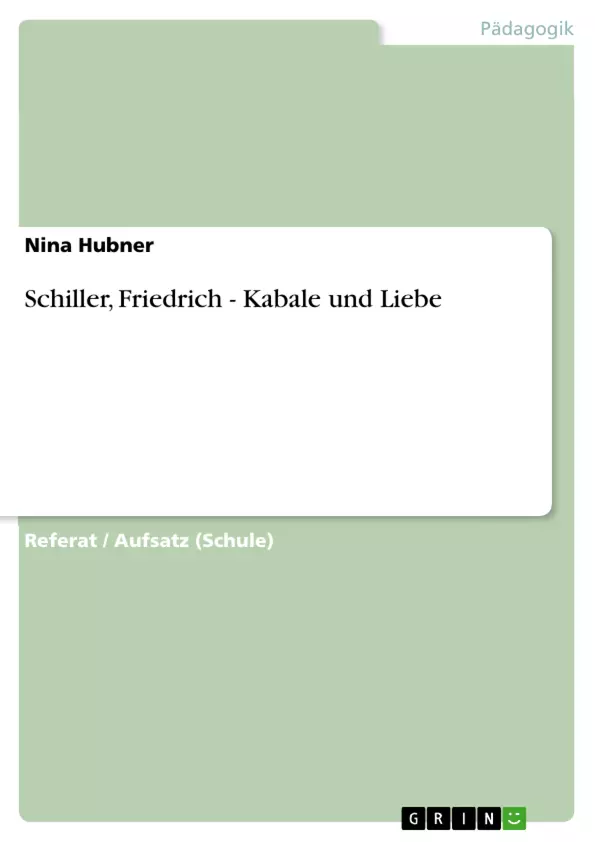In Friedrich Schillers bürgerlichem Trauerspiel "Kabale und Liebe" offenbart sich ein erschütterndes Panorama väterlicher Autorität und deren verheerenden Folgen für die junge Generation. Eine unerbittliche Konfrontation zwischen adeligem Machtanspruch und bürgerlicher Moralvorstellung entfacht einen zerstörerischen Konflikt, der tiefe Einblicke in die komplexen Vater-Sohn-Beziehungen der Ständegesellschaft des 18. Jahrhunderts gewährt. Der Präsident von Walter, ein Mann von skrupelloser Machtgier, ist besessen davon, den gesellschaftlichen Aufstieg seines Sohnes Ferdinand zu sichern, koste es, was es wolle. Er schmiedet eine heimtückische Intrige, um Ferdinand zur Heirat mit Lady Milford zu zwingen, einer ebenso einflussreichen wie skandalösen Mätresse. Auf der anderen Seite steht Musikus Miller, der bürgerliche Vater Luises, der mit aller Kraft versucht, die Reinheit und Ehre seiner Tochter vor den Verlockungen und Gefahren des Adels zu schützen. Beide Väter, getrieben von unterschiedlichen Motiven, aber vereint in ihrem unerbittlichen Willen zur Kontrolle, verstricken ihre Kinder in ein Netz aus Lügen, Erpressung und emotionaler Grausamkeit. Die daraus resultierende Tragödie enthüllt auf schmerzhafte Weise die Unvereinbarkeit von ständischen Konventionen und individuellen Sehnsüchten, von politischem Kalkül und aufrichtiger Liebe. Schillers Meisterwerk ist eine zeitlose Analyse von Machtmissbrauch, sozialer Ungerechtigkeit und den verheerenden Auswirkungen elterlicher Dominanz auf das Leben junger Menschen. Es thematisiert die damalige gesellschaftliche Ordnung, die feudalen Strukturen und die daraus resultierenden Konflikte zwischen Adel und Bürgertum. "Kabale und Liebe" ist mehr als nur ein Familiendrama; es ist eine Anklage gegen eine korrupte Gesellschaft, die ihre eigenen Kinder opfert. Die Liebe zwischen Luise und Ferdinand wird zum Schlachtfeld, auf dem die Väter ihre Machtspiele austragen. Der Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung, die Zerrissenheit zwischen Pflicht und Neigung, die Suche nach dem persönlichen Glück in einer Welt voller Intrigen und Konventionen – all diese Themen machen "Kabale und Liebe" zu einem erschütternden Spiegelbild unserer eigenen Gesellschaft. Es geht um die Frage, wie viel Freiheit wir bereit sind, für die Erwartungen anderer zu opfern, und wie viel Mut wir aufbringen, um für unsere Überzeugungen einzustehen. Ein Drama voller Leidenschaft, Intrigen und herzzerreißender Verluste, das den Leser bis zur letzten Seite in seinen Bann zieht und ihn dazu anregt, über die wahren Werte des Lebens nachzudenken. Das Stück wirft einen kritischen Blick auf die Väterrollen und deren Einfluss auf das Schicksal ihrer Kinder.
Literarische Erörterung
„Daß die Zärtlichkeit noch barbarischer zwingt als Tyrannenwut!“ (V 1, S.90,32f)
Erörtern Sie die Problematik der Väterrollen in Schillers „Kabale und Liebe“.
Seit Ende des Mittelalters gab es drei Stände, die sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich und gesellschaftlich voneinander sehr verschieden waren: Den Adel, den Bürgerstand und den Bauernstand. In diese Stände wurde man hinein geboren und blieb normalerweise den Rest seines Lebens in diesem. Der Adel war den anderen beiden Ständen überlegen und somit im öffentlichen Leben, was Steuern und ähnliches betraf, bevorzugt. Seine Mitglieder legten großen Wert auf die Abgrenzung zur sogenannten „Unterschicht“. Ganz besonders hatte das Einfluß auf die Eheschließung. Noch im 19. Jahrhundert war es vom Gesetz her vorgeschrieben, dass, wenn ein Adeliger einen Bürger oder Bauern heiraten wollte, seine drei nächsten Bekannten einverstanden sein mußten. Man unterschied auch innerhalb der Stände, zum Beispiel zwischen niederem und hohen Adel. Ferdinand gehört in „Kabale und Liebe“ letzterem an, da der Vater Präsident ist, eine besonders hohe Stellung. So gilt für ihn im Eherecht der unbedingte Grundsatz der Ebenbürtigkeit. Luise, seine Geliebte, ist aber dem Bürgerstand zugeordnet. Das Bürgertum damals hatte allerdings auch seinen Stolz gegenüber dem Adel und bevorzugte ebenfalls eine innerständische Heirat. Ferdinand jedoch lebt nach den neuen Grundsätzen des Sturm und Drang: Er will auf sein Herz hören, seine Ideale ausleben und den Regeln der „seelisch entleerten, gänzlich veräußerlichte[n] Hofwelt des Spätbarocks“ (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis klassischer Dramen, S.66) keine Folge leisten. So kann man sich vorstellen, dass er mit seiner, wie auch Luise mit ihrer Liebe an die Grenzen väterlicher Akzeptanz gehen. Diese Problematik der Väterrollen wird in folgendem Text etwas genauer dargelegt und beschrieben.
Musikus Miller, Luises Vater, gehört dem alten, ständischen Stadtbürgertum an, wie man seiner Berufsbezeichnung, wie auch seiner Denkweise entnehmen kann. Er hat ganz spezielle Wertvorstellungen, deren Einhaltung für ihn äußerst wichtig ist. Der Musiker besteht auf die Einheit des Standes, wie auch auf die Einheit der Standesmoral. Dies kann man schon daran sehen, dass er von Anfang an gegen die Liebe seiner Tochter zu dem adeligen Ferdinand ist: „meine Tochter ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero Herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu kostbar[...]“ (I 2, S.7,39f; S.8,1). Millers Ansicht nach ist Luise die Maitresse Ferdinands und das spricht natürlich ganz gegen seine Prinzipien, die auch auf die bürgerliche Unabhängigkeit vom Adel Wert legen. Ganz besonders wichtig ist ihm seine und seines Tochters Ehre. Er ist sich sicher, dass Ferdinand Luise bald sitzen läßt und „das Mädl ist verschimpfiert auf ihr Leben lang, bleibt sitzen, oder hat’s Handwerk verschmeckt [...]“ (I 1, S.6,3-6). So sieht man schon ganz zu Beginn die Bedrohung des Sekretärs Wurm, für den Luise „das schönste Exemplar einer Blondine“ (I 5, S.16,21) ist und der nach einem Scheitern der Liebe der Einzige wäre, der „durch meine [seine] Hand ihre Reputation wiedergebe[n]“ (III 1, S.52,29) könnte. Ein letzter, sehr wichtiger Punkt in Millers Wertvorstellungen ist der Glaube, die Religion. Sein ganzes Leben baut er auf die Grundsätze der Religion auf und ist so sehr stolz darauf, dass Luise Sonntags zur Kirche geht und „so fleißig an deinen [ihren] Schöpfer“ (I 3, S.12,2) denkt. Dieser feste Glaube an Gott macht aber dann letztendlich die Intrige des Präsidenten erst möglich. Sein Sekretär Wurm erklärt ihm, ein Eid fruchte „Nichts bei uns [...]. Bei dieser Menschenart alles.“(III 1, S.52,22f). Die Religion ist eigentlich der Grund schlecht hin, warum der Musikus seiner Meinung nach Luise den Ausbruch aus der ständischen Welt verwehren muß. Dieser bezieht sich nämlich nicht nur auf das soziale und emotionale Gebiet, sondern eben auch auf das des Glaubens. Von Anfang an führt Miller das Gespräch mit seiner Tochter über die Liebe zu dem Sohn des Präsidenten unter dem Gesichtspunkt des rechten Glaubens. Er und seine Tochter haben verschiedene Vorstellungen der Religion. Für Miller selbst entspricht der Glaube den Regeln der Standeswelt, wobei Luise Ansätze des Deistischen Glaubens zeigt. Gott ist für sie der Gott der Liebenden und dieser Gott schenkt ihr die Liebe (siehe I 3, S.13,20-32).
Als es dann aber um Tod oder Leben der Tochter geht, kann der Musiker seine Tochter nicht mehr über die Autorität Gottes erreichen, sondern nur, indem er als Vater auftritt: „Wenn die Küsse deines Majors heißer brennen als die Tränen deines Vaters - stirb!“ (V 1, S.90,35f) Miller ist in dem Drama in erster Linie Familienvater. Aufgrund eigener Interessen liegt ihm viel daran, das Leben seiner Tochter zu erhalten. Er wird älter und hat nur ein einziges Kind; seine Tochter Luise. Sie ist für ihn sozusagen die Lebensversicherung. (vgl. V 1, S.89,24-29) Durch seine moralische, religiöse und emotionale Überlegenheit gegenüber seiner Tochter gelingt ihm das dann auch (siehe V 1) und im speziellen dann durch oben genanntes Zitat, aber der Preis, den seine Tochter dafür zahlen muß, ist enorm hoch. Der Vater zerstört Luises Sehnsucht nach Liebe, bricht ihren Willen und nimmt ihr ihre ganze Würde. Damit ist das Ziel seiner Tochter, nämlich die Selbstverwirklichung des erwachsen werdenden Kindes dahin. Der einzige Weg der Selbstbestimmung wäre der Selbstmord gewesen, was allerdings aus religiöser Sicht eine Sünde ist und zwar laut Miller „die abscheulichste [...], die einzige, die man nicht mehr bereuen kann, weil Tat und Missetat zusammenfallen.“ (V 1, S.89,1ff). Doch nicht nur an dieser Stelle, auch an zwei anderen des Werkes zwingt die Autorität des Vaters Luise, ihrer Ich-Identität zu entsagen. Auf ihren „ehrlicher[n] Name[n]“ (III 6, S.67,17) verzichtet das Mädchen, um ihren Vater vor dem angedrohten Kriminalprozess zu retten und sie gibt ihren Anspruch auf Ferdinand auf, um den väterlichen Fluch nicht auf sich nehmen zu müssen, der „das Gewicht [ihrer Sünden] vollkommen“ (V 1, S.90,28) machen würde.
Ein weiterer Punkt der Problematik Millers Vaterrolle ist sein Unvermögen, die beiden jungen Leute zu verstehen. Er kann und darf, unter Rücksichtnahme auf die bürgerlichen Grundsätze (vor allem die Religion), den Weg der individuellen Selbstverwirklichung, den seine Tochter gehen will, nicht begreifen. Er durchschaut nicht, was Luise mit dem „ dritten Ort “ (V 1, S.87,33), den sie in dem Brief an den Major erwähnt und der außerhalb der Ständeordnung liegt, meint. Für ihn ist das Verantwortungsgefühl füreinander, also wo ihm „die Kapitale zustatten kommen“ die er im Herzen seiner Tochter anlegte (V 1, S.89,26) und vor Gott wichtig. Er ermahnt Luise, dass sie „vor Gott nicht spottest [spotten]“ (V 1, S.89,10) soll, als sie ihm von ihrer Methode erzählt, wie sie ihren Selbstmord begehen wolle: „Ich will in den Fluß springen, Vater, und im Hinuntersinken Gott den Allmächtigen um Erbarmen bitten.“ (V 1, S.89,5ff). Auch Ferdinand, der mit dem selben Gedanken wie seine Geliebte spielt, wird von dem Musikmeister, trotz jeder Menge Andeutungen, wie „Auch seine Luise ist nicht unsterblich“ (V 5, S.97,37) oder „Ich reise ab, und in dem Land, wo ich mich zu setzten gedenke, gelten die Stempel nicht.“ (V 5, S.99,20f) nicht durchschaut. Wäre Miller nicht so naiv gewesen und hätte sich des Geldes wegen, dass ihm der Major für „den drei Monat langen glücklichen Traum von Seiner Tochter“ (V 5, S.99,10f) gab, nicht so beirren lassen, hätte er das schreckliche Ende der Geschichte wohl verhindern können.
So ist aus der anfänglich so selbstbewußten, autoritären Person, die den „ungehobelten Gast“ (II 6, S.45,16), den Präsidenten, als dieser in sein Haus kommt, vor die Tür setzten will, eine Person geworden, die der Millerin, seiner Frau, gleicht. Diese, und am Ende auch er selbst, Adel und Wohlstand als erstrebtes Ziel an. Dies beweist die Sprache der Mutter, indem sie französische Ausdrücke wie „Billetter“ (I 1, S.6,20) verwendet, wie auch die vollkommene Verwirrung des Vaters über das Gold (V 5, S.98,23-30). An dem Musiker kann Schiller seine Ideale somit nicht mehr zeigen und er hat deshalb seine Bedeutung für den Autor gegen Ende des Stücks verloren.
Die zweite Vaterfigur in dem Drama ist der Vater Ferdinands, der Präsident. Wie vorher schon erwähnt, ist er ein Angehöriger des Adelsstandes und seine Vorstellung, wie eine optimale Familie aussehen soll, unterscheidet sich auf Grund dessen enorm von der des bürgerlichen Familienvaters. So ist das Verhältnis zu seinem eigenen Sohn äußerst distanziert, man könnte fast meinen, wie zwischen einem Arbeiter und seinem Vorgesetzten. Ferdinand tritt in das Zimmer seines Vaters und begrüßt ihn mit den Worten: „Sie haben befohlen, gnädiger Herr Vater“ (I 7, S.21,3). In heutiger Zeit ist es einem Jugendlichen kaum mehr vorstellbar, seine Eltern mit „sie“ anzusprechen oder wenn ihre Eltern ihre Kinder sehen wollen, erst einmal nach ihnen gerufen werden muß (siehe ! 7, S.21,4f). Die Erziehung des Jungen fand in „Akademien“ (III 1, S.49,20) statt, wo dieser allerdings „Die Grundsätze [...] hierherbrachte“ (III 1, S.49,20f), die dem Vater wie auch seinem Sekretär Wurm nicht „recht einleuchten“ (III 1, S.49,21). Ein Vater wie Miller, der seine Kinder selbst erzieht, hat nun mal mehr Einfluß auf deren Ich, beispielsweise indem er seine Tochter vor dem Selbstmord bewahren kann, als einer, der seinen Sohn schon in frühen Jahren anderen zur Erziehung überlässt. Des weiteren sieht der Präsident den Begriff der Sexualität vollkommen anders als ein Bürger oder auch sein Sohn. Ein Verhältnis zu einem Bürgersmädchen sei gar nicht schlecht. Es beweise, dass der Major Qualitätsgefühl, was Mädchen betreffe, habe und denkt, er betrüge sie sowieso nur, was genau die Voraussetzungen für eine spätere Karriere seien. Das ist der Beweis für den Adeligen, dass sein Sohn das Zeug zum Präsidenten hat und er denkt auch ein Kind, dass eventuell aus dem Verhältnis zustande kommen würde, sei kein Problem. (I 5, S.16,28.35). Allerdings ist er auch der Meinung, dass sein Nachkomme die Dienste des Fräuleins auch „jederzeit bar“ (II 6, S.44,10f) bezahlen sollte. Sehr wichtig ist dem Vater aber auch die Verfügungsgewalt über die Vermählung seines Ferdinands, was im Adelsstand damals Gang und Gäbe war. „Du wirst dich entschließen [...] eine Frau zu nehmen“ (I 7, S.22,38f), ist seine bestimmte, keinen Widerspruch duldende Forderung an seinen Sohn. In der bürgerlichen Familie legt der Vater aber Wert darauf, dass der Liebhaber „hinter dem Rücken des Vaters [...]sein Gewerbe an die Tochter bestellen“ (I 2, S.10,36f) muss.
Wie vorher schon erwähnt, ist der Präsident ein Adeliger und hat deshalb zum Teil ganz andere Wertvorstellungen als der bürgerliche Miller. Ihm ist am wichtigsten, Macht zu haben und möglichst weit nach oben zu kommen. Er hat es geschafft, seinen Sohn schon sehr früh auf die, seiner Meinung nach richtige Bahn zu bringen: „Du bist im zwölften Jahre Fähndrich. Im zwanzigsten Major. Ich habe es durchgesetzt beim Fürsten.“ (I 7, S.22,12ff) Dieses Streben nach Einfluß ist auch der Grund dafür, dass Ferdinand gegen seinen Willen Lady Milford, die Maitresse des Herzogs heiraten soll, um seine und die Macht seines Sohnes bei Hofe zu sichern: „Er weiß [...] wie sehr sich mein Ansehen auf den Einfluß der Lady stützt“ (I 5, S.17,38f) Er legt großen Wert auf seine Autorität und reagiert daher sehr gereizt und wenig verständnisvoll auf das Widerstreben seines Sohnes, seinen Vorstellungen zu folgen: „Eine Frechheit, bei meiner Ehre“ (I 7, S.23,16). Doch das Verständnis von Glück der beiden Blutsverwandten unterscheidet sich nun einmal ganz drastisch. Für den Präsidenten ist die volle Gunst des Schicksals ein Leben voller Macht und Prestige. Er ist sich ganz sicher, dass dies auch für seinen Sohn das einzig Wahre ist und nimmt sich deshalb auch heraus „an deinem [Ferdinands] Glück [zu] arbeiten“ (I 7, S.21,12). Dieser allerdings ist gar nicht der Meinung seines Vaters, denn dessen „Glückseligkeit macht [mache] sich nur selten anders als durch Verderben bekannt“ (I 7, S.22,22f). Seine Vollkommenheit von Glück liegt in seinem Herzen und seiner Ehre: „In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben.“ (I 7, S.22,30f). Er ist sogar so abgeneigt gegenüber dem Adelsstand, dass er dem Präsidenten den Verzicht auf sein Erbe erklärt, solange es ihn „nur an einen abscheulichen Vater“ (I 7, S.22,2f) erinnere.
Trotz all dem ist der Adelige seinem Sohn aber in jeglicher Hinsicht überlegen. Er reagiert mit perfektem, ironischen Reden auf seinen unwilligen Nachkommen, der während des gesamten Gesprächs nur aus ganzem Herzen spricht (siehe I 7, S.22,30-35), und stellt ihm schließlich eine Falle, die Ferdinand nicht erkennt: „Wo doch hoffentlich deine Ehre nichts einwenden wird? [nachdem er die Lady „Gräfin von Ostheim“ nannte]“ (I 7, S.24,15f). Letzterer antwortet mit genau dem, was sein Vater hören wollte, nämlich, dass es „die Heurat“ (I 7, S.24,32f) war, die er verabscheute und nicht der Stolz. Mit Hilfe seines Sekretärs Wurm entwirft er daraufhin einen Plan, eine Kabale, um „den Roman mit dem Bürgermädchen zu endigen und die Verbindung mit Lady Milford zustand‘ zu bringen“ (III 1, S.51,8ff). Das ist nötig, um seinen Anspruch auf unbedingte Autorität zufrieden zu stellen. Diese Intrige basiert auf dem Eid der bürgerlichen Familie und der Eifersucht Ferdinands, der voll und ganz auf die Verschwörung herein fällt. „Das also war’s, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzte!“ (VI 1, S.68,26f). Dieses Textbeispiel zeigt auch, dass der Major seine Luise eigentlich nie richtig verstanden hat.
Trotz der scheinbar grundlegenden Verschiedenheit von Vater und Sohn, kehrt der Vater im Sohn wieder. „Wurm, besinn Er sich, daß ich, wenn ich einmal glaube, hartnäckig glaube; rase, wenn ich zürne“ (I 5, S.17,6ff). Diese Worte deuten, obwohl sie auf den Präsidenten bezogen sind, das psychologische Schicksal Ferdinands voraus, dessen Bestehen auf seine Ideale der rücksichtslosen, gebieterischen Willenskraft seines Vaters entspricht. Das allerdings mit anderem Inhalt, moralischer Einstellung und Ziel, wie der Leser schnell bemerkt.
Trotz der vielen Unterschiede zwischen den beiden Vätergestalten kann man doch einige Parallelen ziehen. Sie ähneln sich in vielerlei Hinsicht, nur, dass der Leser das nicht sofort bemerkt, da jeder der beiden auf seine eigene Art und Weise handelt. Sehr auffallend wäre zunächst einmal, wie wichtig den beiden das Ansehen ihrer Familie ist. Um die gute Reputation müssen sie allerdings beide, jeder auf seine Art, kämpfen. Während Miller seine väterliche Autorität gegen seine Tochter anwendet und sie letztendlich überzeugt, ihren Geliebten zu vergessen und sich ganz ihm zu widmen („So zernicht ich sein letztes Gedächtnis.“ (V 1, S.91,1f)), benützt der Präsident seinen Einfluss, um die Intrige zu starten, die sich aber mit dem Tod der beiden Kinder ganz und gar gegen seinen Plan wendet. Die Ehre spielt also in beiden Ständen eine sehr wichtige Rolle.
Beide können die Liebe nicht verstehen, da beide die neue Weltvorstellung, die ihre Kinder haben, nicht begreifen. So bricht, beim Präsidenten und Sohn noch stärker als in der Bürgersfamilie, ein Generationenkonflikt aus. Bei den Adeligen stehen sich zwei Epochen gegenüber. Die väterliche Hofwelt des Spätbarocks ohne jegliche emotionale Regungen tritt in Gegensatz zu jener extrem einseitigen Innerlichkeit des Sohnes, jenseits jeglicher ständischer Schranken (vgl. I 7). Der Major, der mit seiner ganzen Leidenschaft in diese neue Welt hinein gewachsen ist, reißt Luise mit sich, so dass auch in ihrer Familie dieser Konflikt zwischen den Generationen leichte Andeutungen nimmt. Zum Beispiel hat sie ein ganz anderes Verständnis von Liebe und Glauben: „Wenn meine Freude über sein Meisterstück mich ihn selbst übersehen macht [...] muß das Gott nicht ergötzen?“ (I 3, S.12,18ff), denkt Luise, ganz widersprüchlich zu der Meinung des Musikers. Die Väter sind Fanatiker der nüchternen Realität. Sie fürchten die Sprengkraft dieses neuen, aus der alten Regelung reißenden Seelentums, da es die Auflösung der bisherigen ständischen Verfassung mit sich bringen könnte: „Damit nun der Fürst im Netzt meiner [seiner] Familie bleibt“ (I 5, S.18,4f) muss Ferdinand Lady Milford heiraten, um seinen und den Stand seines Vaters zu sichern.
Was beide Väter noch verbindet, ist, wie sie die Liebe sehen, zunächst nämlich nur aus Perspektiven des Brauches (vgl. I 5, S.16,28-35), aus den Vorurteilen ihrer Umwelt: „das Mädel ist verschimpfiert auf ihr Leben lang“ (I 1, S.6,4f) und ihrer Erfahrungen: „Worauf kann so ein Windfuß wohl sonst sein Ansehen richten?“ (I 1, S.6, 9f). Die Liebe zwischen Adel und Bürgertum ist also einzig und allein ein soziologisches Problem. Man merkt genau, dass die beiden keine Ahnung von diesem neuen, ganz individuellen menschlichen Sein haben.
Doch am Ende, als beide ihr Kind verloren haben, zeigen sie eine ganz andere Seite ihres Ichs auf. Vor allem der Präsident fällt, laut Regieanweisungen „in der schrecklichsten Qual“ (V 8, S.110,23) vor dem Körper seines Sohnes nieder und bittet seinen diesen, noch einen „Blick [...] auf einen zerschmetterten Vater fallen“ (V 8, S.110,19f) zu lassen, aber auch Miller weiß sich vor Verzweiflung nicht mehr zu helfen: „Er stürzt aus dem Zimmer“ (V 8, S.110,11f). Ferdinand „reicht ihm [dem Präsidenten] seine sterbende Hand“ (V 8,S.110,26). Diese Geste soll am Schluß noch, trotz all des Bösen, das geschehen war, die natürliche Ordnung des bürgerlichen Familienkonzepts durchblicken lassen. Für Schiller, der selbst ein Bürgersmann war, ist dies ein Vorbild der zu erreichen versuchten Ordnung zwischen den einzelnen Individuen überhaupt. Das sind die nicht zu unterschätzenden, werttragenden Ausmaße, die die so unmenschlich scheinende Beziehung zwischen Ferdinand und seinem hat.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Erörterung zu "Kabale und Liebe"?
Die Erörterung beschäftigt sich mit der Problematik der Väterrollen in Schillers "Kabale und Liebe". Dabei werden die unterschiedlichen Wertvorstellungen und Erwartungen von Musikus Miller (Luises Vater) und dem Präsidenten von Walter (Ferdinands Vater) untersucht, sowie die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf ihre Kinder.
Welche Stände werden in der Erörterung thematisiert und wie beeinflussen diese die Handlung?
Die Erörterung thematisiert die drei Stände Adel, Bürgerstand und Bauernstand. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Unterschiede zwischen Adel und Bürgertum gelegt und wie diese Unterschiede die Beziehung zwischen Ferdinand und Luise sowie die Handlungen ihrer Väter beeinflussen. Die Ständegesellschaft mit ihren festen Regeln und Erwartungen bildet den Hintergrund für den Konflikt zwischen den Liebenden und ihren Vätern.
Welche Wertvorstellungen hat Musikus Miller und wie wirken sich diese auf seine Beziehung zu Luise aus?
Musikus Miller legt großen Wert auf Standesehre, bürgerliche Unabhängigkeit, Religion und Moral. Er ist von Anfang an gegen die Beziehung seiner Tochter zu Ferdinand, da er ihn für einen adeligen Verführer hält und um Luises Ruf fürchtet. Seine religiösen Überzeugungen machen die Intrige des Präsidenten erst möglich, da Wurm dies erkennt und ausnutzt. Letztendlich zwingt er Luise, ihrer Liebe zu entsagen, um ihr Leben und seine Ehre zu retten, was jedoch ihren Selbstverwirklichungswunsch zerstört.
Wie unterscheidet sich die Vaterrolle des Präsidenten von der des Musikus Miller?
Der Präsident sieht seinen Sohn vor allem als Werkzeug zur Machterhaltung und Karriereförderung. Er misst dem Adel, Macht und Prestige höchste Bedeutung bei und erwartet von Ferdinand, dass er sich seinen Plänen unterordnet. Das Verhältnis zu seinem Sohn ist distanziert und von Autorität geprägt. Er ist bereit, Intrigen zu spinnen, um seine Ziele zu erreichen, was schließlich zum Tod beider Kinder führt. Im Gegensatz dazu ist Miller eher um das Wohl und die Ehre seiner Tochter besorgt, obwohl auch er seine eigenen Wertvorstellungen durchsetzen will.
Welche Parallelen gibt es zwischen den beiden Väterfiguren?
Trotz ihrer unterschiedlichen Standesherkunft und Wertvorstellungen haben die beiden Väterfiguren einige Gemeinsamkeiten. Beide legen großen Wert auf das Ansehen ihrer Familie und versuchen, dieses auf ihre Weise zu wahren. Beide können die neue Weltvorstellung ihrer Kinder nicht nachvollziehen und fürchten die Auflösung der traditionellen Ordnung. Letztendlich zeigen beide Väter, nachdem sie ihre Kinder verloren haben, menschliche Regungen und Verzweiflung.
Wie wird der Generationenkonflikt in "Kabale und Liebe" dargestellt?
Der Generationenkonflikt wird durch die unterschiedlichen Wertvorstellungen und Lebensziele der Väter und ihrer Kinder verdeutlicht. Die Väter repräsentieren die alte, ständisch geprägte Welt, während die Kinder nach individueller Selbstverwirklichung und einer neuen Ordnung streben. Dieser Konflikt führt zu Missverständnissen, Spannungen und schließlich zur Tragödie.
Welche Bedeutung hat die Liebe in "Kabale und Liebe" aus soziologischer Sicht?
Die Liebe zwischen Adel und Bürgertum wird als soziologisches Problem dargestellt. Die unterschiedlichen Standesregeln und Vorurteile der jeweiligen Gruppen erschweren eine freie und gleichberechtigte Beziehung. Die Väter sehen die Liebe vor allem aus der Perspektive ihrer Standesinteressen und können die individuellen Gefühle und Bedürfnisse ihrer Kinder nicht verstehen.
Was kann man aus der Problematik der Väterrollen in "Kabale und Liebe" für die heutige Zeit lernen?
Obwohl die ständische Gesellschaft heute nicht mehr existiert, bleiben die Themen Generationenkonflikt, unterschiedliche Wertvorstellungen und das Streben nach individueller Selbstverwirklichung relevant. Die Erörterung zeigt, wie wichtig es ist, die Perspektiven anderer zu verstehen, auch wenn diese von den eigenen abweichen. Sie mahnt zu Toleranz, Geduld und dem Dialog, um Konflikte friedlich zu lösen und tragische Konsequenzen zu vermeiden.
- Arbeit zitieren
- Nina Hubner (Autor:in), 2001, Schiller, Friedrich - Kabale und Liebe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103303