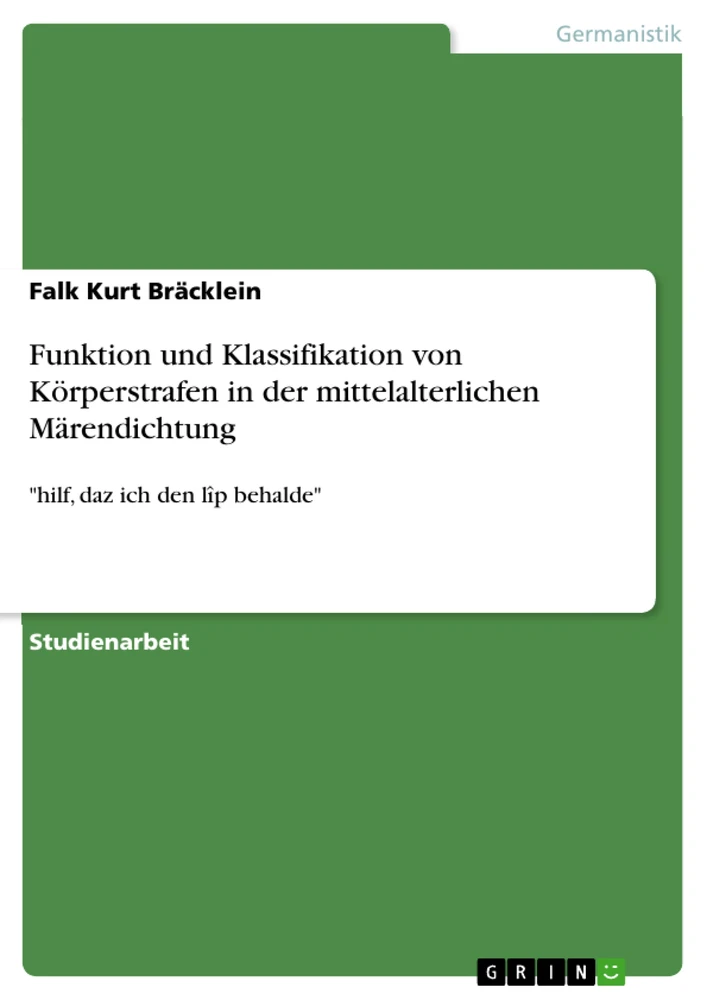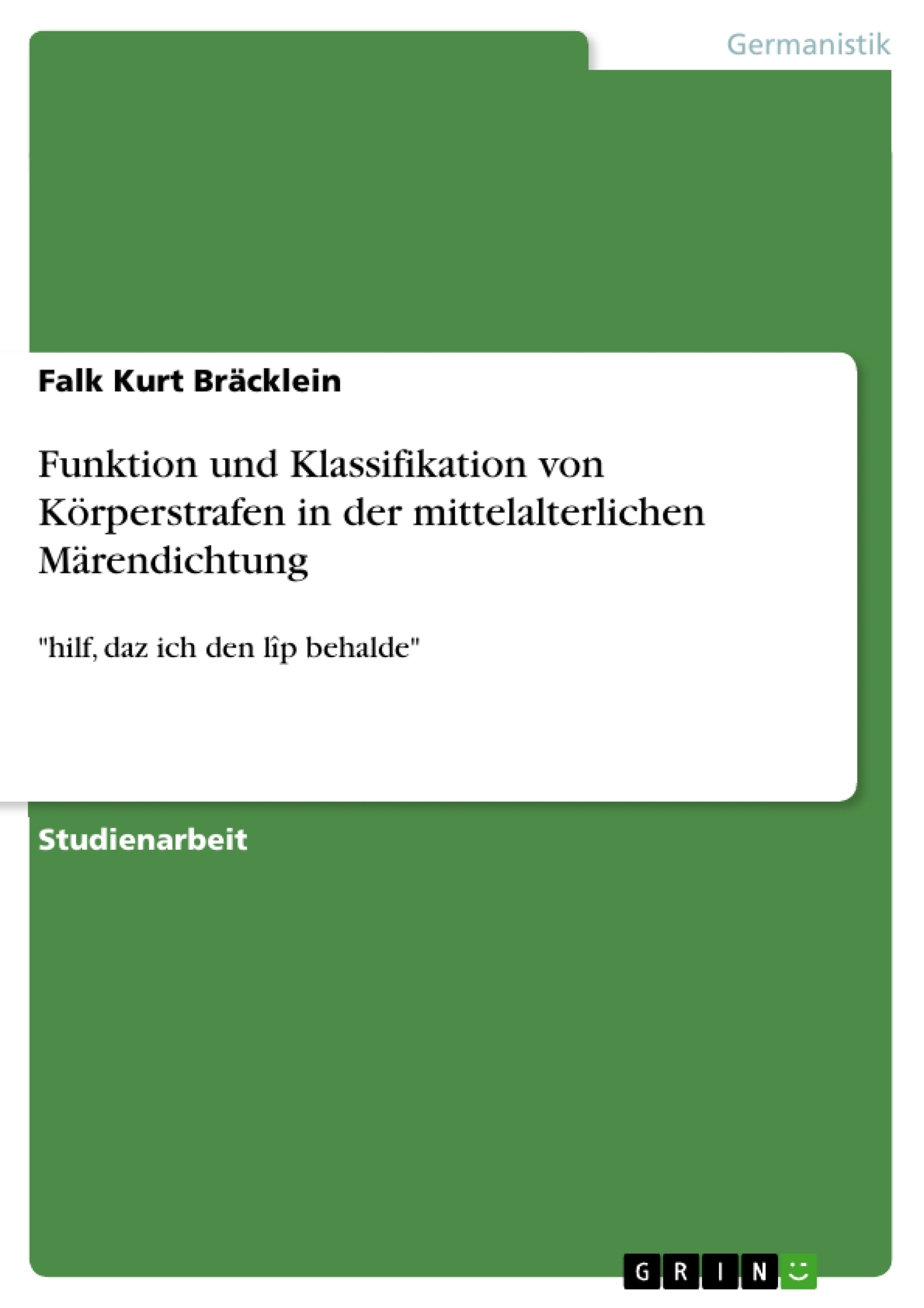Ziel dieser Arbeit ist es, den Einsatz des narrativen Mittels der Körperstrafe in der mittelalterlichen Märendichtung zu untersuchen und eine Klassifizierung nach ihrer Erzählfunktion vorzunehmen. Dabei wird sowohl deren Bedeutung für die Gestaltung des jeweiligen Textes als auch deren Wirkung auf das Publikum in den Blick genommen. Wie häufig und zu welchem Zweck wird das Stilmittel verwendet? Welche Erzählfunktionen erfüllen diese Strafen innerhalb der Mären und welche Wirkung auf das Publikum soll durch sie erzielt werden? Ist das Motiv der Körperstrafe in dem jeweiligen Märe konstituierend für die Erzählung? Oder kann es weggelassen beziehungsweise durch eine andere Form der Sanktionierung ersetzt werden, ohne die Grundaussage des Märes zu verlieren?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Märe im zeit- und ideengeschichtlichen Kontext des Mittelalters
- 2. Anwendung von Körperstrafen in der mittelalterlichen Märendichtung
- 2.1 Untersuchungsgegenstand und methodisches Vorgehen
- 2.2 Die Körperstrafe als Strafe für den Verstoß gegen Geschlechternormen
- 2.2.1 Textanalyse und Interpretation des Märes Der begrabene Ehemann
- 2.2.2 Textanalyse und Interpretation des Märes Die böse Adelheid
- 2.3 Die Körperstrafe als Strafe für den Verstoß gegen Standesnormen - Textanalyse und Interpretation des Märes Ritter Beringer
- 2.4 Die Körperstrafe als Strafe für Ehebruch –Textanalyse und Interpretation des Märes Der kluge Knecht
- 2.5 Die Körperstrafe als Opfer - Textanalyse und Interpretation des Märes Die treue Gattin
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion und Klassifizierung von Körperstrafen als narratives Mittel in der mittelalterlichen Märendichtung. Es wird analysiert, wie häufig Körperstrafen eingesetzt werden, zu welchem Zweck, welche Erzählfunktionen sie erfüllen und welche Wirkung sie auf das Publikum haben. Die zentrale Frage ist, ob das Motiv der Körperstrafe konstituierend für die jeweilige Erzählung ist oder ob es ersetzbar wäre, ohne die Grundaussage zu verändern.
- Das Märe im Kontext des mittelalterlichen Zeit- und Ideengefüges
- Körperstrafen als Sanktion für den Verstoß gegen gesellschaftliche Normen (Geschlechter- und Standesnormen)
- Die Körperstrafe als Strafe für Ehebruch
- Die Körperstrafe als Opferhandlung
- Die narrative Funktion und Wirkung von Körperstrafen in der Märendichtung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Märe im zeit- und ideengeschichtlichen Kontext des Mittelalters: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über das Mittelalter (500-1500 n. Chr.), seine agrarisch geprägte, feudal organisierte Gesellschaft, und die zentrale Rolle der "triuwe". Es beschreibt die patriarchalische Struktur mit dem Ideal des starken Mannes und dem negativen Frauenbild, das auf dem Eva-Archetyp basiert. Das Kapitel beleuchtet die weltlichen und kirchlichen Rechtsquellen des Mittelalters und die Informationshoheit der Kirche. Die Märendichtung wird als Möglichkeit der Umgehung der kirchlichen Zensur vorgestellt, mit einer Definition des Märes nach Hanns Fischer und einer Einordnung des Werkes des Strikers.
2. Anwendung von Körperstrafen in der mittelalterlichen Märendichtung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung, die auf der Analyse von 15 ausgewählten Mären beruht. Es stellt fest, dass in 10 dieser Mären Körperstrafen vorkommen und klassifiziert diese in vier Kategorien: Strafe für den Verstoß gegen Geschlechternormen, Strafe für den Verstoß gegen Standesnormen, Strafe für Ehebruch und Körperstrafe als Opfer. Das Kapitel legt die methodische Vorgehensweise bei der Textanalyse (äußere und innere Merkmale) dar und kündigt die detaillierte Untersuchung ausgewählter Mären an.
2.2 Die Körperstrafe als Strafe für den Verstoß gegen Geschlechternormen: Dieses Kapitel analysiert den Einsatz von Körperstrafen im Kontext des Verstoßes gegen die mittelalterlichen Geschlechterrollen, unter Verwendung des Märes "Der begrabene Ehemann" als Beispiel. Es wird eingegangen auf den Autor (Der Stricker), die Überlieferung des Werkes und die Figurenkonstellation (dummer Mann, listige Frau, lüsterner Pfarrer). Die Analyse konzentriert sich auf das Fehlen einer Figurenentwicklung, die fehlende Namensgebung der Figuren, den Erzählbeginn in medias res und die überzeichnete Parodie von Minnelied-Elementen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Machtverhältnisse in der Ehe und deren Verletzung durch die handelnden Figuren.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Märendichtung, Körperstrafe, Geschlechterrollen, Standesnormen, Ehebruch, Narratologie, Textanalyse, Interpretation, Triuwe, Der Stricker, Novellistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anwendung von Körperstrafen in der mittelalterlichen Märendichtung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Funktion und Klassifizierung von Körperstrafen als narratives Mittel in der mittelalterlichen Märendichtung. Es wird analysiert, wie häufig Körperstrafen eingesetzt werden, zu welchem Zweck, welche Erzählfunktionen sie erfüllen und welche Wirkung sie auf das Publikum haben. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist das Motiv der Körperstrafe konstituierend für die jeweilige Erzählung oder ersetzbar, ohne die Grundaussage zu verändern?
Welche Mären werden untersucht?
Die Untersuchung basiert auf der Analyse von 15 ausgewählten Mären. Konkret werden die Mären "Der begrabene Ehemann", "Die böse Adelheid", "Ritter Beringer", und "Der kluge Knecht" sowie "Die treue Gattin" im Detail analysiert. In 10 dieser Mären kommen Körperstrafen vor.
Wie werden die Körperstrafen klassifiziert?
Die Körperstrafen werden in vier Kategorien eingeteilt: Strafe für den Verstoß gegen Geschlechternormen, Strafe für den Verstoß gegen Standesnormen, Strafe für Ehebruch und Körperstrafe als Opferhandlung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Vorgehensweise bei der Textanalyse, die sowohl äußere als auch innere Merkmale der Texte berücksichtigt. Die Analyse umfasst die Untersuchung der Figurenkonstellation, des Erzählstils (z.B. in medias res), der Figurenentwicklung (oder deren Fehlen), der Namensgebung der Figuren und der stilistischen Mittel (z.B. Parodie von Minnelied-Elementen).
Welchen zeitgeschichtlichen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit betrachtet das Märe im Kontext des mittelalterlichen Zeit- und Ideengefüges (500-1500 n. Chr.). Es wird die agrarisch geprägte, feudal organisierte Gesellschaft, die zentrale Rolle der "Triuwe", die patriarchalische Struktur mit dem Ideal des starken Mannes und dem negativen Frauenbild (basierend auf dem Eva-Archetyp), die weltlichen und kirchlichen Rechtsquellen und die Informationshoheit der Kirche beleuchtet. Die Märendichtung wird als Möglichkeit der Umgehung der kirchlichen Zensur vorgestellt, mit einer Definition des Märes nach Hanns Fischer und einer Einordnung des Werkes des Strikers.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Märe im Kontext des mittelalterlichen Zeit- und Ideengefüges; Körperstrafen als Sanktion für den Verstoß gegen gesellschaftliche Normen (Geschlechter- und Standesnormen); Die Körperstrafe als Strafe für Ehebruch; Die Körperstrafe als Opferhandlung; Die narrative Funktion und Wirkung von Körperstrafen in der Märendichtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mittelalterliche Märendichtung, Körperstrafe, Geschlechterrollen, Standesnormen, Ehebruch, Narratologie, Textanalyse, Interpretation, Triuwe, Der Stricker, Novellistik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: 1. Das Märe im zeit- und ideengeschichtlichen Kontext des Mittelalters; 2. Anwendung von Körperstrafen in der mittelalterlichen Märendichtung (unterteilt in Unterkapitel zu verschiedenen Kategorien von Körperstrafen); 3. Fazit.
- Quote paper
- Falk Kurt Bräcklein (Author), 2019, Funktion und Klassifikation von Körperstrafen in der mittelalterlichen Märendichtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1031129