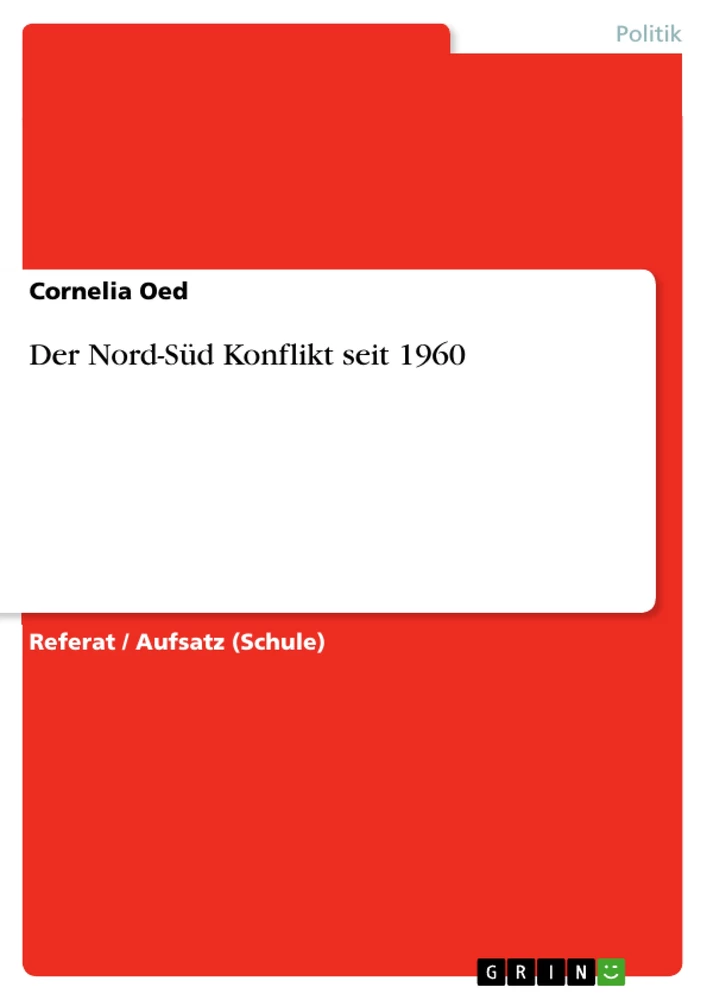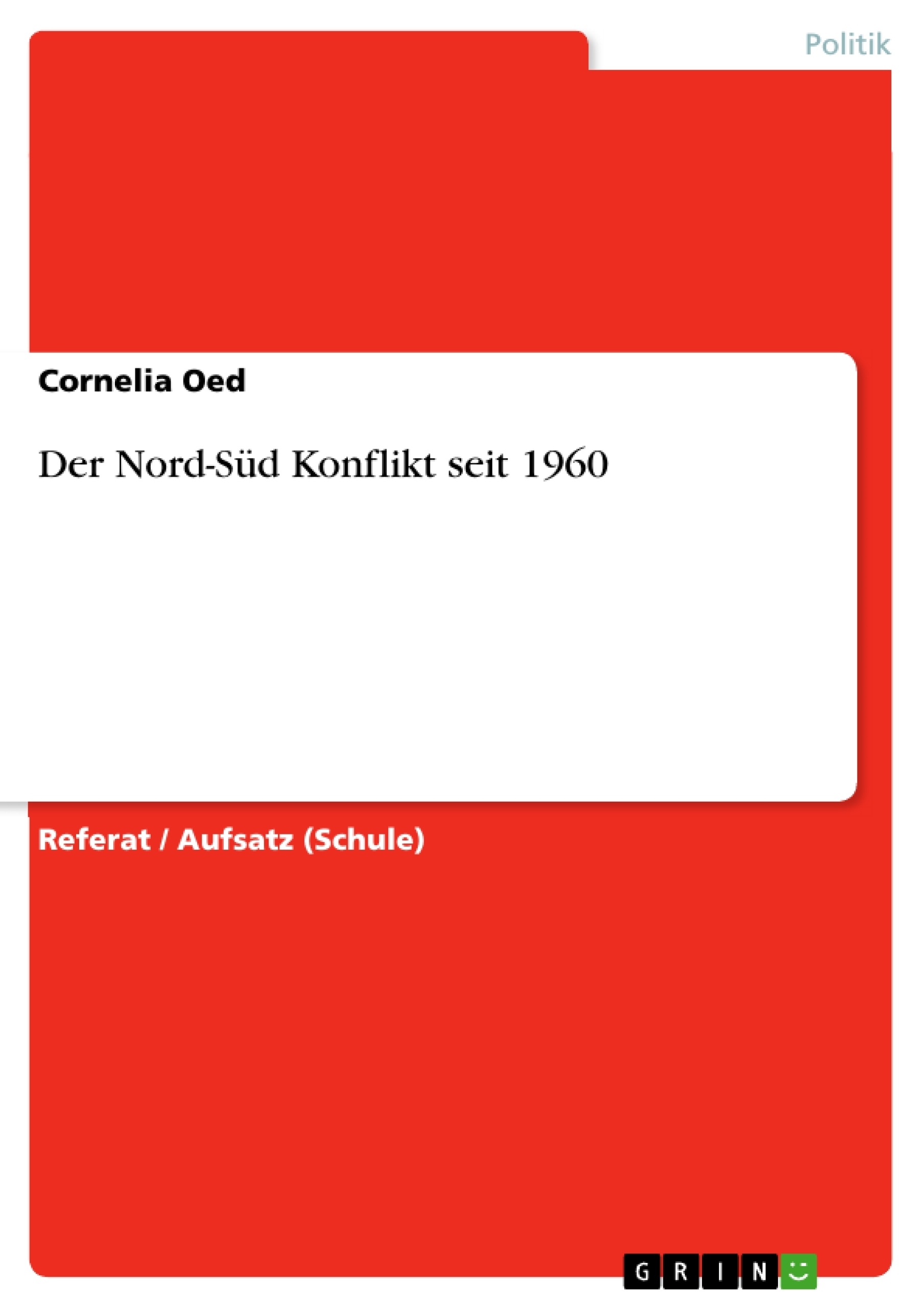Was wäre, wenn die unsichtbare Hand des globalen Wirtschaftssystems nicht Wohlergehen für alle schafft, sondern tiefe Gräben zwischen Arm und Reich zementiert? Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine aufschlussreiche Reise durch die Geschichte des Nord-Süd-Konflikts seit den 1960er Jahren. Es beleuchtet die komplexen Ursachen und verheerenden Folgen der Ungleichheit, von Hunger und Armut bis hin zu politischer Instabilität und Umweltzerstörung. Analysiert werden die politischen und wirtschaftlichen Mechanismen, die diesen Konflikt am Leben erhalten, darunter die Rolle von Entwicklungshilfe, Verschuldung und Neokolonialismus. Die Analyse der globalen Zusammenhänge ist messerscharf und legt schonungslos die Mechanismen offen, die eine gerechtere Weltordnung verhindern. Es werden die gescheiterten Versuche einer globalen Gerechtigkeit ebenso thematisiert, wie die anhaltenden Machtstrukturen, die eine tatsächliche Veränderung blockieren. Das Buch stellt unbequeme Fragen und fordert zum Umdenken auf. Es bietet eine kritische Auseinandersetzung mit den gängigen Narrativen und zeigt, wie tiefgreifend die Verflechtungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sind. Es geht um weit mehr als nur wirtschaftliche Kennzahlen; es geht um die Lebensrealität von Milliarden Menschen, die unter den Bedingungen einer ungerechten Weltordnung leiden. Sind wir bereit, die systemischen Ungleichheiten zu erkennen und zu überwinden, die den Nord-Süd-Konflikt befeuern? Eine eindringliche Mahnung und ein Weckruf für alle, die sich für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft einsetzen wollen. Tauchen Sie ein in die Welt der globalen Ungleichheit, verstehen Sie die komplexen Zusammenhänge und werden Sie Teil der Lösung. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Entwicklungspolitik, internationale Beziehungen, globale Gerechtigkeit und die Zukunft unserer Welt interessieren. Es bietet eine fundierte Grundlage für Diskussionen und Engagement und zeigt Wege auf, wie wir gemeinsam eine Welt gestalten können, in der Wohlstand und Chancen gerechter verteilt sind.
Der Nord-Süd-Konflikt seit dem Beginn der 60er Jahre
Einleitung: - Darstellung der Unterschiede und der sozialen Situation in den ärmsten Länder
- Politische Entwicklung seit den 60er Jahren
- Hauptprobleme der Beziehung zwischen Nord und Süd
1. Darstellung der Unterschiede zwischen Norden und Süden und die soziale Situation in den ärmsten Länder
- Was versteht man unter Norden und Süden? (Karte1)
>> Ausnahmen Australien und Südafrika, Einteilung der armen Länder in verschieden Kategorien, da große Unterschiede in der Entwicklung, Abhängigkeit der Entwicklung von Rohstoffen und Klima
- seit 1960 einige positive Entwicklungen (Vergleichszahlen von 1960 und 1990):
- Steigerung der Lebenserwartung von 46 auf 63 Jahre (Deutschland (1990) ca. 75 Jahre); praktisch Halbierung der Kindersterblichkeit
- Erhöhung der Alphabetisierungsquote von Erwachsenen von 46 auf 64%
- Aber: grundsätzlich Vergrößerung der Probleme und der sozialen Unterschiede Zunahme der Gesamtzahlen der auf absolut Armen über 1,13 Mrd. (ca. 21% der Weltbevölkerung; Definition: Atlas der Weltverwicklungen, S. 9; Berechnung anhand der Kaufkraft)
- Die reichsten 20% der Weltbevölkerung (= Menschen in Industrieländern): Besitz von 83% des Reichtums, Verbrauch von 70% der Energie und 60% der Nahrungs- mittel; Einkommensgefälle zu ärmsten 20% der Weltbev. 60:1 (Statistiken)
- Jeder 10. Mensch hungert, ca. 40 Mio. im Jahr Tote direkt oder indirekt durch Hunger, 20 % der Weltbev. ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser
- Folgen: Bevölkerungswachstum (Kinder als einzige soziale Sicherheit), Kinderar- beit (>80 Mio. Kinder), Gewalt und Kriminalität, Drogen, Krankheiten (AIDS, v.a. in Schwarzafrika), Flüchtlinge
2. Politische Entwicklung des Nord- Süd- Konflikts seit Beginn der 60er Jahre
- Entwicklung des Nord- Süd- Konflikts untrennbar mit Ost- West- Konflikt verbunden, Entwicklungsländer Teil des Spannungsfeldes
- Weltweite Institutionen, getragen von den Industrienationen:
- Allgemeines Zoll und Handelsabkommen (GATT) >> Ziel: Förderung des inter- nationalen Handels, Instrumente: Abbau von Handelshindernissen (Zölle, ...)
- Internationaler Währungsfond (IWF) >> Ziel: freier internationaler Handelsverkehr durch Garantie des allgemeinen freien Währungsumtausch
- erste Zuwendung zu wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Fragestellungen bei beginnender Entspannung zwischen Ost und West nach der Kubakrise (1962)
- 1962 Konferenz von Kairo >> Forderung der Entwicklungsländer: gerechtes internationales Gremium zur Regelung der Wirtschaftsbeziehungen mit entsprechender Vertretung der Entwicklungsländer, Förderung der südlichen Wirtschaft
- 1964 1. UN- Konferenz für Welthandel und Entwicklung (UNCTAD) >> trotz Widerstand der Industrienationen Etablierung als Dauereinrichtung, wird zum wichtigsten Forum des Nord- Süd- Konfliktes
- 1970 UNO- Resolution 2626: Festlegung der Entwicklungshilfe der Industrieländer auf 0,7% ihres Bruttosozialproduktes, allerdings ohne festen Zeitraum >> bis heute praktisch nirgends erreicht (USA: 0,15%, Deutschland: 0, 46%)
- 1969 Pearson -Bericht: Vergrößerung des absoluten Abstandes zwischen Nord und Süd, größere Ungleichheit innerhalb der Länder (Eliten - absolut Arme) >> rege Debatten, Kritik an Entwicklungspolitik
- Entwurf einer Neuen Weltwirtschaftsordnung (NWWO) durch Blockfreie, 1974 auf Vollversammlung der UNO verabschiedet;
Forderungen:
- Recht der Entwicklungsländer auf Kontrolle über eigene Wirtschaftsressourcen
- Stabilisierung der Exporterlöse
- Förderung der Industrialisierung (Technologietransfer)
- Demokratisierung der Weltwirtschaftspolitik (Aufwertung der Stellung der Entwicklungsländer in den Institutionen.)
>> Empörung der Industrienationen
- Bereitschaft der Industrieländer zur Verhandlung über einzelne Punkte wegen
- überraschender Geschlossenheit der 3. Welt hinter NWWO
- Erfahrung der eigenen Verwundbarkeit durch Ölkrisen
>> 1975-77 Konferenz für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit in Paris mit Entstehung des Nord- Süd- Dialoges;
>> Wirtschaftlichen Eigeninteressen, deshalb kaum Umsetzung der Forderungen der NWWO, Hinhaltetaktik der Industrienationen bis Ende der Debatten 1981
- 80er Jahre("Verlorenes Jahrzehnt"): Niedergang der Blockfreien, kein Standhalten gegen wachsenden Ost /West Druck, Verlust der einstimmigen Haltung >> z. B. keine Verhinderung des Krieges zwischen Irak und Iran möglich
Weltwirtschaftskrise der 80er Jahre, Sinken der Exporterlöse
>> Schwere Krise aller Entwicklungsländer >> Zunehmende Verschuldung
- Folgezeit: Auflagen des IWF zur Wiederherstellung der Schulddienstfähigkeit >> Kürzungen im sozialen Bereich, Vermehrter Zwang zum Export >> Verelendung breiter Bevölkerungsschichten, Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen (Regenwald,...),
>> Rezessionen, Bürgerkriege, zwischenstaatliche Konflikte, Umweltkatastrophen >> "Jahrzehnt der Flüchtlinge"
- 1986 Wiederaufnahme des Nord- Süd- Dialogs
- UNO: 1992 Umwelt- und Entwicklungskonferenz in Rio de Janeiro, 1993 Weltmenschenrechtskonferenz in Wien
>> Denkunterschiede zwischen Nord und Süd werden erneut deutlich (andere Ziele und Normen)
- April 1994 Abschluss der sogenannten "Uruguay- Runde des GATT"
>> Ersetzung des GATT durch neue Welthandelsorganisation WTO
>> 26000 Seiten umfassendes Abkommen: Verbesserung der Wirtschaftschancen, aber: wie immer kaum Umsetzung
- Nach Ende des Ost- West- Konfliktes: UN als wichtigste Institution internationaler Konfliktregelung: UN- Blauhelmeinsätze in verschiedenen Ländern (Kuwait, Jugoslawien), Überwachung von Wahlen in politisch instabilen Ländern
3. Hauptprobleme in der Beziehung der Industrienationen zu den Entwicklungsländern, Hürden für eine Annäherung
a) Entwicklungshilfe
- Problem: Entwicklungshilfe nicht nur positiv; 1985 scharfe Kritik einer ehemaligen Ministeriumsmitarbeiterin (Buch): "Ohne Entwicklungshilfe ginge es den Menschen in den Ländern der 3. Welt besser"
>> leicht übertrieben, aber viele Fehler, die Entwicklung eher behindert haben:
- Vergabe der Gelder an die Staaten und nicht an konkrete Projekte: Geld errei- cht nicht arme Bevölkerung, keine Unterstützung der Selbsthilfe, Korruption
- Unterstützung von gigantischen Großprojekten (z. B. Staudämme), die Situa- tion der sowieso schon sehr armen Kleinbauern noch weiter verschlechtern
- Überwiegend Förderung der Städte, Vernachlässigung ländlicher Gebiete >> Landflucht
- Mangelnde Ausbildung der Helfer: Missverständnisse, Zerstörung traditioneller Lebensformen, Steigerung des Konsumdenkens
- Falsche Form der Hilfe: Nahrungsmittelspenden in Zeiten ohne Hungersnot >> einheimische Produkte teurer, Zerstörung der einheimischen Agrarwirtschaft; gleiches Problem bei Gebrauchtkleiderspenden
- Wirtschaftlicher und politischer Aspekt der Entwicklungshilfe:
- Vergabe von Entwicklungshilfe bevorzugt an befreundete und in Zukunft vielleicht nützliche Länder: z. B. Israel fast 300 $ pro Einwohner, Indien 1,9 $ (Indien: Wohnort von 34% der absolut Armen) (Statistik)
- Eigennütziges Denken der Geldgeber: Grundlinien der Entwicklungspolitik der BRD von 1986: "Die Entwicklungspolitik der Bundesregierung unterliegt wie die anderen Politikbereiche dem grundgesetzlichen Auftrag, dem deutsch- en Volk zu nutzen und Schaden von ihm zu wenden." >> Kopplung von Hilfe an Aufträge aus den Ländern, die wiederum deutsche Wirtschaft fördern
- Hilfe von Banken und Unternehmern nur mit dem Ziel, Gewinn zu machen
- Analyse der Erfolge: Verwechslung von Wachstum und Entwicklung
b) Verschuldung (eng zusammenhängend mit Entwicklungshilfe >>Hilfskredite)
- Entstehung der Schuldenkrise:
- 70er Jahre: sehr günstige Kreditangebote der Banken der Industrieländer ohne viele Auflagen >> sinnlose, unvollendete Projekt, Verschwinden des Geldes
- 80er Jahre: Änderung der Situation auf dem Finanzmarkt: drastisches Ansteigen der Zinsen, Schuldenabzahlung durch Exporteinnahmen nicht mehr deckbar, "Schuldenfalle" ("Tüte")
- Verschlimmerung durch sinkende Rohstoffpreise (Export) und höhere Kosten fertige Produkte (Importe)
- Strenge Auflagen des IWF zur Wiederherstellung der Schulddienstfähigkeit (s.o.) >> keine Verbesserungen
- Feststellung '90: Insgesamt haben die armen Länder mehr gezahlt als erhalten (Bild)
- Situation heute: bei den meisten Ländern keine realistische Möglichkeit zur Schul- denrückzahlung mehr, Schuldendienst mehr Ausgaben als Bildung >Einteilung der Länder in verschieden Gruppen: 41 meistverschuldeten: HIPC(Karte)
- Initiative "Erlassjahr 2000": Ziel: 100 Mrd. (rel. wenig, vgl. "Tüte") Schuldener- lass für HIPC-Länder >> Einsparungen sollen armer Bevölkerung zugute kommen
c) Abhängigkeit der Entwicklungsländer bis hin zum "Neo-Kolonialismus"
- Praktisch alle Entwicklungsländer ehemalige Kolonien, seit Entkolonialisierung (>> Doro) faktisch unabhängige Staaten mit eigener Politik und Wirtschaft
- Vor allem aber im Abhängigkeit von Industrienationen
- Handelsverträge und Eingriffe in Staatsführung (z.B. Strukturanpassungen)
- "Bananenrepubliken" (v.a. Lateinamerika): größere Teile des Staatsgebietes gehören multinationalen oder US-amerikanischen Firmen
- Dollar inoffizielle Hauptwährung in vielen Ländern (>> Dollarisierung in Ecuador)
- Abhängigkeit von Technologien und deren Entstandhaltung (Ersatzteile!)
- Druckmittel der Industrienationen für Eingriffe in innere Angelegenheiten
- Wirtschaftssanktionen, z.B. Blockade >> seit 1960 US-Blockade von Kuba
- Beeinflussung und/oder Bestechung von Politikern
- Finanzielle/militärische Unterstützung innerer oder äußerer Feinde >> z.B. Chile: Unterstützung von Militärputschisten (Pinochet) zum Sturz der sozialist. Allende-Regierung
- Militärische Invasion
- 1966 Staatspräsident von Ghana: "Neokolonialismus als letztes Stadium des Imperialismus" >> Macht ohne Verantwortung für Praktizierende, Ausbeutung ohne Abhilfe für darunter Leidende
Ende: Ausblick in die Zukunft
- aufmerksame Zeitungslektüre: Immer wieder Folgen, z. B. Putsch in Ecuador, Indonesien,...
- Nord-Süd- Konflikt = "Zeitbombe" >> es muss was getan werden;
>> Entwicklungshilfe muss sinnvoller werden (Hilfe zur Selbsthilfe) >> Verschuldung: "Erlassjahr 2000" nur 1. Schritt,
>> Einflussnahme des Westen senken, Entwicklungsländer eigenen Weg gehen lassen:
z. B. Sozialismus in Kuba (armer, aber in Bildungs- und Gesundheitswesen sehr fortschrittlicher Staat)
>> Bewusstsein im Westen muss gestärkt werden;
Literatur:
- Grundkurs Geschichte 13
- Atlas der Weltverwicklungen: 3. Welthaus Bielefeld
- Manana: Entwicklungshelfer berichten aus drei Kontinenten, Hrsg. Horst Heidtmann und Christoph Plate
- Sozialwissenschaften: Nord-Süd-Konflikt und 3. Welt, Hrsg. Gerald Braun
Häufig gestellte Fragen zum Nord-Süd-Konflikt seit dem Beginn der 60er Jahre
Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem Norden und dem Süden, und wie ist die soziale Situation in den ärmsten Ländern?
Der "Norden" und der "Süden" sind vereinfachte Bezeichnungen für entwickelte Industrieländer bzw. Entwicklungsländer. Trotz einiger positiver Entwicklungen seit 1960 (z.B. höhere Lebenserwartung, Alphabetisierungsquote) haben sich die Probleme und sozialen Unterschiede vergrößert. Ein großer Teil der Weltbevölkerung lebt in absoluter Armut, hungert, hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, und es gibt viele Kinderarbeiter. Die reichsten 20% der Weltbevölkerung besitzen den Großteil des Reichtums und verbrauchen einen unverhältnismäßig großen Teil der Ressourcen.
Wie hat sich der Nord-Süd-Konflikt seit den 60er Jahren politisch entwickelt?
Der Nord-Süd-Konflikt ist eng mit dem Ost-West-Konflikt verbunden. Institutionen wie GATT und IWF wurden von Industrienationen getragen. Forderungen der Entwicklungsländer nach einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung (z.B. durch die UNCTAD und die NWWO) stießen auf Widerstand. Die Industrieländer zeigten nur begrenzte Bereitschaft zur Umsetzung der Forderungen. Die Weltwirtschaftskrise der 80er Jahre führte zu einer Verschuldung der Entwicklungsländer und zu Auflagen des IWF, die oft zu Verelendung und Umweltzerstörung führten. Der Nord-Süd-Dialog wurde wieder aufgenommen, aber Denkunterschiede zwischen Nord und Süd blieben bestehen. Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes spielte die UN eine wichtigere Rolle bei der Konfliktregelung.
Welche Hauptprobleme bestehen in der Beziehung der Industrienationen zu den Entwicklungsländern?
Probleme gibt es in den Bereichen Entwicklungshilfe, Verschuldung und Abhängigkeit (bis hin zum "Neo-Kolonialismus"). Entwicklungshilfe kann kontraproduktiv sein, wenn sie nicht an konkrete Projekte vergeben wird, Großprojekte fördert, ländliche Gebiete vernachlässigt oder falsche Formen der Hilfe verwendet werden. Die Verschuldung der Entwicklungsländer wurde durch günstige Kreditangebote, steigende Zinsen, sinkende Rohstoffpreise und strenge Auflagen des IWF verschärft. Viele Entwicklungsländer sind abhängig von Industrienationen durch Handelsverträge, Eingriffe in die Staatsführung, technologische Abhängigkeit und den Einsatz von Druckmitteln wie Wirtschaftssanktionen oder militärische Interventionen.
Was kann getan werden, um den Nord-Süd-Konflikt zu lösen?
Die Entwicklungshilfe muss sinnvoller werden (Hilfe zur Selbsthilfe), die Verschuldung muss reduziert werden (z.B. durch den "Erlassjahr 2000"), die Einflussnahme des Westens muss gesenkt werden, und die Entwicklungsländer müssen ihren eigenen Weg gehen können. Das Bewusstsein im Westen muss gestärkt werden.
Welche Literatur wird empfohlen, um sich weiter über den Nord-Süd-Konflikt zu informieren?
Empfohlen werden unter anderem "Grundkurs Geschichte 13", der "Atlas der Weltverwicklungen", "Manana: Entwicklungshelfer berichten aus drei Kontinenten", "Sozialwissenschaften: Nord-Süd-Konflikt und 3. Welt" sowie Zeitungsartikel und Fernsehreportagen.
- Quote paper
- Cornelia Oed (Author), 1999, Der Nord-Süd Konflikt seit 1960, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102789