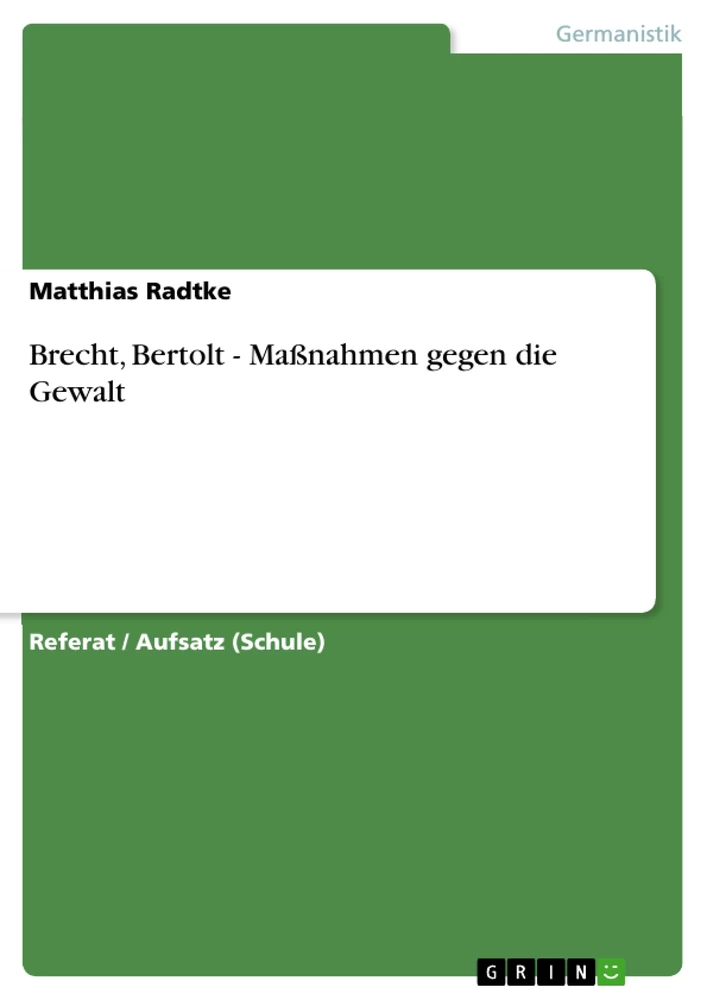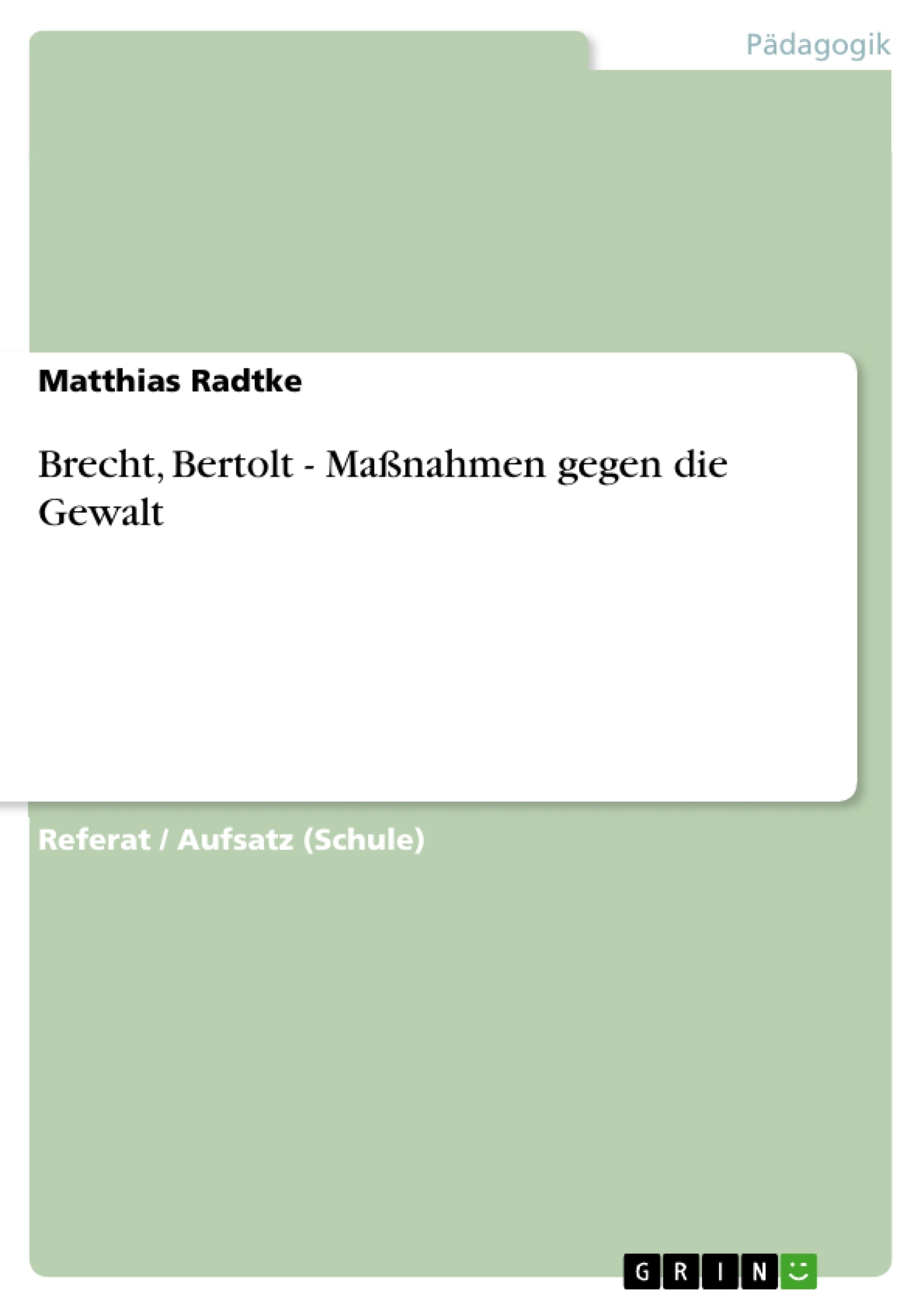In einer Welt, in der Gewalt allgegenwärtig ist, stellt Bertolt Brecht in "Maßnahmen gegen die Gewalt" die unbequeme Frage: Wie begegnet man der Unterdrückung, wenn offener Widerstand unmöglich scheint? Die Geschichte entfaltet sich in zwei Ebenen: Zunächst begegnen wir Herrn Keuner, dem Denker, der sich in einer gefährlichen Situation mit einer Notlüge vor den Schergen der Macht schützt. Um sein Handeln zu rechtfertigen, erzählt er die Geschichte von Herrn Egge, der während einer Zeit der Illegalität sieben Jahre lang einem Agenten dient, der sein Haus beschlagnahmt hat. Egge schweigt, verweigert jede Kommunikation, bis er nach dem Tod des Agenten und der Säuberung seiner Wohnung endlich das erlösende "Nein" ausspricht. Brecht verwebt diese beiden Erzählungen kunstvoll zu einer Parabel über Widerstand, Anpassung und die moralischen Kompromisse, die in Zeiten der Tyrannei gefordert sind. Ist Schweigen eine Form des Widerstands, oder nur eine Kapitulation vor der Gewalt? Die subtile Analyse der Charaktere, insbesondere des Herrn Keuner und des Herrn Egge, deren Namen selbst schon vielschichtig sind, offenbart die Zerrissenheit des Einzelnen im Angesicht einer übermächtigen Staatsgewalt. Brechts Sprache ist dabei präzise und vieldeutig zugleich, die Namen sind nicht zufällig gewählt, sondern tragen zur tieferen Bedeutungsebene bei. "Maßnahmen gegen die Gewalt" ist mehr als nur eine Erzählung; es ist eine Aufforderung zur Reflexion über die eigene Haltung, über die Grenzen des Widerstands und die Möglichkeiten, auch in scheinbarer Ohnmacht die eigene Integrität zu bewahren. Es ist eine politische Parabel, die uns lehrt, dass selbst die kleinsten Handlungen und Entscheidungen in einer Welt der Gewalt von Bedeutung sind. Die Geschichte regt zum Nachdenken über Zivilcourage, Widerstand und die Frage an, wann Anpassung notwendig und wann Verrat an den eigenen Überzeugungen ist, und macht sie zu einer zeitlosen Lektüre für alle, die sich mit den ethischen Dilemmata politischer Umbruchzeiten auseinandersetzen wollen. Brecht dekonstruiert die gängigen Vorstellungen von Heldentum und zeigt, dass Widerstand viele Gesichter haben kann, selbst das des scheinbar Angepassten.
Bertholt Brecht beschreibt in dieser Kurzgeschichte "Maßnahmen gegen die Gewalt", wie seine beiden Hauptfiguren der Gewalt entgegen treten.
Diese Geschichte besteht eigentlich aus zwei Geschichten, einer äußeren und einer inneren Geschichte (Rahmenund Binnengeschichte). Die innere wir von dem Herrn Keuner, der die Hauptfigur in der äußeren Geschichte ist, dargebracht. Er erzählt sie, um sein Verhalten gegen über einem seiner Schüler zu rechtfertigen.
Die Rahmengeschichte
Im Vordergrund steht zunähst einmal die Rahmengeschichte. Sie beginnt damit, dass Herr Keuner als ,,der Denkende"
(Z.1) dargestellt wird und damit über seine Mitmenschen übergeordnet wird. Herr Keuner spricht sich zunähst einmal gegen die Gewalt aus, die aber gerade in diesem Augenblick hinter ihm steht (Z.1 -3). Als diese ihn fragt, was er da gerade gesagt habe, spricht er sich für die Gewalt aus (Z.6-8). Als er später von einem seiner Schüler wird, warum er nicht zu seiner vorherigen Aussage Gestanden hätte, Antwortete er mit der Aussage: ,,Ich habe kein Rückgrat zum Zerschlagen"
und gerade er ,,müsse länger leben als die Gewalt"
(Z.10-14). Diese Situation zeigt, dass Herr Keuner sich nur durch eine Notlüge, durch Unehrlichkeit retten konnte, dass er seine Meinung nicht immer frei zugeben kann. Erst in gewaltloser Zeit kann man zu seiner Aussage stehen, ohne gleich befürchten zu müssen, wegen dieser nicht überleben zu können.
Die Binnengeschichte
Dann beginnt er als Begründung seines Verhaltens eine Geschichte über das Schicksal des Herrn Egge zu erzählen. Damit beginnt die Binnengeschichte.
Während der ,,Zeit der Illegalität", einer Gewaltherrschaft, beschlagnahmte ein Agent, der dazu von denen, ,,die die Stadt beherrschten"
berechtigt wurde, die Wohnung und den Besitz des Herrn Egge (Z.17 -26). Am Abend des ersten Tages, nachdem er gegessen und gewaschen hatte, legte sich der Agent nieder und ,,fragte mit dem Gesicht zur Wand"
(Z.27-29) Herrn Egge: ,,Wirst du mir dienen?"
(Z.30) antwortet dieser jedoch nicht. Sieben Jahre lang ist Herr Egge der ergebene Diener des Agenten, spricht aber kein Wort. Er antwortet auf die sieben Jahre zuvor gestellte Frage erst nach dem Tod des Agenten und der an schließenden Reinigung seiner Wohnung: ,,Herr Egge [ ] atmete auf und antwortete: ,Nein`."
(Z.39-42).
Herr Egge lebte die sieben Jahre im Zwang, unter Gewaltherrschaft des Agenten und diente diesem resigniert, ohne sich zu wehren. Er hat erkannt, dass sich diesem Schicksal zu fügen, das kleinere Übel ist, er wehrt sich nur innerlich gegen dessen Unterdrückung, indem er nicht mit ihm spricht. Dadurch wird die Frage, die sich dem Leser unwillkürlich stellt, nämlich warum Herr Egge, ,,der gelernt hatte, nein zu sagen"
(Z.18) dieses K önnen nicht anwendet, beantwortet.
Vergleich und Schlussfolgerung
Durch die identische Situation in den beiden Geschichten, wird klar, daßbeide, Der Herr Keuner und der Herr Egge, ein ähnliches Erlebnis mit der ,,Gewalt" haben. Sie stehen beide nicht zu den von ihnen davor ge äußerten Standpunkten. Es gibt zwischen ihnen aber einen Unterschied, der Herr Keuner äußert sich gegen seine innere Einstellung. Der Herr Egge hingegen verhält sich gegen seine Prinzipien, gibt aber keine Äußerungen dem Agenten gegenüber von sich.
Dieses Verhalten ist aber für die Beiden die einzigste Möglichkeit gegen die ,,Gewalt" zu wehren, ohne Gewalt einsetzen zu müssen. Man sieht durch diese Darstellung, daßman ohne Gewalteinsetzung gegen die Gewalt siegen kann.
Es handelt sich bei "Maßnahmen gegen die Gewalt" um eine politische Parabel der Moderne, der Leser kann daraus Richtlinien für seine späteren Handlungen ziehen.
Jetzt zur sprachlichen Analyse.
Auffällig in der Sprache der Rahmenhandlung ist vor allem die Darstellung der Gewalt, die plötzlich hinter Herrn Keuner steht und ihn anspricht (Z.4f).
Diese erweckt den Eindruck, als würde an ihrer Stelle eine Person oder Gruppe stehen und mit Herrn Keuner sprechen. Dadurch fällt es dem Leser später leichter, die Bild- und Sachebene der Lehrparabel zu durchschauen, der Vergleich der Gewalt mit dem Agenten der Binnengeschichte und der ,,Gewalt" in der Rahmengeschichte wird offensichtlicher.
Aber auch die Namen der Personen sind vieldeutig. So kann man bei dem Nahmen ,, Keuner" auch schnell mal ,,Keiner" lesen, dieser könnte sich auf Niemand beziehen, der wiederum auch jeder in der Gesellschaft sein kann. Der Name ,,Egge" ist eine in der Aussprache weichere und abgewandelte Form von Ecke. Das ,, gg" ist gegenüber dem ,,ck" angepaßter der Aussprache gegenüber und bedeutet doch das Gleiche. Genauso verhält sich der Herr Egge, er steht der Situation angepaßt gegenüber, das zeigt sich darin, daßer sieben Jahre lang dem Agenten dient, ohne es zu wollen, aber auch ohne sich zu wehren. Der Agent steht für die anonyme Macht der Herrschenden, die die Gewalt über alles und jeden besitzen. Der Agent ist ein Staatsdiener.
Ein weiteres Merkmal der Sprache des Textes ist die Verbindung der Rahmenhandlung mit der Binnengeschichte, durch die Konjunktion "und"(Z.15). Damit wird einerseits die innere Erzählung angekündigt und somit zwischen den beiden Geschichten differenziert, anderer-seits wirkt das "und" aber auch verbindend, stellt die Handlungen auf eine gemeinsame Ebene, was dazu beiträgt, daßder Leser die Parallelen der zwei Situationen begreift. Das Wort "Schein" (Z.20) bedeutet die Legalisierung der Handlungen des Agenten.
Nach der Lektüre und Analyse des Textes "Maßnahmen gegen die Gewalt" von Bertold Brecht stellt sich die Frage nach der Intention des Autors.
Häufig gestellte Fragen
- Worum geht es in Bertolt Brechts Kurzgeschichte "Maßnahmen gegen die Gewalt"?
- Die Kurzgeschichte "Maßnahmen gegen die Gewalt" von Bertolt Brecht beschreibt, wie die Hauptfiguren der Gewalt begegnen. Die Geschichte besteht aus einer Rahmenhandlung und einer Binnengeschichte. Herr Keuner, die Hauptfigur der Rahmenhandlung, erzählt die Binnengeschichte, um sein Verhalten gegenüber einem Schüler zu rechtfertigen.
- Was ist die Kernaussage der Rahmengeschichte?
- Die Rahmengeschichte beginnt damit, dass Herr Keuner als
"der Denkende"
dargestellt wird und sich zunächst gegen Gewalt ausspricht. Als er jedoch von der Gewalt selbst konfrontiert wird, ändert er seine Aussage. Später erklärt er seinem Schüler, dass er dies getan hat, um zu überleben und länger als die Gewalt zu leben. Diese Situation verdeutlicht, dass Ehrlichkeit in Zeiten der Gewalt gefährlich sein kann. - Was ist die Handlung der Binnengeschichte?
- Die Binnengeschichte handelt von Herrn Egge, dessen Wohnung und Besitz während einer Gewaltherrschaft von einem Agenten beschlagnahmt werden. Sieben Jahre lang dient Herr Egge dem Agenten, ohne ein Wort zu sprechen. Erst nach dem Tod des Agenten und der Reinigung seiner Wohnung antwortet er auf die Frage des Agenten von vor sieben Jahren mit
"Nein"
. - Welche Bedeutung hat das Verhalten von Herrn Egge?
- Herr Egge fügt sich dem Zwang und dient dem Agenten resigniert, ohne sich zu wehren. Er hat erkannt, dass dies das kleinere Übel ist. Er wehrt sich innerlich, indem er nicht mit dem Agenten spricht. Dies erklärt, warum Herr Egge sein Können,
"nein zu sagen"
, nicht anwendet. - Welche Parallelen gibt es zwischen Herrn Keuner und Herrn Egge?
- Sowohl Herr Keuner als auch Herr Egge erleben eine ähnliche Situation mit der "Gewalt". Beide stehen nicht zu ihren vorher geäußerten Standpunkten. Herr Keuner äußert sich gegen seine innere Einstellung, während Herr Egge sich gegen seine Prinzipien verhält, aber keine Äußerungen gegenüber dem Agenten macht.
- Welche Möglichkeiten haben die Figuren, sich gegen die Gewalt zu wehren?
- Für beide Figuren ist ihr Verhalten die einzige Möglichkeit, sich gegen die "Gewalt" zu wehren, ohne Gewalt einzusetzen. Die Darstellung zeigt, dass man ohne Gewalteinsatz gegen die Gewalt siegen kann.
- Welche sprachlichen Besonderheiten gibt es im Text?
- Auffällig ist die Darstellung der Gewalt, die wie eine Person mit Herrn Keuner spricht. Die Namen der Personen sind vieldeutig. "Keuner" kann als "Keiner" gelesen werden, der für jeden in der Gesellschaft stehen kann. "Egge" ist eine abgewandelte Form von "Ecke". Der Agent steht für die anonyme Macht der Herrschenden.
- Was ist die Intention des Autors?
- Durch den Vergleich von Herrn Keuner und Herrn Egge wird Kritik an dem Nichteinhalten eigener Prinzipien geübt. Beide sind prinzipiell gegen Gewalt, entgehen ihr aber durch Notlügen oder Dienen. Der Leser soll über seine eigene Einstellung zum Thema Gewalt nachdenken.
- Arbeit zitieren
- Matthias Radtke (Autor:in), 2001, Brecht, Bertolt - Maßnahmen gegen die Gewalt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102739